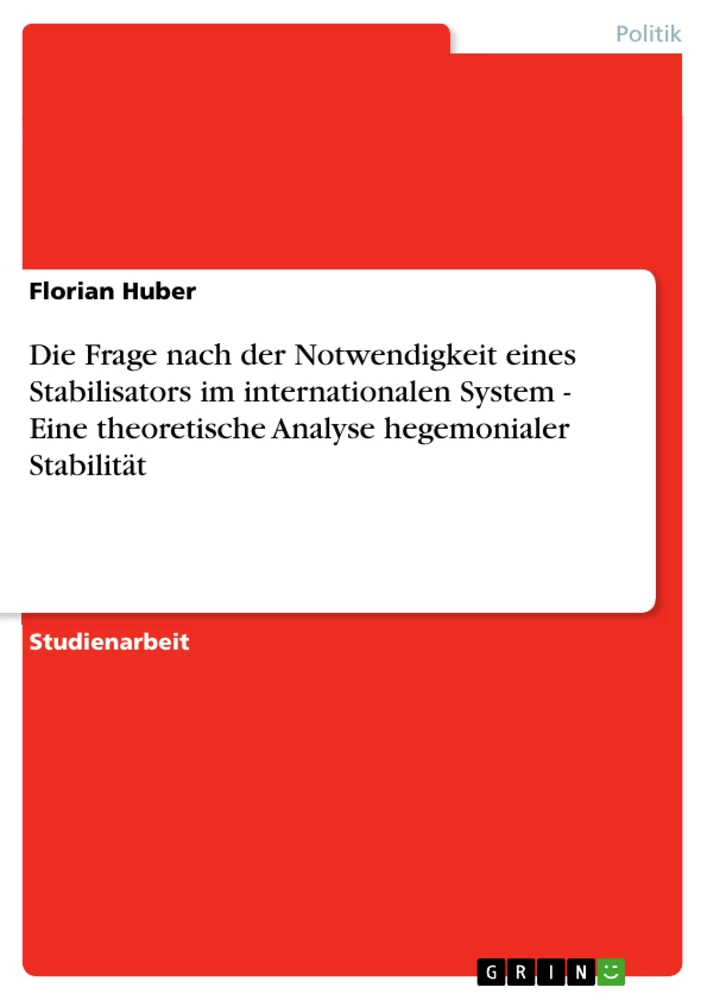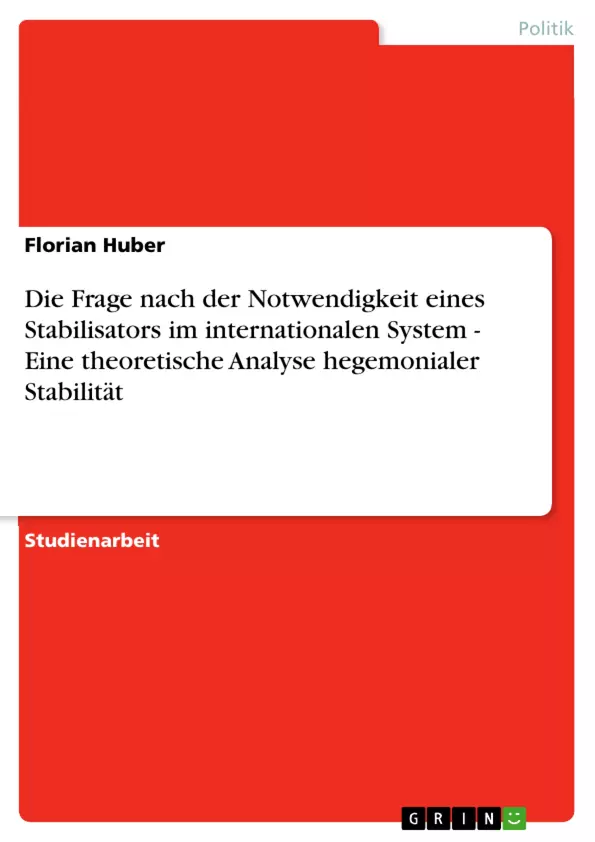„Hegemonic periods are those in which power and competitive advantage are relatively concentrated in a single hegemonic state.”
Christopher Chase-Dunn (in Balaam, 2005)
Auf diese Art beschreibt Christopher Chase-Dunn kurz hegemoniale Zyklen und deren Anführer, den Hegemon. Nun stellt sich die Frage: Brauchen wir überhaupt einen Hegemon im internationalen System? Der Theorie nach ist dieser die Stütze des Systems. Aber kann sich die Stabilität nicht auch anderes halten?
Diese hegemonialen Stabilität ist das Hauptthema der vorliegenden Arbeit. Hegemonie und Hegemoniezyklen sollen hier näher betrachtet werden. Als Beispiel wird die Rolle der USA und deren Traditionslinien und außenpolitischen Grundmuster erläutert werden. Die Arbeit wird sich aber weder mit der Frage nach der Zukunft der USA in dieser Rolle, noch mit deren kompletter Außenpolitik befassen. Die Hegemonie und vor allem die Frage ob ein Weltsystem noch einen Stabilisator benötigt, sind die hier verfolgten Kernpunkte.
Im internationalen System soll hier von einem „Weltsystem“ ausgegangen werden. Daher dient als Grundlage und zur Definition dieses Begriffes der Ansatz von Immanuel Wallerstein. Es soll dargestellt werden, ob und wenn ja welcher Zusammenhang zwischen Hegemonie und Krieg besteht und ob die These, dass ein Hegemon nur durch Kriege abgelöst werden kann, heute noch immer gilt. Auch unter Berücksichtigung der Globalisierung und wachsenden Konflikten durch den internationalen Terrorismus ein stabilisierendes Element wie der Hegemon noch notwendig ist.
Da dieser aber auch in anderen Theorien bzw. Theorieansätzen der Internationalen Beziehungen enthalten ist, werden auch deren Inhalte teilweise zur Sprache kommen um die Arbeit zu ergänzen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischen Vorklärungen
- Historische Erfahrungen
- Beispiel: Wallersteins Theorie des modernen Weltsystems
- Theorie des Zyklus der Hegemonie
- Beispiel des Hegemoniezyklen nach Christopher Chase-Dunn
- Stabilität im hegemonialen System
- Hegemonie
- Hegemoniale Stabilität
- Forschungsdesign
- Hegemonie und Krieg
- Das Vorhandensein eines Hegemon
- Beispiel: Die Rolle der Vereinten Nationen im Weltsystem
- Ergebnisse der theoretischen Analysen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Bedeutung eines Hegemon für die Stabilität des internationalen Systems. Im Fokus stehen Hegemonie und Hegemoniezyklen, wobei die USA als Beispiel dienen, um die Traditionslinien und außenpolitischen Grundmuster des Hegemon zu verdeutlichen. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, ob das internationale System einen Stabilisator benötigt und welche Rolle der Hegemon in diesem Zusammenhang spielt.
- Die Rolle des Hegemon im internationalen System
- Die Theorie der Hegemoniezyklen
- Die USA als Beispiel für einen Hegemon
- Die Bedeutung von Hegemonie für die Stabilität des internationalen Systems
- Die Frage, ob das internationale System einen Stabilisator benötigt
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt das Thema der Arbeit ein und stellt die Frage nach der Notwendigkeit eines Hegemon im internationalen System. Kapitel 2 bietet eine theoretische Grundlage mit einer historischen Betrachtung von Hegemonialzyklen sowie einer ausführlichen Darstellung der Theorien von Immanuel Wallerstein und Christopher Chase-Dunn. Kapitel 3 erläutert das Forschungsdesign der Arbeit, das sich auf die Analyse des Zusammenhangs zwischen Hegemonie und Krieg sowie auf die Rolle der Vereinten Nationen im Weltsystem konzentriert. Schließlich werden in Kapitel 4 die Ergebnisse der theoretischen Analysen vorgestellt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Schlüsselbegriffe Hegemonie, Hegemoniezyklen, Stabilität, internationales System, Weltsystem, USA, Krieg, Vereinte Nationen und Globalisierung.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter hegemonialer Stabilität?
Hegemoniale Stabilität bezeichnet die Theorie, dass das internationale System einen Anführer oder Stabilisator (Hegemon) benötigt, um Ordnung und Sicherheit zu gewährleisten.
Welche Rolle spielen die USA in dieser Analyse?
Die USA dienen als primäres Beispiel für einen Hegemon, wobei ihre Traditionslinien und außenpolitischen Grundmuster untersucht werden.
Welche theoretischen Grundlagen werden herangezogen?
Die Arbeit stützt sich auf Immanuel Wallersteins Weltsystem-Ansatz und Christopher Chase-Dunns Theorie der Hegemoniezyklen.
Besteht ein Zusammenhang zwischen Hegemonie und Krieg?
Ja, die Arbeit untersucht, ob ein Zusammenhang zwischen der Machtkonzentration eines Hegemons und dem Auftreten von Kriegen besteht und ob Ablösungen nur gewaltsam erfolgen.
Wird die Rolle der Vereinten Nationen thematisiert?
Ja, die Vereinten Nationen werden als Beispiel für das Vorhandensein oder die Notwendigkeit von Stabilisatoren im Weltsystem analysiert.
Welchen Einfluss hat der internationale Terrorismus auf die Theorie?
Es wird diskutiert, ob unter Berücksichtigung von Globalisierung und Terrorismus ein stabilisierendes Element wie ein Hegemon heute noch notwendig ist.
- Arbeit zitieren
- Florian Huber (Autor:in), 2006, Die Frage nach der Notwendigkeit eines Stabilisators im internationalen System - Eine theoretische Analyse hegemonialer Stabilität, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/59020