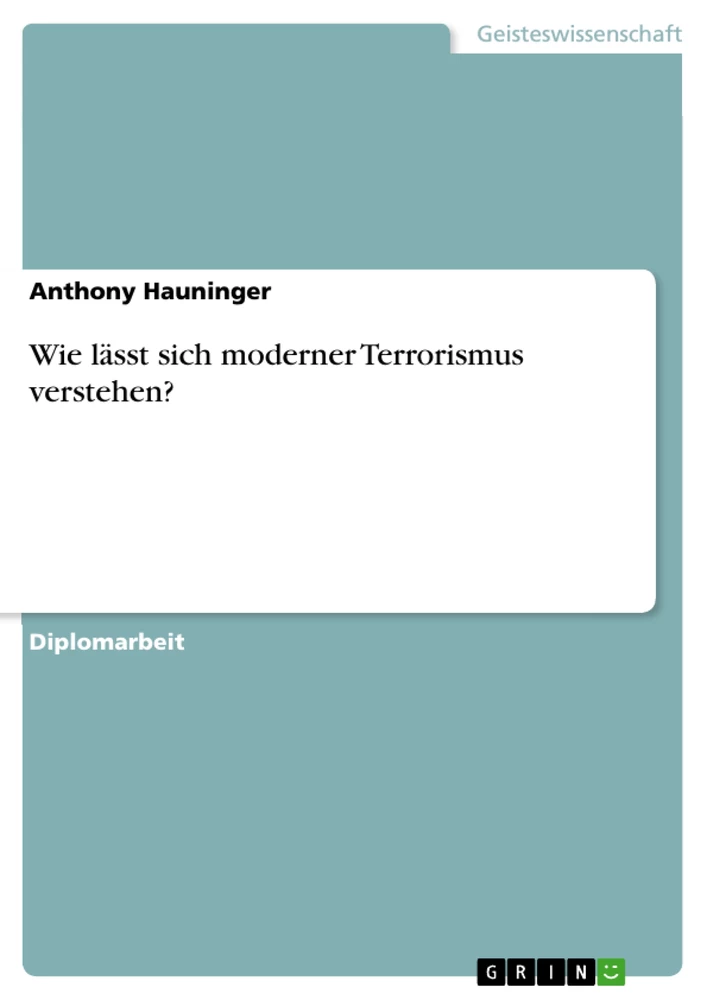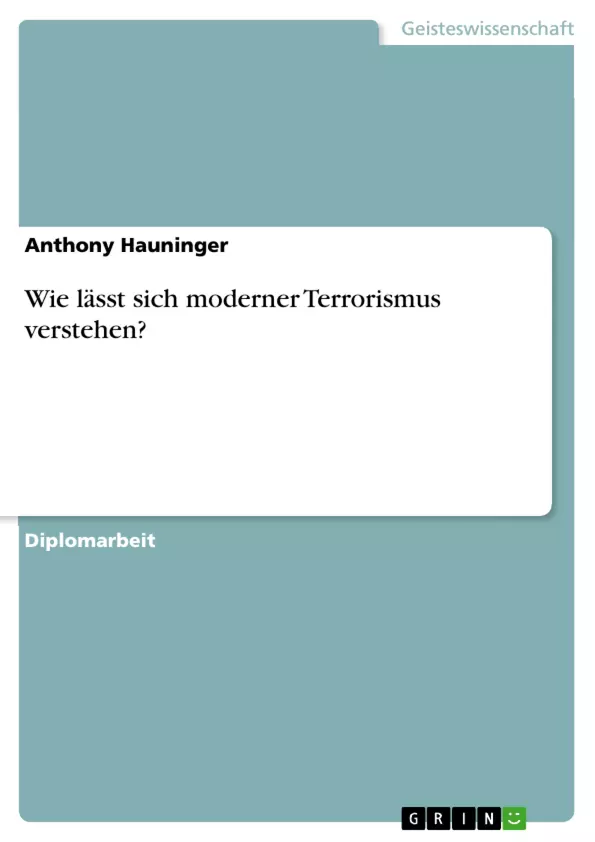Konflikte [entstehen ...] aus Kommunikationsstörungen, aus Missverständnis und Unverständnis, Unaufrichtigkeit und Irreführung. Die Spirale der Gewalt beginnt mit einer Spirale der gestörten Kommunikation, die über die Spirale des unbeherrschten reziproken Misstrauens zum Abbruch der Kommunikation führt.
(J. Habermas mit J. Derrida, Philosophie in Zeiten des Terrors, S. 61) Wie der Titel des Buches, aus dem obiges Zitat stammt, nahe legt, leben wir in einer Zeit des Terrors, oder besser gesagt einer Zeit des Terrorismus (auf die Unterscheidung der beiden Begriffe komme ich noch zu sprechen). Der Terrorismus istdasGespenst, das derzeit auf unserem Globus sein Unwesen treibt,dasDamoklesschwert, das jederzeit fallen und jeden treffen kann. Terrorismus ist aber auch ein politisches und soziales Phänomen, das nicht nur mit Gewalt sondern auch mit Kommunikation zusammenhängt, und wie jedes politische oder soziale Phänomen verdient er deswegen philosophische Beachtung. Tatsächlich haben sich zahlreiche und namhafte Philosophen in der Vergangenheit und vor allem in der Gegenwart mit dem Terrorismus auseinandergesetzt, wie z.B. Hegel, Marx, Habermas, Derrida, Hare, Walzer, u.a., auf deren Standpunkte ich in dieser Arbeit zum Teil auch eingehen werde.
Ich habe den Terrorismus aber nicht nur deshalb zum Thema meiner Diplomarbeit gewählt, weil er an sich schon philosophisch interessant ist, sondern weil ich ihm auch persönlich ein großes wissenschaftliches Interesse entgegenbringe. Zum einen ist es ein Thema, wie es, traurigerweise, aktueller nicht sein könnte, zum anderen ist es auch ein äußerst facettenreiches Thema, da es die verschiedensten Gebiete wie Geschichte, Recht, Soziologie, Psychologie, Politik- und Militärwissenschaften und nicht zuletzt die Philosophie abdeckt. Auch die Ähnlichkeit mit einem ebenso schwer verständlichen Phänomen, dem Krieg, macht den Terrorismus für mich wissenschaftlich reizvoll. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Aufgabenstellung und Herangehensweise
- Was ist (moderner) Terrorismus?
- Grundlegendes
- Terrorismus als schwer zu definierender Begriff
- Ursachen für die Definitionsproblematik
- Negative Konnotation auf emotionaler und sachlicher Ebene
- Verwendung als politischer „Etikettierungsbegriff“
- Unpräzise Verwendung in den Medien
- Historischer Bedeutungswandel von Terrorismus
- Geschichtliche Vorläufer
- Ab der Französischen Revolution bis zum Ende des 19. Jahrhunderts
- 20. Jahrhundert
- Die Geburt des modernen Terrorismus
- Eingrenzung des Terrorismusbegriffs
- Unterscheidung von ähnlichen Formen politisch-militärischer Gewalt
- Guerilla
- Partisanenkampf
- Konventionelle Kriegsführung
- Terrorismus als Strategie des Terrorkrieges
- Merkmale und Grundtendenzen des modernen Terrorismus
- Terrorismus und Rationalität
- Motive und Ziele des modernen Terrorismus
- Sozialrevolutionärer Terrorismus
- Ethnisch-nationalistischer Terrorismus
- Religiöser Terrorismus
- Das terroristische Kalkül
- Funktioniert Terrorismus?
- Terrorismus und Moral
- Die Frage nach der Moral aus Sicht von Terroristen
- Die Theorie des gerechten Krieges als vermeintlicher Legitimationsansatz
- Walzers Standpunkt
- Zusammenfassung und Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit befasst sich mit der Frage, wie sich moderner Terrorismus verstehen lässt. Sie untersucht den Begriff des Terrorismus, seine historische Entwicklung und die Ursachen für seine heutige Erscheinungsform. Die Arbeit beleuchtet außerdem die Motive und Ziele des modernen Terrorismus sowie die Frage, ob Terrorismus als rationale Strategie betrachtet werden kann. Darüber hinaus werden die moralischen Implikationen von Terrorismus aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet.
- Definition und Abgrenzung des Terrorismusbegriffs
- Historische Entwicklung des Terrorismus
- Motive und Ziele des modernen Terrorismus
- Rationalität und Moral im Kontext von Terrorismus
- Philosophische Perspektiven auf Terrorismus
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema Terrorismus ein und verdeutlicht dessen aktuelle Relevanz. Sie beleuchtet den Zusammenhang zwischen Terrorismus und Kommunikation, sowie die Bedeutung des Terrorismus für die Philosophie.
Das zweite Kapitel setzt sich mit der Definition und Abgrenzung des Terrorismusbegriffs auseinander. Es analysiert die Schwierigkeiten bei der Definition von Terrorismus und geht auf die Ursachen für die Definitionsproblematik ein. Dieses Kapitel beleuchtet außerdem die historischen Entwicklung des Terrorismusbegriffs und zeichnet dessen Bedeutungswandel nach.
Das dritte Kapitel untersucht die Motive und Ziele des modernen Terrorismus. Es unterscheidet verschiedene Formen des Terrorismus, wie den sozialrevolutionären, den ethnisch-nationalistischen und den religiösen Terrorismus.
Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit der Frage, ob Terrorismus als rationale Strategie betrachtet werden kann. Es untersucht das terroristische Kalkül und analysiert, ob Terrorismus effektiv ist.
Das fünfte Kapitel befasst sich mit den moralischen Implikationen von Terrorismus. Es analysiert die Frage nach der Moral aus der Sicht von Terroristen und betrachtet verschiedene Ansätze zur Legitimation von Gewalt.
Schlüsselwörter
Moderner Terrorismus, Definitionsproblematik, Historische Entwicklung, Motive und Ziele, Rationalität, Moral, Philosophische Perspektiven, Kommunikation, Gewalt, Krieg, Gerechter Krieg, Habermas, Derrida, Walzer.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Terrorismus so schwer zu definieren?
Die Definitionsproblematik liegt an der starken emotionalen Negativkonnotation, der unpräzisen Verwendung in Medien und seiner Funktion als politischer „Etikettierungsbegriff“.
Was unterscheidet Terrorismus von Guerilla oder Partisanenkampf?
Während Guerillakämpfer oft militärische Ziele angreifen und Territorien kontrollieren wollen, zielt Terrorismus primär auf die psychologische Wirkung durch Gewalt gegen Zivilisten ab.
Welche Motive hat der moderne Terrorismus?
Die Arbeit unterscheidet zwischen sozialrevolutionärem, ethnisch-nationalistischem und religiösem Terrorismus als Hauptströmungen.
Kann Terrorismus als „rational“ betrachtet werden?
Aus Sicht der Täter folgt Terrorismus oft einem strategischen Kalkül, um politische Ziele durch maximale mediale Aufmerksamkeit und Kommunikation durch Gewalt zu erreichen.
Welche Rolle spielt Kommunikation beim Terrorismus?
Nach Habermas entsteht Gewalt oft aus gestörter Kommunikation. Terrorismus nutzt Gewalt als extreme Form der Botschaftsübermittlung an eine Gesellschaft.
- Citation du texte
- Anthony Hauninger (Auteur), 2006, Wie lässt sich moderner Terrorismus verstehen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/59059