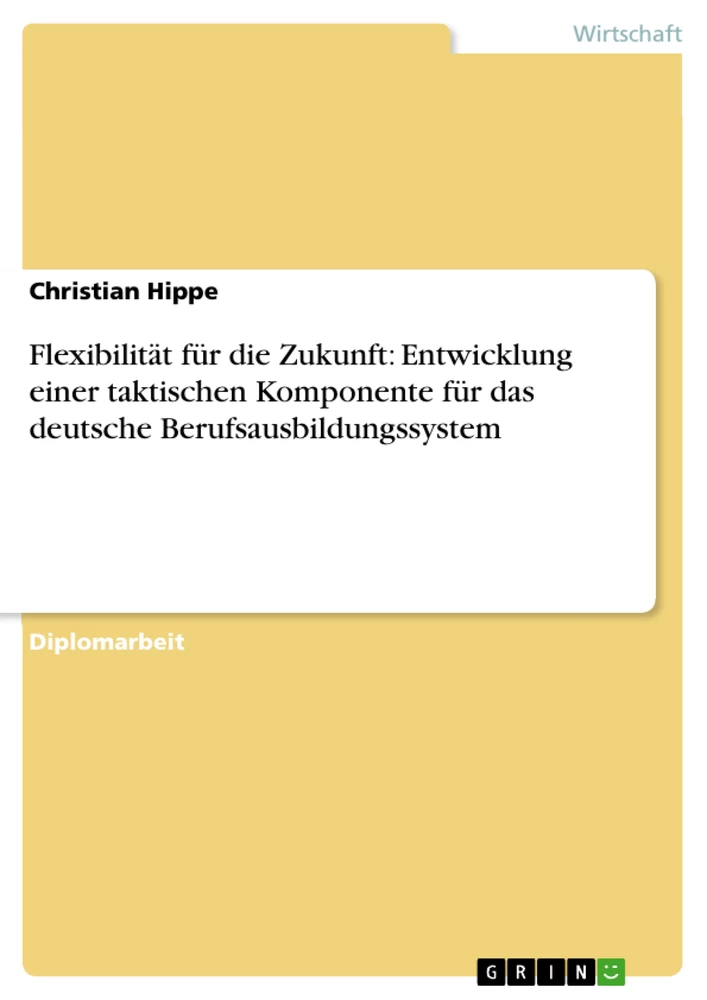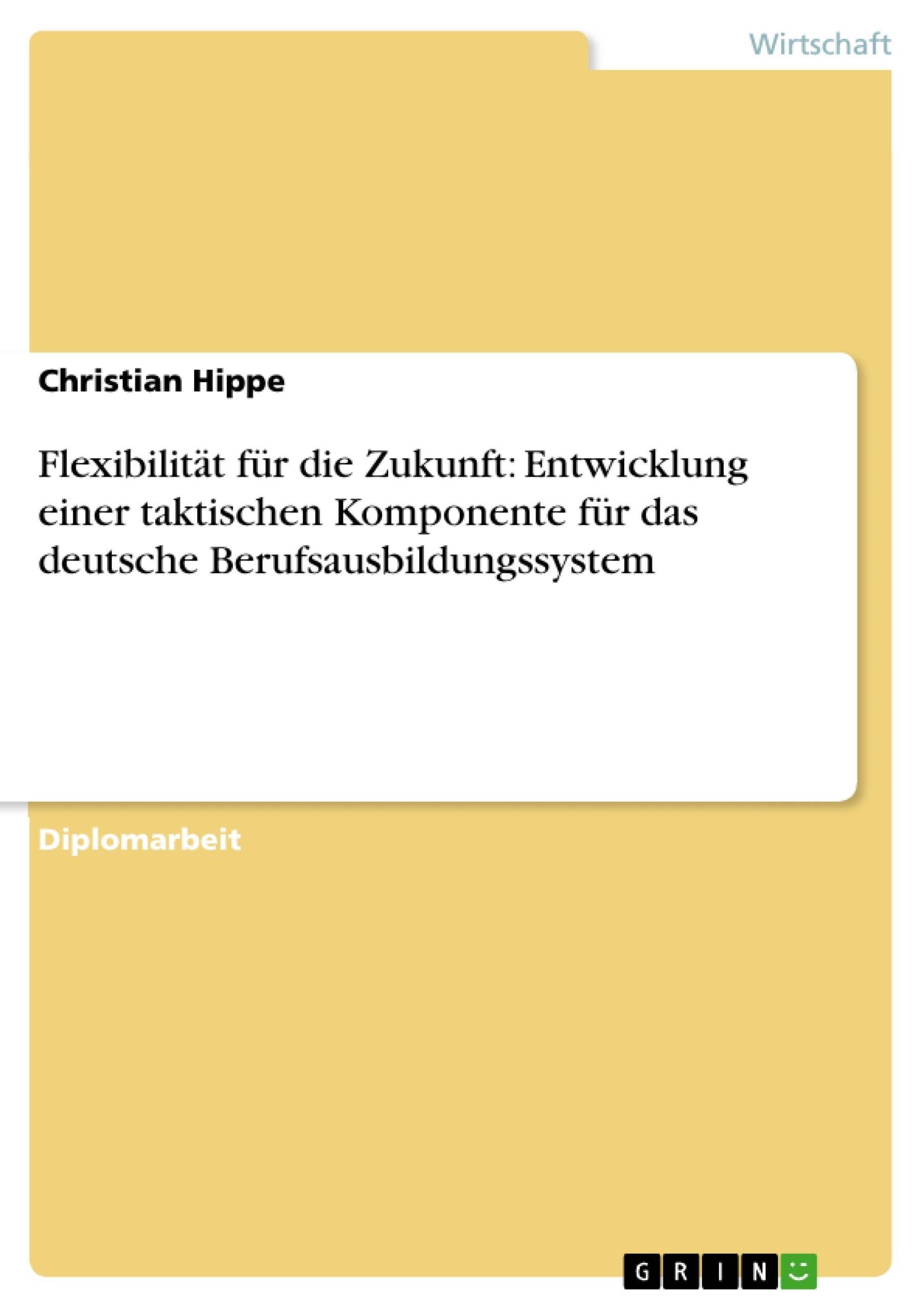„Das duale System der Berufsausbildung lebt vom Engagement der Betriebe.“ Ohne die Bereitschaft der Wirtschaft, junge Menschen auszubilden und sie anschließend zu beschäftigen, kann diese Art der beruflichen Qualifikation nicht existieren. Im Laufe der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts war jedoch ein deutlicher quantitativer Rückgang der betrieblichen Berufsausbildung zu verzeichnen. Nach einer kurzen Erholung in den Jahren von 1997 bis 1999 sank das Angebot an Ausbildungsplätzen bis 2003 erneut kontinuierlich um insgesamt 81.980 Stellen, wobei sich die Nachfrage im gleichen Zeitraum nur um 67.731 verringerte. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung hat in der jüngsten Vergangenheit in verschiedener Weise auf diese Entwicklungen reagiert. So etwa durch Teilnahme an dem auf drei Jahre angelegten Nationalen Pakt für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs in Deutschland im Jahre 2004. Dieser wurde zwischen Staat und Wirtschaft geschlossen und ist Bestandteil einer breit angelegten Ausbildungsoffensive des Ministeriums. Nach einer über vier Jahre andauernden Negativentwicklung konnte aufgrund der Bemühungen aller Bündnispartner in 2004 die Zahl der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge erstmals wieder gesteigert werden. Dabei erhöhte sich das Angebot der Betriebe im Vergleich zum Vorjahr um 13.900 Ausbildungsplätze (+2,8%), während die Nachfrage um 24.907 Bewerber (+4,2%) anstieg. Die im Pakt vereinbarten Ziele werden in der nachfolgend zitierten Verpflichtung zusammengefasst: „Mit diesem Pakt verpflichten sich die Partner gemeinsam und verbindlich, in enger Zusammenarbeit mit den Ländern allen ausbildungswilligen und ausbildungsfähigen jungen Menschen ein Angebot auf
Ausbildung zu unterbreiten. Dabei bleibt die Vermittlung in das duale Ausbildungssystem vorrangig. Auch Jugendliche mit eingeschränkten Vermittlungschancen sollen Perspektiven für den Einstieg in die berufliche Ausbildung und das Berufsleben erhalten.“ Um die vereinbarten Ziele zu erreichen, wurden u. a. konkrete Maßnahmen zur Steigerung der Ausbildungsleistung privater und öffentlicher Arbeitgeber vereinbart. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Situation am Ausbildungsmarkt
- Problemstellung und Zielsetzung
- Vorgehensweise
- Zielkomponenten der deutschen Berufsausbildung
- Vorbereitung auf berufliches Handeln in der Wissensgesellschaft
- Struktureller Wandel des Erwerbslebens
- Berufsausbildung in der Wissensgesellschaft
- Förderung von Wettbewerbsfähigkeit in der globalisierten Wirtschaft
- Folgen der Globalisierung
- Gesamtwirtschaftliche und individuelle Wettbewerbsfähigkeit
- Integration junger Menschen in die Gesellschaft
- Übergang in das Erwerbsleben - das Schwellenmodell
- Jugendarbeitslosigkeit
- Das duale System der Berufsausbildung
- Entwicklung der Berufsausbildung in Deutschland
- Von der mittelalterlichen Handwerksausbildung zum dualen System
- Herausforderungen in Gegenwart und Zukunft
- Wissen Wettbewerb - Integration: Maßstäbe für das duale System
- Wissen - Größtmögliche Gewähr für berufliche Anpassungsfähigkeit
- Wettbewerb - Wege für den beruflichen Aufstieg eröffnen
- Integration - Bestmögliche soziale Sicherheit gewährleisten
- Eine taktische Komponente für die Berufsausbildung
- Beurteilung der taktischen Ausrichtung des dualen Systems
- Mehr Flexibilität durch regionale Zusammenarbeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Entwicklung einer taktischen Komponente für das deutsche Berufsausbildungssystem. Ziel ist es, die Flexibilität des Systems zu stärken, um den Anforderungen des sich wandelnden Arbeitsmarktes gerecht zu werden. Die Arbeit analysiert die Herausforderungen, die sich aus den drei Zielkomponenten der deutschen Berufsausbildung ergeben: der Vorbereitung auf berufliches Handeln in der Wissensgesellschaft, der Förderung von Wettbewerbsfähigkeit in der globalisierten Wirtschaft und der Integration junger Menschen in die Gesellschaft.
- Die Bedeutung von Flexibilität in der Berufsausbildung
- Die Herausforderungen der Wissensgesellschaft und Globalisierung für das duale System
- Die Rolle der regionalen Zusammenarbeit bei der Gestaltung der Berufsausbildung
- Die Bedeutung von Zusatzqualifikationen für die berufliche Entwicklung
- Die Integration junger Menschen in den Arbeitsmarkt
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Einleitung gibt einen Überblick über die aktuelle Situation am Ausbildungsmarkt und beleuchtet die Problematik des sinkenden Angebots an Ausbildungsplätzen. Es werden die Zielsetzung und die Vorgehensweise der Arbeit erläutert.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel analysiert die drei Zielkomponenten der deutschen Berufsausbildung: Vorbereitung auf berufliches Handeln in der Wissensgesellschaft, Förderung von Wettbewerbsfähigkeit in der globalisierten Wirtschaft und Integration junger Menschen in die Gesellschaft. Dabei werden die Herausforderungen beleuchtet, die sich aus dem Wandel des Erwerbslebens, der Globalisierung und den Anforderungen an die soziale Integration ergeben.
- Kapitel 3: Dieses Kapitel behandelt die Entwicklung und die Herausforderungen des dualen Systems der Berufsausbildung in Deutschland. Es werden die zentralen Elemente des Systems, wie Wissen, Wettbewerb und Integration, näher betrachtet und die Frage nach der Anpassungsfähigkeit des dualen Systems an die Anforderungen der Zukunft diskutiert.
- Kapitel 4: Dieses Kapitel befasst sich mit der Entwicklung einer taktischen Komponente für die Berufsausbildung. Es werden verschiedene Ansätze zur Steigerung der Flexibilität des Systems untersucht, wie z.B. die Rolle von Zusatzqualifikationen und die Bedeutung der regionalen Zusammenarbeit.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen und Begriffe der Arbeit sind: Berufsausbildung, duale Ausbildung, Flexibilität, Wissensgesellschaft, Globalisierung, Wettbewerb, Integration, regionale Zusammenarbeit, Zusatzqualifikationen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das duale System der Berufsausbildung?
Ein Ausbildungssystem in Deutschland, das die praktische Ausbildung im Betrieb mit der theoretischen Ausbildung in der Berufsschule kombiniert.
Warum sank das Angebot an Ausbildungsplätzen in den 90ern?
Gründe waren strukturelle wirtschaftliche Veränderungen, ein Rückgang des Engagements einiger Betriebe und der Wandel zur Wissensgesellschaft.
Was ist der „Nationale Pakt für Ausbildung“?
Ein 2004 geschlossenes Bündnis zwischen Staat und Wirtschaft, um jedem ausbildungswilligen Jugendlichen ein Angebot zu unterbreiten.
Wie kann die Flexibilität im Ausbildungssystem gesteigert werden?
Durch eine taktische Komponente, die regionale Zusammenarbeit fördert und verstärkt auf Zusatzqualifikationen setzt, um auf Marktveränderungen zu reagieren.
Welche Ziele verfolgt die deutsche Berufsausbildung?
Vorbereitung auf die Wissensgesellschaft, Förderung der Wettbewerbsfähigkeit und die soziale Integration junger Menschen.
- Citation du texte
- Christian Hippe (Auteur), 2005, Flexibilität für die Zukunft: Entwicklung einer taktischen Komponente für das deutsche Berufsausbildungssystem, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/59264