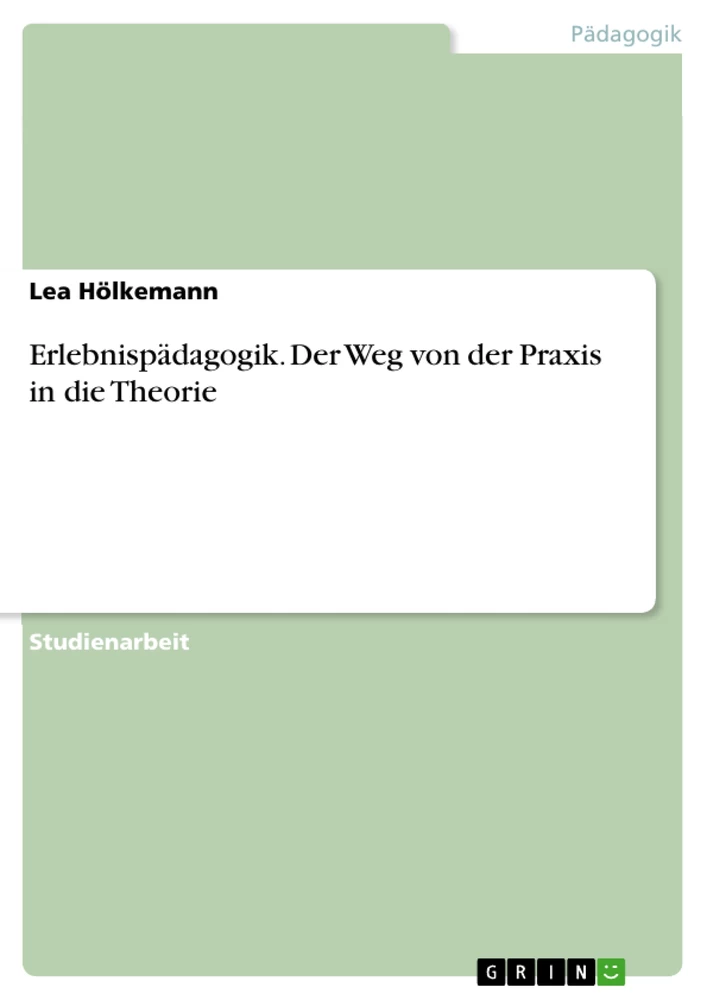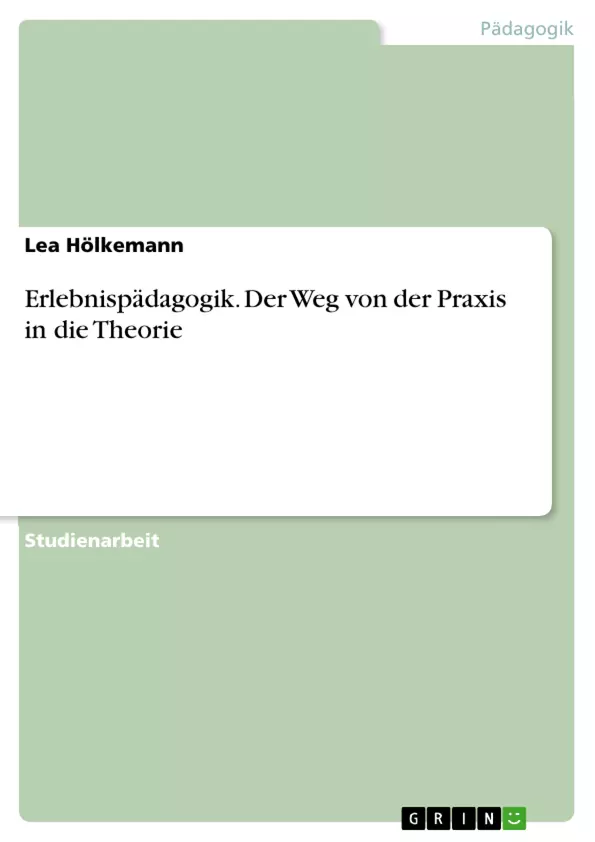Das Internet mit seinen vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten hat einen zunehmenden Einfluss im Alltag der Jugendlichen. Nach der JIM-Studie aus dem Jahr 2018 nutzen 91% der Jugendlichen täglich das Internet, 94% der Jugendlichen nutzen täglich ihr Smartphone und 65% aller Jugendlichen schauen täglich Online-Videos. Laut der KIM-Studie aus dem Jahr 2018 besitzen circa die Hälfte aller Kinder zwischen 6 und 13 Jahren ein Handy.
Im Gegensatz zu den Medien fördert gerade die Natur durch ihre reizvolle Umgebung das Explorationsverhalten von Kindern und regt ihre psychische Entwicklung an. In der Erlebnispädagogik werden Lernprozesse durch das Umfeld und durch Risikogefühle ausgelöst. Daher ist diese mittlerweile eine etablierte Methode in der Jugendarbeit, der Heimerziehung, der beruflichen Bildung und in der Arbeit mit behinderten Menschen. Nachdem Erlebnispädagogik in der Praxis erprobt wurde, sind wesentliche Theorien aufgestellt worden.
In dieser Arbeit wird untersucht, wie die Erlebnispädagogik entstanden ist und was bei der Umsetzung von Erlebnispädagogik unter der Leitung eines Erlebnispädagogen zu beachten ist.
Zu Beginn der Arbeit wird der Begriff Erlebnispädagogik definiert. Daraufhin werden die Ursprünge der Erlebnispädagogik anhand der beiden Vordenker und Philosophen Jean-Jacques Rousseau und Henry David Thoreau und dem Gründer Kurt Hahn erklärt. Außerdem wird das von Kurt Hahn erarbeitete Konzept für eine erlebnispädagogisch geprägte Internatserziehung vorgestellt. In der Umsetzung von Erlebnispädagogik trägt vor allem die Gruppe und die Erlebnisreflexion eine wichtige Rolle. Des Weiteren werden wesentliche Handlungsfelder erlebnispädagogischer Aktivitäten vorgestellt. Für das Verständnis der Wirkung von Erlebnispädagogik wird im letzten Teil ein wesentliches Lernmodell mit dem Namen Flow-Erlebnis vorgestellt. Im Fazit werden die Arbeitsergebnisse zusammengefasst.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition und Begriffserklärung
- Die Anfänge von Erlebnispädagogik
- Die Vordenker: Rousseau und Thoreau
- Der Gründer: Kurt Hahn
- Erlebnispädagogik in der Praxis
- Rolle der Gruppe
- Rolle der Reflexion
- Handlungsfelder
- Lernmodelle
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Entstehung und den wichtigsten Aspekten der Erlebnispädagogik. Sie untersucht die historischen Wurzeln und den theoretischen Hintergrund dieser pädagogischen Methode und beleuchtet die Praxisanwendung in verschiedenen Bereichen.
- Definition und Begriffserklärung der Erlebnispädagogik
- Historische Entwicklung der Erlebnispädagogik mit Fokus auf Rousseau, Thoreau und Kurt Hahn
- Wichtige Elemente der Praxisanwendung: Rolle der Gruppe, Reflexion, Handlungsfelder
- Erläuterung von Lernmodellen im Kontext der Erlebnispädagogik
- Zusammenfassung der Kernaussagen und Erkenntnisse
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas Erlebnispädagogik im Kontext der heutigen Mediennutzung von Jugendlichen dar. Sie beleuchtet die Bedeutung der Natur für die kindliche Entwicklung und die Etablierung der Erlebnispädagogik in verschiedenen Arbeitsfeldern. Die Arbeit wird strukturiert und die wichtigsten Themengebiete werden vorgestellt.
Definition und Begriffserklärung
In diesem Kapitel wird der Begriff der Erlebnispädagogik definiert und die „E-Kette“ als Prozessmodell vorgestellt. Die Bedeutung der Reflexion für den nachhaltigen Lernerfolg wird hervorgehoben, und die Definition der Erlebnispädagogik nach Werner Michl wird zitiert. Es werden auch die charakteristischen Eigenschaften der Erlebnispädagogik im Vergleich zur Abenteuerpädagogik herausgearbeitet.
Die Anfänge der Erlebnispädagogik
Die Vordenker: Rousseau und Thoreau
Dieses Kapitel beleuchtet die Beiträge von Jean-Jacques Rousseau und Henry David Thoreau zur Entwicklung der Erlebnispädagogik. Es wird die Philosophie Rousseaus in seinem Werk „Émile, ou de l'éducation" und der Einfluss der Natur auf seine pädagogischen Ideen erläutert. Ebenso wird das Leben und Werk von Thoreau sowie seine Verbindung von Politik und Pädagogik im Kontext seiner naturbezogenen Lebensweise dargestellt.
Der Gründer: Kurt Hahn
Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit Kurt Hahn als dem offiziellen Gründer der Erlebnispädagogik. Es wird sein Konzept für eine erlebnispädagogisch geprägte Internatserziehung vorgestellt.
Erlebnispädagogik in der Praxis
Rolle der Gruppe
Hier wird die Bedeutung der Gruppe in der Erlebnispädagogik beleuchtet und deren Rolle im Lernprozess und der Persönlichkeitsentwicklung der Teilnehmer.
Rolle der Reflexion
Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit der Reflexion als wichtiges Element der Erlebnispädagogik und deren Bedeutung für die Verarbeitung der erlebten Erfahrungen.
Handlungsfelder
Dieses Kapitel stellt verschiedene Anwendungsbereiche und Handlungsfelder der Erlebnispädagogik vor.
Lernmodelle
Der Abschnitt erläutert die Funktionsweise des „Flow-Erlebnisses" als ein relevantes Lernmodell in der Erlebnispädagogik.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Erlebnispädagogik, Abenteuer, Reflexion, Natur, Gruppe, Kurt Hahn, Jean-Jacques Rousseau, Henry David Thoreau, Flow-Erlebnis, Lernen, Persönlichkeitsentwicklung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Grundidee der Erlebnispädagogik?
Erlebnispädagogik ist eine Methode, bei der Lernprozesse durch das Umfeld (oft die Natur) und durch gezielte Risikogefühle ausgelöst werden, um die psychische Entwicklung und das Explorationsverhalten zu fördern.
Wer sind die historischen Vordenker der Erlebnispädagogik?
Wichtige Vordenker sind die Philosophen Jean-Jacques Rousseau und Henry David Thoreau. Als offizieller Gründer gilt Kurt Hahn, der Konzepte für die Internatserziehung entwickelte.
Welche Rolle spielt die Reflexion in diesem Prozess?
Die Reflexion ist ein zentrales Element, um die erlebten Erfahrungen zu verarbeiten und einen nachhaltigen Lernerfolg zu sichern. Ohne Reflexion bleibt das Erlebnis oft ohne pädagogische Wirkung.
Was wird unter dem „Flow-Erlebnis“ verstanden?
Das Flow-Erlebnis ist ein Lernmodell, das einen Zustand beschreibt, in dem eine Person völlig in einer Tätigkeit aufgeht, was besonders lernwirksam ist.
In welchen Bereichen wird Erlebnispädagogik heute eingesetzt?
Sie ist eine etablierte Methode in der Jugendarbeit, der Heimerziehung, der beruflichen Bildung sowie in der Arbeit mit Menschen mit Behinderungen.
Was unterscheidet Erlebnispädagogik von Abenteuerpädagogik?
Die Arbeit arbeitet charakteristische Unterschiede heraus, wobei die Erlebnispädagogik stärker auf den pädagogischen Prozess und die gezielte Reflexion fokussiert.
- Quote paper
- Lea Hölkemann (Author), 2019, Erlebnispädagogik. Der Weg von der Praxis in die Theorie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/593750