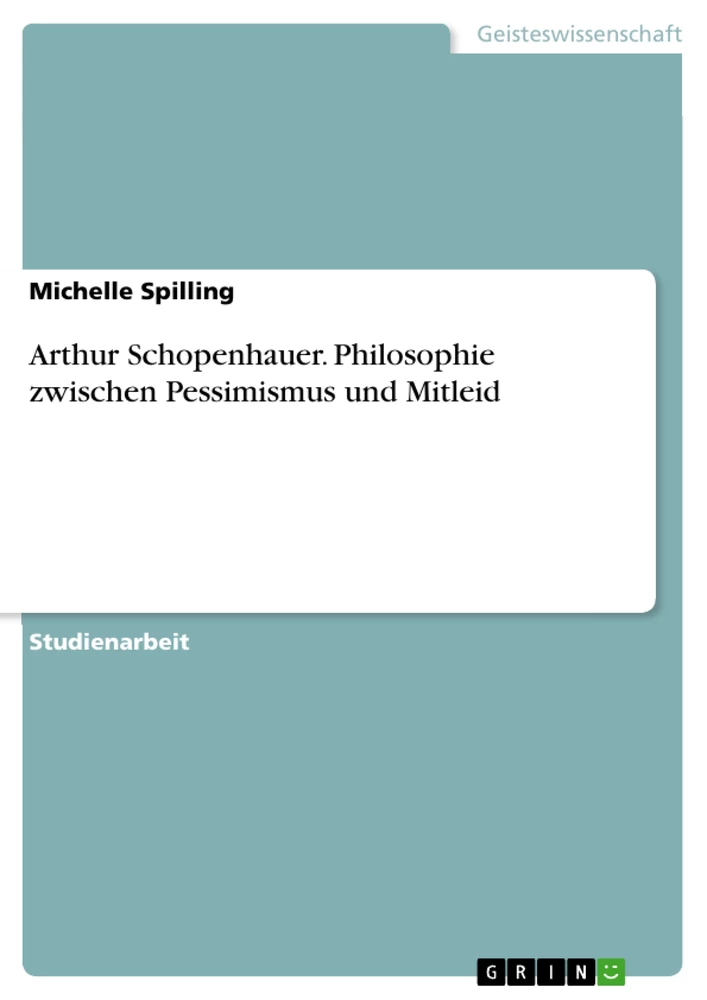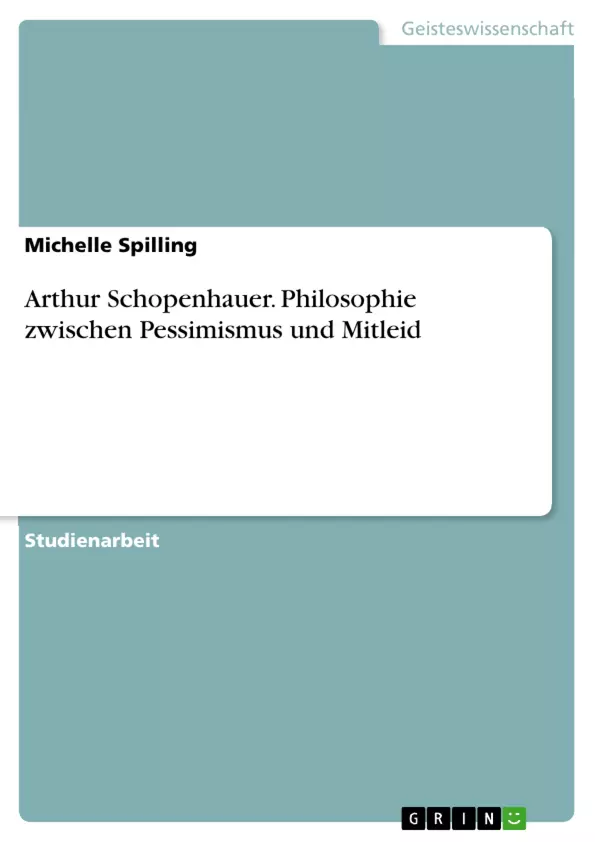Will man die Begriffe „Philosoph“ und „Pessimismus“ in ein und denselben Satz einbringen, kommt man nicht ohnehin, sich auf den deutschen Philosophen Arthur Schopenhauer zu beziehen. Er war kein Optimist, wie die meisten seiner Zeit, und sicherte sich somit seinen Platz als Gegen-den-Strom-Schwimmer. Schopenhauer erkennt die Welt als einen Ort der Qualen, des Schreckens und der Furcht und stützt auf dieses allumfassende Leiden das Grundgerüst seiner Mitleidsethik. Schopenhauers Mitleidsethik trägt diesen Namen, weil das Mitleiden mit einem anderen Individuum in seiner Ethik und die dazugehörige Moral die ausschlaggebenden Rollen markieren.
Doch warum sieht er gerade darin das Fundament der Moral? Warum spielt für Schopenhauer ausgerechnet Mitleid eine Rolle in einer Welt voller Egoismus und Boshaftigkeit? Und ist wirklich nur Handeln aus Mitleid moralisch wertvoll?
Mit diesen Fragen setze ich mich in groben Zügen in dieser Hausarbeit auseinander und werde dabei verschiedene Teilgebiete seiner Philosophie beleuchten. Zu Beginn der Arbeit wird das Thema der Metaphysik Schopenhauers angerissen, um auf die grundlegenden Aspekte seiner Weltanschauung einzugehen, die bei Betrachtung seiner Mitleidsethik von essenzieller Bedeutung sind. Dabei werden unter anderem Dieter Birnbachers "Schopenhauer" und Michael Hauskellers "Vom Jammer des Lebens. Einführung in Schopenhauers Ethik" ausgewertet. Weiterführend werfen wir einen Blick auf das Mitleid, den Kernpunkt seiner Mitleidsethik. Ebenso greifen wir das Thema der drei Triebfedern des moralischen Handelns auf.
Parallelität und Differenz die Kardinaltugenden, die im unmittelbaren Gegensatz zu zwei der drei Triebfedern stehen, betrachtet werden. Da Schopenhauer zu einem der ersten Philosophen gehört, der Tiere ganz konkret in seine Philosophie mit einbezogen hat, wird zum Schluss die Tierethik in Berücksichtigung seiner Mitleidsethik in groben Zügen erläutert, um herauszukristallisieren, inwiefern Tiere in seiner Ethik wirklich mit einbezogen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Schopenhauers Metaphysik
- Die Welt als Vorstellung
- Die Welt als Wille
- Die Welt als Ort des Leidens
- Mitleid als Fundament der Moral
- Was ist Mitleid?
- Mitleidsethik
- Die drei Triebfedern moralischen Handelns
- Die Kardinaltugenden
- Schopenhauers Mitleidsethik am Beispiel der Tierethik
- Was ist Tierethik?
- Schopenhauer als Förderer der Tierethik
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Philosophie Arthur Schopenhauers, insbesondere mit seiner Mitleidsethik. Sie analysiert seine Metaphysik, um die grundlegenden Aspekte seiner Weltanschauung zu beleuchten, die für das Verständnis seiner Ethik unerlässlich sind. Darüber hinaus wird untersucht, wie Schopenhauer das Mitleid als Fundament der Moral betrachtet und welche Rolle es in einer von Egoismus und Boshaftigkeit geprägten Welt spielt. Die Arbeit beleuchtet auch die drei Triebfedern moralischen Handelns und analysiert die Kardinaltugenden im Kontext der Mitleidsethik. Abschließend wird die Tierethik aus der Perspektive Schopenhauers betrachtet, um herauszufinden, inwiefern Tiere in seiner Ethik tatsächlich Berücksichtigung finden.
- Schopenhauers Metaphysik und seine Weltanschauung
- Mitleid als zentrale Komponente der Moral
- Die drei Triebfedern moralischen Handelns
- Die Kardinaltugenden in Schopenhauers Ethik
- Schopenhauers Tierethik im Kontext seiner Mitleidsethik
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt Arthur Schopenhauer als einen herausragenden Vertreter des Pessimismus in der Philosophie vor. Sie betont seine Sichtweise auf die Welt als einen Ort voller Leiden und erklärt, wie dieses Leid das Fundament seiner Mitleidsethik bildet. Die Einleitung stellt außerdem die zentralen Fragen der Arbeit vor, die im Laufe der Analyse beantwortet werden sollen.
Schopenhauers Metaphysik
Die Welt als Vorstellung
Dieses Kapitel beleuchtet Schopenhauers Theorie der Welt als Vorstellung, die auf Kants Metaphysik basiert. Es wird erläutert, dass wir die Welt nicht so sehen können, wie sie wirklich ist, sondern nur so, wie sie uns aufgrund unserer Erkenntniswerkzeuge erscheint. Der Unterschied zwischen dem erkennenden Subjekt und dem Objekt wird betont und die Rolle der individuellen Erfahrungen bei der Gestaltung unserer Wahrnehmung wird diskutiert.
Die Welt als Wille
Dieses Kapitel wird voraussichtlich Schopenhauers Konzept des Willens als der treibenden Kraft hinter der Welt erörtern. Es wird wahrscheinlich die Beziehung zwischen Vorstellung und Wille erkunden und erklären, wie der Wille die Welt durch ständige Bedürfnisse und Begierden antreibt. Der Fokus wird wahrscheinlich auf den menschlichen Willen liegen und darauf, wie dieser zu Leiden und Unzufriedenheit führt.
Die Welt als Ort des Leidens
Dieses Kapitel wird wahrscheinlich die These Schopenhauers erläutern, dass die Welt ein Ort des Leidens ist. Es wird die verschiedenen Formen des Leidens untersuchen, wie z. B. körperliches Leiden, psychisches Leiden und das Leiden durch die Enttäuschung unerfüllter Wünsche. Das Kapitel wird wahrscheinlich auch den Ursprung des Leidens in der Natur des Willens erörtern.
Mitleid als Fundament der Moral
Was ist Mitleid?
Dieses Kapitel wird voraussichtlich die Natur des Mitleids definieren und untersuchen, wie es sich von anderen Emotionen unterscheidet. Es wird wahrscheinlich die psychologischen und physiologischen Aspekte des Mitleids erörtern und die Rolle der Empathie und des Mitgefühls hervorheben.
Mitleidsethik
Dieses Kapitel wird voraussichtlich Schopenhauers Theorie der Mitleidsethik präsentieren. Es wird wahrscheinlich argumentieren, dass das Mitleid die Grundlage für moralisches Handeln ist und dass nur Handlungen aus Mitleid wirklich moralisch wertvoll sind. Das Kapitel wird wahrscheinlich auch die Bedeutung des Mitleids für die Überwindung des Egoismus und die Förderung eines Gefühls der Solidarität zwischen den Menschen erörtern.
Die drei Triebfedern moralischen Handelns
Dieses Kapitel wird voraussichtlich Schopenhauers Analyse der drei Triebfedern moralischen Handelns präsentieren: den egoistischen Trieb, den Hang zur Gerechtigkeit und den Trieb zur Nächstenliebe. Es wird wahrscheinlich die jeweiligen Eigenschaften und Auswirkungen dieser Triebe untersuchen und herausarbeiten, warum nur die Nächstenliebe, die auf Mitleid basiert, als wahrhaft moralisch gilt.
Die Kardinaltugenden
Dieses Kapitel wird voraussichtlich Schopenhauers Sicht auf die Kardinaltugenden erörtern, die im Gegensatz zu zwei der drei Triebfedern moralischen Handelns stehen. Es wird wahrscheinlich die Rolle der Kardinaltugenden in der Mitleidsethik untersuchen und ihre Verbindung zu Schopenhauers Philosophie des Leidens und der Verneinung des Willens erörtern.
Schopenhauers Mitleidsethik am Beispiel der Tierethik
Was ist Tierethik?
Dieses Kapitel wird voraussichtlich die grundlegenden Konzepte der Tierethik einführen und verschiedene Perspektiven auf die Frage nach dem moralischen Status von Tieren beleuchten. Es wird wahrscheinlich auch den historischen Kontext der Tierethik und die Entwicklung des Tierschutzes beleuchten.
Schopenhauer als Förderer der Tierethik
Dieses Kapitel wird voraussichtlich Schopenhauers Sicht auf die Tierethik erörtern und analysieren, wie seine Mitleidsethik die Behandlung von Tieren beeinflusst. Es wird wahrscheinlich herausarbeiten, inwiefern Schopenhauer Tiere in seine philosophischen Überlegungen einbezogen hat und welche Rolle er für die Entwicklung des Tierschutzes spielte.
Schlüsselwörter
Arthur Schopenhauer, Mitleidsethik, Pessimismus, Metaphysik, Wille, Vorstellung, Leiden, Moral, Gerechtigkeit, Nächstenliebe, Kardinaltugenden, Tierethik, Tierschutz.
Häufig gestellte Fragen
Warum gilt Schopenhauer als Philosoph des Pessimismus?
Er betrachtet die Welt als einen Ort des Leidens, der Qual und des Schreckens, angetrieben durch einen blinden, unersättlichen Willen.
Was ist der Kern von Schopenhauers Mitleidsethik?
Schopenhauer sieht im Mitleid das einzige Fundament wahrer Moral, da es den Egoismus überwindet und die Identifikation mit dem Leiden anderer ermöglicht.
Was versteht Schopenhauer unter der "Welt als Wille und Vorstellung"?
Die Welt erscheint uns als Vorstellung (Wahrnehmung), ihr wahres inneres Wesen ist jedoch der Wille, eine irrationale Urkraft.
Welche Rolle spielen Tiere in Schopenhauers Philosophie?
Schopenhauer war einer der ersten Philosophen, der Tiere explizit in seine Ethik einbezog, da sie ebenso wie Menschen leidensfähige Wesen mit einem Willen sind.
Welche drei Triebfedern des menschlichen Handelns nennt er?
Er unterscheidet zwischen Egoismus (eigenes Wohl), Bosheit (fremdes Wehe) und Mitleid (fremdes Wohl), wobei nur letzteres moralischen Wert besitzt.
- Quote paper
- Michelle Spilling (Author), 2020, Arthur Schopenhauer. Philosophie zwischen Pessimismus und Mitleid, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/595382