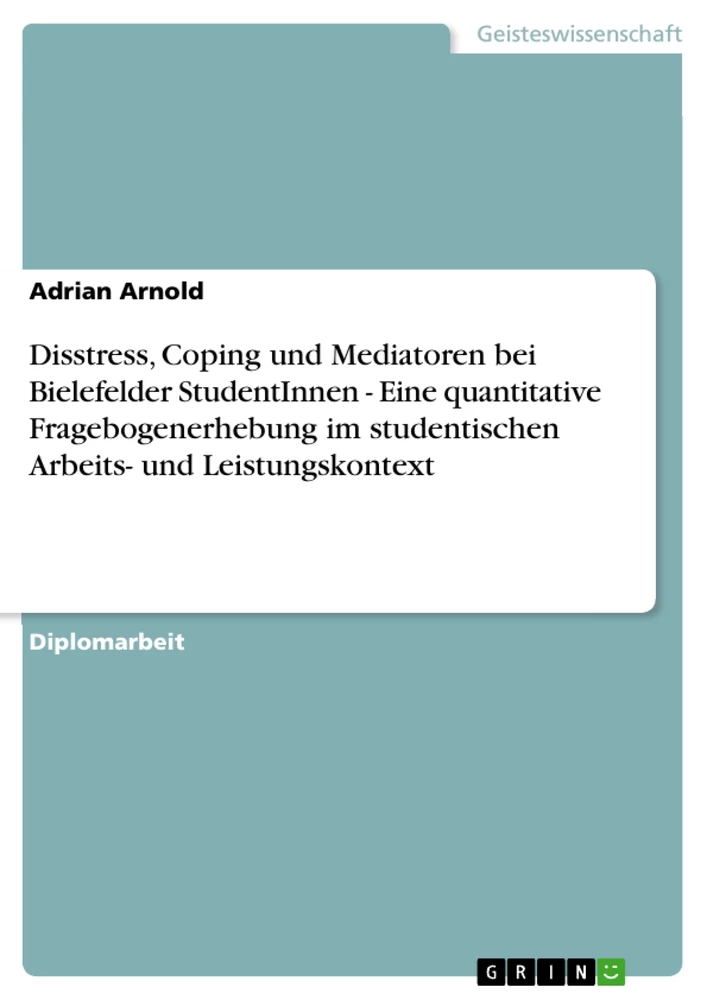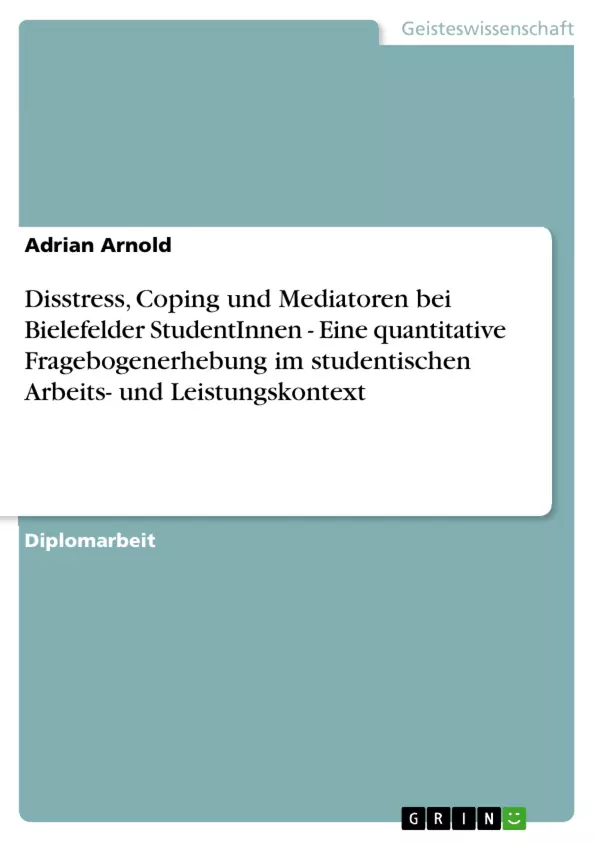Problemrelevanz der stark validen (Stichprobe N=171 Befragte) und eindeutig reliablen empir. standardisierte Fragebogen-Studie: Reaktionen auf starken Dauerstress können in ihrer Defensivität nicht nur für Arbeitsprozesse, sondern auch für Studienbiografien und Studenten/innen enorm problematisch werden. Die psychosozialen Beratung z.B. in universitären Institutionen sind dann ebenfalls von misslungenem Coping betroffen, z.B. bei verzögerten Studienzeiten, Belastungen (u.a. Depressionen) und Studienwechsel bis hin zu Studienabbruch.
Ähnlich wie Arbeitsstrukturen regelmäßig Disstress erzeugen und dadurch eine Bewältigungsaktivität mittels Ressourcenmobilisierung (engl. Coping) erzwingen, zeigen sich im Alltag von StudentInnen auch sog. Interaktionsprozesse mit Stresskontexten – allerdings in spezifischen universitären Settings mit Arbeitsszielen und organisatorischen Anforderungen. Diese sozialpsychologisch-soziologische Arbeit kann mittels der Fragebogenmethode Stressbelastung, Reaktionen und Bewältigungsressourcen kausal analysieren und damit offene empir. Forschungslücken abdecken helfen. Dabei werden nicht nur grundlegende Theorieansätze der internationalen Coping- und Disstressforschung dargelegt, sondern auch der Netzwerktheorie als wichtige Basis für soziale Integration als Vermittler- und Pufferressource. Die teilw. hochsignifikanten Ergebnisse zeigen nicht nur deskriptiv u.a. Stärke des Stressempfindens. Sondern weit darüber hinaus auch Kausalitäten, die als Kontexte solche Stressbelastungen und Responses der Akteure verursachen. Solche Faktoren für u.a. Stressoren und für defensive/ offensive Bewältigungen waren insb. Selbstwirksamkeitseinstellungen, Integration in Netzwerke (z.B. Formen des social support seeking) und soziodemographische Merkmale (Geschlecht, Bildungshintergrund, Alter u.a.). So konnte u.a. bewiesen werden, dass weder Geschlecht, Finanznotlage, Supportmobilisierung oder Netzwerkdichte und –quantität ernsthaft nennenswerte Einflüsse auf die empfundene Stresshöhe zeigten. Aber dass z.B. eine hohe, positive Einstellung bezüglich der eigenen Leistungskompetenz (self efficacy) erkennbar Stress verringert. Die sinnvollen Bewältigungsreaktionen bzgl. Belastungen (und deren Ursachen) wurden sehr gering von Hochschulerfahrung oder Stressorenhöhe gefördert. Aber umgekehrt wurden defensive Bewältigungen (z.B. Studienabbruch) leicht durch niedrige Kompetenzeinschätzung und mittelstark durch Studienstress des Semesters verursacht. [...]
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Grundlegender theoretischer Rahmen: (Dis-)Stress, Coping und Mediatoren
- II. 1) Einführung: Stressbelastung
- II. 1 a) Hintergrund: Inanspruchnahme der Studienberatung
- II. 1 b) Die Stressoren im Arbeits- und Leistungskontext
- II. 1 c) Was ist Stress?
- II. 1 d) Was sind Mediatoren?
- II. 2) Mediatoren: Die Coping-Ressourcen „Netzwerk-Integration”, „soziodemographische Merkmale“ und „Dispositionen“
- II. 2 a) Externe Ressourcen: Netzwerk als Integrations- und Supportquelle
- II. 2 b) Ressourcen soziodemographischer Merkmale „Geschlecht, Alter, sozioökonomischer Status“
- II. 2 c) Interne Ressourcen: forschungsrelevante Dispositionen
- II. 3) Coping-Responses: Adaption im Stresskontext
- II. 3 a) Was ist Coping?
- II. 3 b) Formen und Merkmale von Coping
- II. 3 c) Coping-Dimensionen dieser empirischen Arbeit
- II. 3 d) Coping und Kontrollkognition im Transaktionsmodell (Lazarus)
- II. 3 e) Diagramm: Coping-Zyklus und Kontrollkognitionen
- II. 4) Das Forschungsprogramm dieser Arbeit
- III. Die quantitative Fragebogenerhebung
- III. 1) Empirisch-methodische Problemfelder der Fragebogenkonstruktion
- III. 2) Mögliche Verzerrungen in Erhebung und Messung
- III. 2 a) Forschungsinterne Verzerrungen: Artefakte
- III. 2 b) Erhebungsexterne Verzerrungen
- III. 3) Kontrollstrategien möglicher Verzerrungen
- III. 4) Empirische Grundlagen der Erhebung
- III. 4 a) Der Pretest
- III. 4 b) Stichprobencharakteristik und Quellen der Erhebung
- IV. Auswertung und Interpretation der Daten
- IV. 1) Deskriptive Ergebnisse
- IV. 1 a) Belastungen bei allen 19 Stressoren
- IV. 1 b) Die TOP-6-Stressoren
- IV. 1 c) Allgemeine Reaktionen - Formen und Stufen defensiven Copings
- IV. 2) Multiple Coping als alltagspsychologische Realität: Top-6-Stressoren
- IV. 2 a) Einfach- und Zweifach-Coping
- IV. 2 b) Coping-Arrays: ein Defensiv-Offensiv-Index
- IV. 3) Induktive Ergebnisse: Interkorrelationen zentraler Variablen
- IV. 3 a) Ursachen von Stressbelastung: Disstress als Zielvariable
- IV. 3 b) Stress-Effekte auf Coping und Defensivreaktionen: Disstress als Ursachenvariable
- IV. 3 c) Ursachen für Offensives Coping (D-O-Indices) und Defensivreaktionen
- IV. 3 d) I-E-Kontrollsicht im Kausalkontext von Disstress und D-O-Coping
- V. Zusammenfassung und Reflexion
- V. 1) Ergebnisse der Erhebung
- V. 1 a) Konklusionen und Hypothesenprüfung
- V. 1 b) Zusammenfassung: Moderator-Effekte und Belastungsursachen
- V. 2) Empirische Aussagekraft: Reliabilität und Validität
- V. 2 a) Messpräzision des External-Internal-Komplexes
- V. 2 b) Hinweise auf die Reliabilität zentraler Zieldimensionen
- VI. Kritische Reflexion und Ausblicke
- VI. 1) Verschiedene Problemstellungen dieser Arbeit
- VI. 2) Forschungsperspektiven
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht Stressbelastungen bei Bielefelder Studierenden im Arbeits- und Leistungskontext mittels einer quantitativen Fragebogenerhebung. Ziel ist es, die Zusammenhänge zwischen Stressoren, Coping-Strategien und moderierenden Variablen zu analysieren.
- Identifikation von Stressoren im studentischen Alltag
- Analyse von Coping-Mechanismen zur Bewältigung von Stress
- Untersuchung des Einflusses soziodemografischer Merkmale und Dispositionen auf Stresserleben und Coping
- Bewertung der empirischen Methode und der Ergebnisse
- Ableitung von Forschungsperspektiven
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Diese Einleitung führt in das Thema der Diplomarbeit ein und skizziert den Forschungsstand sowie die Zielsetzung der Studie. Sie beschreibt die Relevanz der Untersuchung von Stress bei Studierenden und benennt die Forschungsfragen, die im weiteren Verlauf beantwortet werden sollen. Die Einleitung liefert den Rahmen für die gesamte Arbeit und stellt die methodische Herangehensweise kurz vor.
II. Grundlegender theoretischer Rahmen: (Dis-)Stress, Coping und Mediatoren: Dieses Kapitel legt den theoretischen Grundstein der Arbeit. Es definiert den Begriff Stress und beleuchtet verschiedene Stressoren im Kontext des Studiums. Ausführlich werden verschiedene Coping-Strategien und deren Einfluss auf das Stresserleben vorgestellt und eingeordnet. Der Fokus liegt auf der Erläuterung von Mediatoren, welche die Beziehung zwischen Stressoren und Coping beeinflussen. Es werden relevante Theorien, wie das Demand-Control-Modell, und die Rolle von Kontrollattribution, Selbstwirksamkeit und sozialer Unterstützung detailliert erklärt. Dieses Kapitel bildet das theoretische Fundament für die empirische Untersuchung.
III. Die quantitative Fragebogenerhebung: Dieses Kapitel beschreibt die empirische Methode der Arbeit. Es erläutert die Konstruktion des Fragebogens, inklusive der Auswahl der Items und Skalen. Die methodischen Herausforderungen bei der Konstruktion und Durchführung einer quantitativen Befragung werden offen angesprochen. Die möglichen Verzerrungen bei der Datenerhebung und -messung werden kritisch betrachtet und geeignete Kontrollstrategien erläutert. Zudem wird die Stichprobe detailliert beschrieben und deren Charakteristika werden diskutiert. Die Durchführung des Pretests und dessen Ergebnisse werden vorgestellt.
IV. Auswertung und Interpretation der Daten: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der durchgeführten quantitativen Datenanalyse. Es beginnt mit der deskriptiven Auswertung, welche die Verteilung der Stressoren und Coping-Strategien innerhalb der Stichprobe beschreibt. Spezifische Stressoren werden identifiziert und analysiert, und Geschlechterunterschiede werden untersucht. Anschließend werden die Ergebnisse der multiplen Regressionen und Korrelationsanalysen vorgestellt, um die Zusammenhänge zwischen Stressoren, Coping und den moderierenden Variablen aufzuzeigen. Die Interpretation der Daten konzentriert sich auf die Zusammenhänge zwischen den identifizierten Variablen und deren Bedeutung im Kontext der untersuchten Thematik. Graphische Darstellungen visualisieren die Ergebnisse.
Schlüsselwörter
Stress, Coping, Mediatoren, Studierende, Bielefeld, quantitative Forschung, Fragebogen, Stressoren, soziodemografische Merkmale, Kontrollattribution, Selbstwirksamkeit, Netzwerk, Defensivcoping, Offensivcoping, Hochschulklima, Arbeitsbelastung, Leistungsdruck
Häufig gestellte Fragen zur Diplomarbeit: Stressbelastung bei Studierenden in Bielefeld
Was ist das Thema der Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht Stressbelastungen bei Studierenden in Bielefeld im Arbeits- und Leistungskontext mittels einer quantitativen Fragebogenerhebung. Ziel ist die Analyse der Zusammenhänge zwischen Stressoren, Coping-Strategien und moderierenden Variablen.
Welche Stressoren werden untersucht?
Die Arbeit identifiziert verschiedene Stressoren im studentischen Alltag. Die Analyse konzentriert sich auf die Top-6-Stressoren, die in der Befragung am häufigsten genannt wurden. Die Ergebnisse zeigen die Verteilung der Belastungen bei allen 19 untersuchten Stressoren.
Welche Coping-Strategien werden betrachtet?
Die Studie analysiert verschiedene Coping-Mechanismen zur Bewältigung von Stress. Es wird zwischen defensivem und offensivem Coping unterschieden und ein Defensiv-Offensiv-Index gebildet. Die Arbeit untersucht sowohl einfaches als auch zweifaches Coping und deren Zusammenhänge mit den Stressoren.
Welche moderierenden Variablen spielen eine Rolle?
Die Arbeit untersucht den Einfluss soziodemografischer Merkmale (Geschlecht, Alter, sozioökonomischer Status) und Dispositionen (Kontrollattribution, Selbstwirksamkeit, soziale Unterstützung) auf das Stresserleben und die gewählten Coping-Strategien. Das Netzwerk der Studierenden wird ebenfalls als relevante Ressource betrachtet.
Welche Methode wurde angewendet?
Es wurde eine quantitative Fragebogenerhebung durchgeführt. Die Arbeit beschreibt ausführlich die Konstruktion des Fragebogens, mögliche methodische Probleme und die getroffenen Kontrollstrategien zur Minimierung von Verzerrungen. Der Pretest und die Charakteristika der Stichprobe werden detailliert dargestellt.
Wie wurden die Daten ausgewertet?
Die Datenanalyse beginnt mit deskriptiven Ergebnissen zur Verteilung der Stressoren und Coping-Strategien. Anschließend werden multiple Regressionen und Korrelationsanalysen durchgeführt, um die Zusammenhänge zwischen Stressoren, Coping und moderierenden Variablen aufzuzeigen. Die Ergebnisse werden graphisch dargestellt und interpretiert.
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Arbeit präsentiert Ergebnisse zur Häufigkeit und zum Zusammenhang verschiedener Stressoren, Coping-Strategien und moderierenden Variablen. Es werden Moderator-Effekte und Belastungsursachen zusammengefasst. Die Ergebnisse ermöglichen Schlussfolgerungen zur Hypothesenprüfung und liefern Hinweise auf die Reliabilität und Validität der verwendeten Messinstrumente.
Welche Limitationen und Ausblicke werden genannt?
Die Arbeit reflektiert kritisch verschiedene Problemstellungen der durchgeführten Studie und benennt Perspektiven für zukünftige Forschung. Die empirische Aussagekraft wird im Hinblick auf Reliabilität und Validität bewertet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Stress, Coping, Mediatoren, Studierende, Bielefeld, quantitative Forschung, Fragebogen, Stressoren, soziodemografische Merkmale, Kontrollattribution, Selbstwirksamkeit, Netzwerk, Defensivcoping, Offensivcoping, Hochschulklima, Arbeitsbelastung, Leistungsdruck.
Wo finde ich den vollständigen Inhaltsverzeichnis?
Das HTML-Dokument enthält ein detailliertes Inhaltsverzeichnis mit allen Kapiteln und Unterkapiteln.
- Arbeit zitieren
- Adrian Arnold (Autor:in), 2005, Disstress, Coping und Mediatoren bei Bielefelder StudentInnen - Eine quantitative Fragebogenerhebung im studentischen Arbeits- und Leistungskontext, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/59800