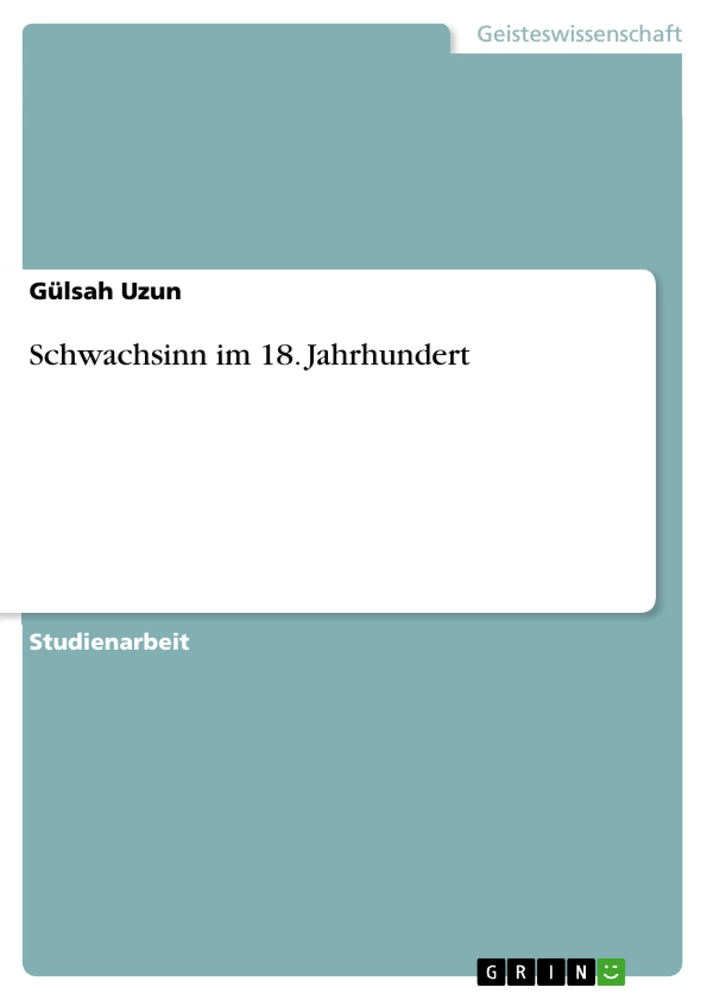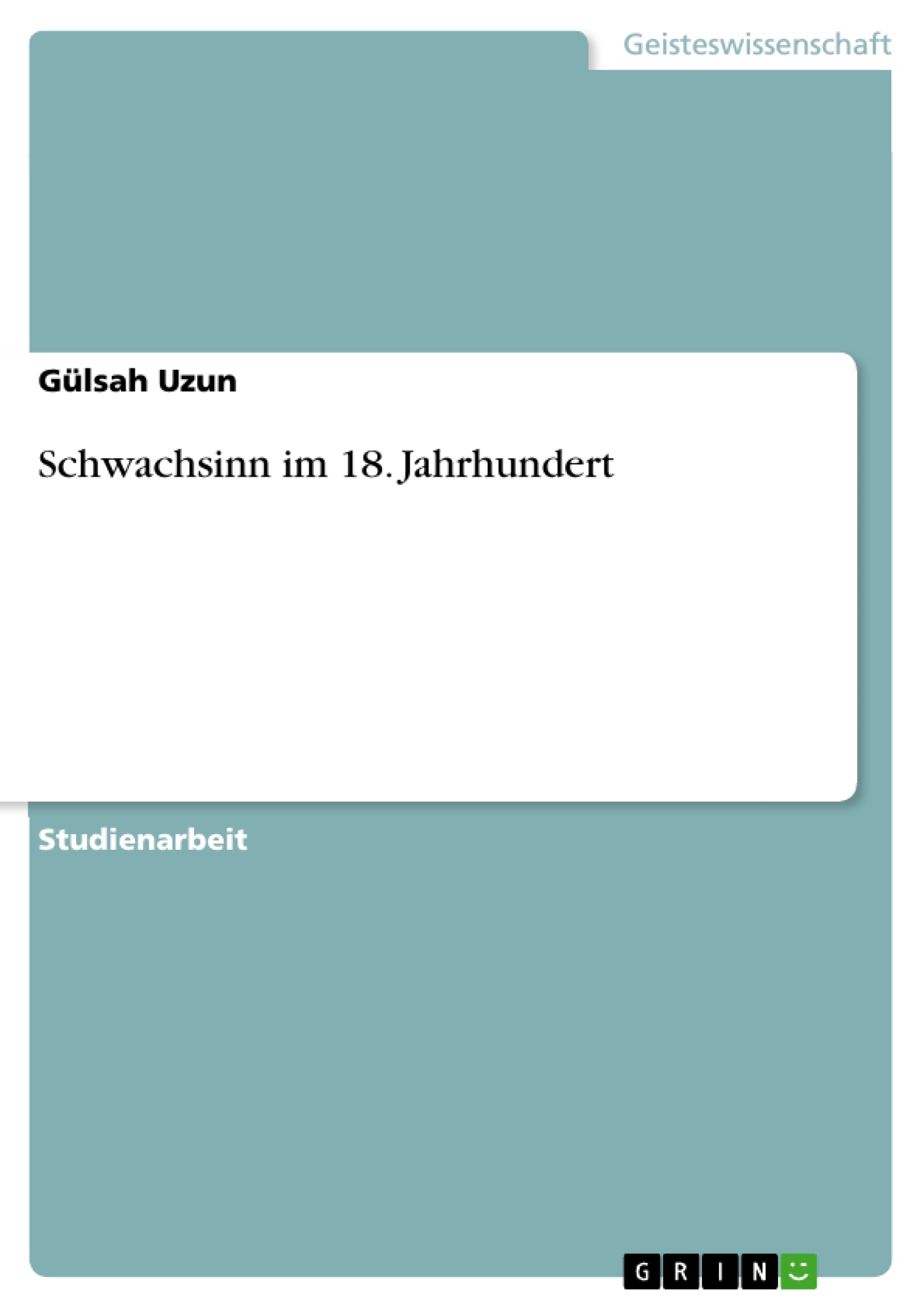Für uns heute im 21. Jahrhundert ist es selbstverständlich, Menschen mit psychischen Problemen nicht gleich als verrückt abzuqualifizieren. Im 20. Jahrhundert haben sich verschiedene psychoanalytische Richtungen etabliert, mit denen versucht wird, psychisch auffälligem, oft auch lebensbedrohlichem Verhalten, auf den Grund zu gehen. Wahnsinn und Irrsinn erscheint uns dabei in erster Linie als Krankheit des Geistes oder als Krankheit der Psyche, wobei auch diese Vorstellungen von psychischer Krankheit hinterfragenswert ist, da Kranksein oft auch ein Abweichen von der Norm, z.B. der sozialen Norm, leistungs- und arbeitsfähig zu sein, bezeichnet. Nicht zuletzt suggeriert auch der Begriff `Krankheit´ eine körperlich-medizinische Funktionalität des Menschen und es wurde auch bei psychischen Krankheiten sehr oft versucht, diese über biologische und physiologische Störungen zu erklären. Verbunden damit ist gerade bei psychoanalytischen Betrachtungen der Versuch, Begründungen für bestimmte Verhaltensweisen zu finden, die oft mit Erfahrungen aus der Kindheit erklärt werden, um diese dann in eine rationalistisch geprägte Erfassung der Welt und des menschlichen Handelns, das gestaltbar und damit auch durch den Menschen veränderbar erscheint, einzuordnen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Situation der Irren im 18. Jahrhundert
- Wahnsinn und die Gesellschaft
- Reform- und Erklärungsversuche
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert den Umgang mit Wahnsinn im 18. Jahrhundert in Deutschland. Sie zeichnet die Entwicklung von einem von Aberglauben geprägten Verständnis hin zu weltlicheren Erklärungsansätzen nach und beleuchtet die gesellschaftliche Rolle von Wahnsinnigen im Kontext der sich verändernden sozialen Ordnung.
- Die Situation der Irren in der ständisch gegliederten Gesellschaft des 18. Jahrhunderts
- Der Einfluss der Aufklärung auf die Sichtweise von Wahnsinn und die Bedeutung des Vernunftprinzips
- Die Herausforderungen, die Geisteskranke für die Gesellschaft darstellten, insbesondere im Kontext der beginnenden Industrialisierung
- Die Entstehung von Arbeits- und Zuchthäusern als Reaktion auf die wachsende Zahl der Irren
- Die Anfänge der Psychiatrie als Wissenschaft im späten 18. Jahrhundert
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung liefert einen kurzen Überblick über die historische Perspektive auf Wahnsinn und die Entwicklung des Verständnisses psychischer Krankheit bis ins 20. Jahrhundert.
- Die Situation der Irren im 18. Jahrhundert: Dieses Kapitel beschreibt die sozioökonomischen Bedingungen in Deutschland im 18. Jahrhundert und untersucht, wie die wachsende Armut und die zunehmende Verelendung der unteren Schichten die gesellschaftliche Wahrnehmung von Wahnsinn beeinflussten.
- Wahnsinn und die Gesellschaft: Dieses Kapitel beleuchtet den Wandel im gesellschaftlichen Umgang mit Wahnsinn im 18. Jahrhundert. Es analysiert, wie das aufklärerische Denken das Verständnis von Vernunft und Irrationalität veränderte und welche Konsequenzen dies für die Behandlung von Geisteskranken hatte.
Schlüsselwörter
Wahnsinn, Irrsinn, Aufklärung, Vernunft, Gesellschaft, Ständegesellschaft, Industrialisierung, Arbeitshäuser, Zuchthäuser, Psychiatrie, Deutschland, 18. Jahrhundert.
- Arbeit zitieren
- Gülsah Uzun (Autor:in), 2000, Schwachsinn im 18. Jahrhundert, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/59866