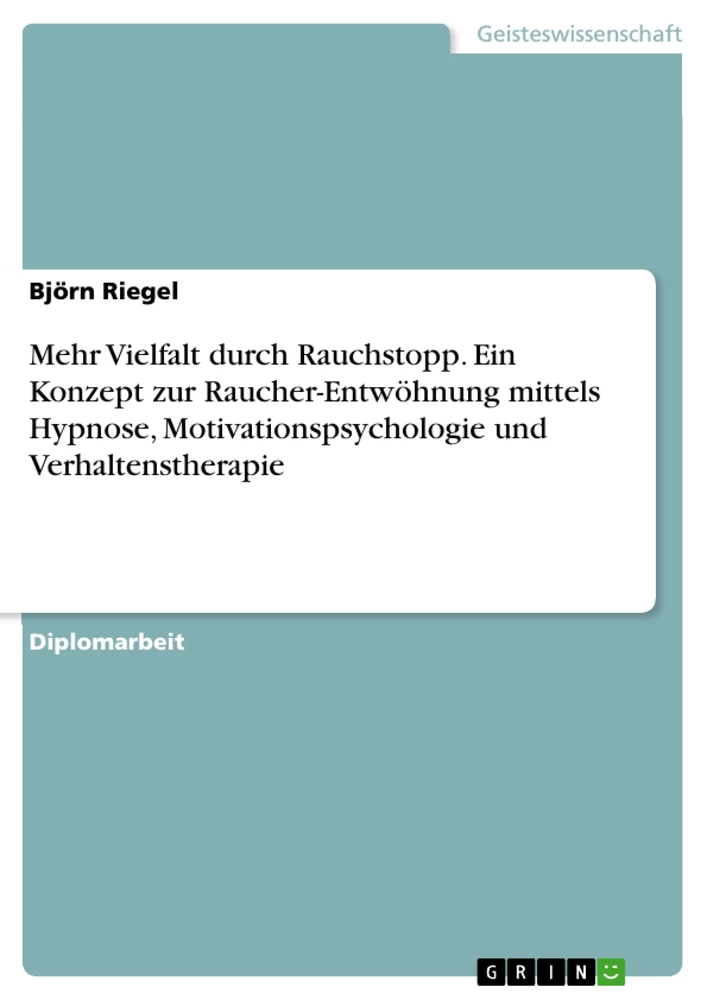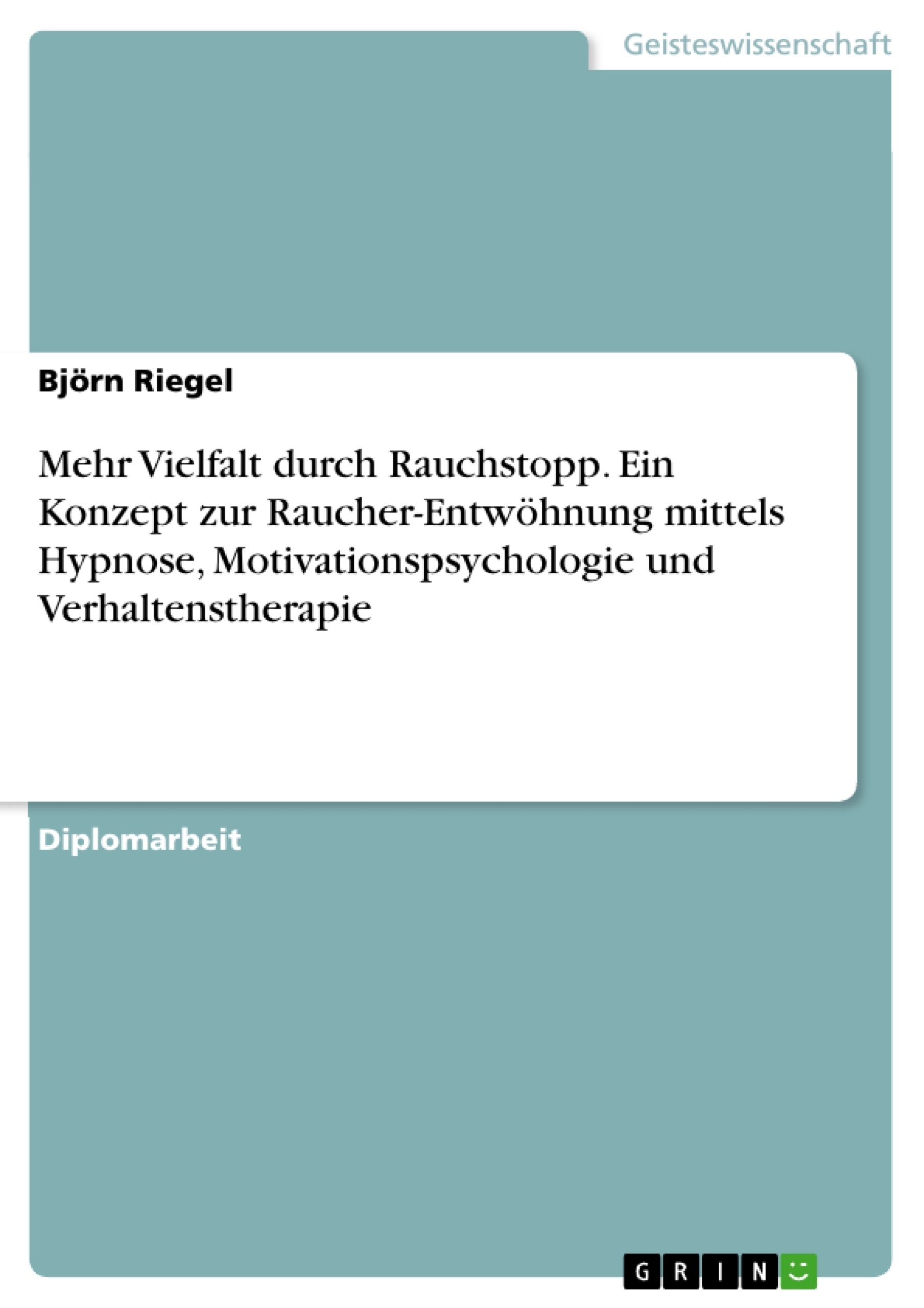„Silvesterabend, kurz vor Mitternacht wird die 'letzte Zigarette' angesteckt … Es währt nicht lange, und alle guten Vorsätze sind über Bord geworfen. … Man ist frustriert, es nicht geschafft zu haben - und raucht schließlich noch etwas mehr als vor dem Versuch… Mit dem Rauchen aufzuhören ist schnell beschlossen, nur schwer in die Tat umzusetzen - solange man nicht weiß, wie.“. Gute Vorsätze scheinen demnach einen schlechten Ruf und wenig Aussicht auf Erfolg zu haben. Dies wird auch durch eine Studie über den beschriebenen Neujahrsvorsatz zum Rauchstopp von Lichtenstein und Cohen (zit. nach Habicht, 2000) empirisch belegt. Laut einer Pressenotiz aus dem Hamburger Abendblatt vom 31.5.2005 rauchen etwa 18 Millionen Menschen in Deutschland, von denen etwa ein Drittel aufhören möchte. Davon schaffen es lediglich 4% ohne fremde Hilfe. Davison und Neale (1998) berichten, dass nicht mehr als 10% der Raucher sogar kurzzeitig erfolgreich sind. Auch Schönberg (2000) zitiert eine Spontan - Remissions - Quote von nicht mehr als 10 - 15%. Bei einer Repräsentativbefragung gaben 30% an, nur zu rauchen, weil sie nicht davon loskommen (Steigert, 1989). All diese Daten zum Rauchverhalten in Deutschland legen nahe, dass eine effektive psychologische Unterstützung der Rauchenden eine nützliche und notwendige Maßnahme ist. Das Konsumverhalten in Deutschland sowie verschiedene Theorien zur Erklärung des Rauchverhaltens werden in Kapitel zwei beschrieben. Kapitel drei beschäftigt sich mit verschiedenen Methoden der Raucherentwöhnung in Deutschland, wobei neben den Ansätzen, die Hypnose nicht explizit nutzen, vor allem einflussreiche hypnotherapeutische Konzepte beschrieben werden. Auffällig ist dabei, dass wenige Methoden dem Anspruch einer empirischen Validierung nachkommen, um sicher zu gehen, dass die Behandlung vor allem langfristig Erfolg verspricht und eine seriöse, schadenfreie Begleitung des Entwöhnungsprozesses garantiert. Die vorliegende Studie hat es sich demnach zur Aufgabe gemacht, ein Konzept zur Raucherentwöhnung zu entwickeln und zu evaluieren, welches eine in Anbetracht der großen Zahl entwöhnungswilliger und -bedürftiger Raucher eine ökonomische Variante der Raucherentwöhnung darstellt. Daher wurde, in einem systemischen Rahmen eingebettet, ein Programm entworfen, welches mit der Hypnotherapie sensu Erickson (vgl. Erickson, Rossi & Rossi 1978; Erickson & Rossi 1981; 2004), als erwiesenermaßen effektiver Methode für Raucherentwöhnung, arbeitet. [...]
Inhaltsverzeichnis
- I. Theorieteil
- 1. Einleitung
- 2. Tabakkonsum und Nikotinabhängigkeit
- 2.1 Konsumverhalten in Deutschland
- 2.2 Inhaltsstoffe einer Zigarette
- 2.3 Gesundheitliche Folgen des andauernden Konsums
- 2.4 Abhängigkeit
- 2.4.1 Kriterien
- 2.4.2 Erklärungsmodelle
- 2.4.2.1 Systemische Theorien
- 2.4.2.2 Lernpsychologische Theorien
- 2.4.2.3 Psychodynamische Theorien
- 2.4.2.4 Physiologische Aspekte
- 3. Methoden der Raucherentwöhnung in Deutschland
- 3.1 Nicht-hypnotische Programme
- 3.1.1 Allen Carr’s „Easyway“
- 3.1.1.1 Carr-Gruppen
- 3.1.1.2 Selbsthilfeliteratur: „Endlich Nichtraucher“
- 3.1.2 Ärztliche Beratungsangebote
- 3.1.2.1 Rauchersprechstunde
- 3.1.2.2 Beratung für Schwangere
- 3.1.3 Verhaltenstherapeutische Programme
- 3.1.4 Selbsthilfe-Literatur
- 3.1.5 Nikotinsubstitution
- 3.2 Hypnose-Programme
- 3.2.1 SmokeX
- 3.2.2 Qualmstopp
- 3.2.3 Das Tübinger Modell
- 3.3 Rückfallverhütung
- 4. Hypnose und Hypnotherapie
- 4.1 Hypnotherapie nach Milton H. Erickson
- 4.2 Der Hypnosystemische Ansatz
- 4.3 Begrifflichkeiten und Prämissen der Therapie
- 4.4 Empirische Belege
- 4.5 Abgrenzung zur „Showhypnose“
- 5. Erfolgsparameter und Hypothesen
- 5.1 Erfolgsparameter
- 5.2 Hypothesen und Fragestellungen
- II. Empirischer Teil
- 6. Entwicklung des Programms „Rauchstopp“
- 6.1 Haltung des „Rauchstopp“-Beraters
- 6.2 Rahmenbedingungen und Ablauf
- 6.3 Hypnotische Interventionen
- 6.3.1 Transparente Interventionen
- 6.3.1.1 Ambivalenzarbeit
- 6.3.1.2 Dehypnotisieren der Eigensuggestionen
- 6.3.1.3 Sicherer Ort
- 6.3.1.4 Ideomotorik und Abschiedsdrehbuch
- 6.3.2 Indirekte Methoden
- 6.3.2.1 „My Friend John Technik“
- 6.3.2.2 Therapeutische und motivierende Geschichten
- 6.3.2.3 Minimax-Interventionen
- 6.4 Selbsthypnose-Training
- 6.5 Entspannungsmethoden
- 6.6 Verhaltenstherapeutische Elemente
- 6.7 Motivationspsychologische Einflüsse
- 6.8 Weitere Elemente
- 7. Methoden
- 7.1 Forschungsdesign
- 7.1.1 Experimentalbedingung
- 7.1.1.1 Gruppenhypnose-Setting
- 7.1.1.2 Einzelhypnose-Setting
- 7.1.2 Vergleichsbedingung
- 7.2 Stichprobe
- 7.2.1 Rekrutierung der Stichprobe
- 7.2.2 Beschreibung der Ausgangsstichprobe
- 7.2.3 Beschreibung der Katamnesestichprobe
- 7.3 Messinstrumente
- 7.3.1 Soziodemographische Daten
- 7.3.2 Fagerströmtest für Nikotinabhängigkeit FTNA
- 7.3.3 Symptomchecklist nach Derogatis SCL-90
- 7.3.4 Creative Imagination Scale CIS
- 7.3.5 Veränderungsfragebogen des Erlebens und Verhaltens VEV
- 7.4 Ablaufschema der Datenerhebung
- 8. Ergebnisse
- 8.1 Datenauswertung
- 8.2 Darstellung der Ergebnisse
- 8.2.1 Haupthypothese 1: Hypnosebehandlung vs. Vergleichsgruppe
- 8.2.1.1 Abstinenzraten zur letzten Sitzung und nach drei Monaten
- 8.2.1.2 Reduktion der Nikotinabhängigkeit zur letzten Sitzung und nach drei Monaten
- 8.2.1.3 Zigarettenkonsum nach der letzten Sitzung und zum Katamnesezeitpunkt
- 8.2.2 Haupthypothese 2: Einzel- vs. Gruppenbehandlung
- 8.2.2.1 Abstinenzraten zu drei Messzeitpunkten
- 8.2.2.2 Reduktion der Nikotinabhängigkeit zu drei Messzeitpunkten
- 8.2.2.3 Reduktion des Konsums zu drei Messzeitpunkten
- 8.2.3 Hypothese 3: Suggestibilität als Moderatorvariable
- 8.2.4 Hypothese 4: Rauchverhalten
- 8.2.5 Hypothese 5: Psychische Belastung
- 8.2.5.1 Psychische Belastung anhand des Globalen Kennwertes GSI
- 8.2.5.2 Differenzierte Betrachtung einzelner Skalen
- 8.2.6 Hypothese 6: Erlebte Veränderung
- 8.2.7 Hypothese 7: Demographische Variablen
- 8.2.7.1 Alter
- 8.2.7.2 Geschlecht
- 8.2.7.3 Partnerschaft
- 8.2.7.4 Schulabschluss
- 8.2.8 Hypothese 8: Motivation
- 8.2.9 Weitere Ergebnisse
- 8.2.9.1 Differenzierte Erfolgsmessung in der Experimentalgruppe
- 8.2.9.2 Zusammenhang zwischen der Abstinenz zu verschiedenen Messzeitpunkten
- 8.2.9.3 Vergleich der Dropout-Teilnehmer mit der Ausgangsstichprobe
- 9. Qualitative Auswertung
- 9.1 Qualitatives Vorgehen
- 9.2 Erste Fragestellung: Motivation
- 9.3 Zweite Fragestellung: Zustandsumschreibung
- 9.4 Dritte Fragestellung: Gründe für den vorzeitigen Programm-Abbruch
- 10. Diskussion und Ausblick
- 10.1 Diskussion der Ergebnisse
- 10.2 Methodenkritik und Ausblick
- Zusammenfassung
- Wirksamkeit hypnotherapeutischer Interventionen bei Raucherentwöhnung
- Vergleich der Wirksamkeit von Einzel- und Gruppentherapien
- Einflussfaktoren wie Suggestibilität, Nikotinabhängigkeit und psychische Belastung auf den Therapieerfolg
- Entwicklung und Nutzung von Ressourcen zur Rückfallprävention
- Qualitative Analyse der Motive und Erfahrungen der Teilnehmer
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit evaluiert ein neu entwickeltes Programm zur Raucherentwöhnung namens „Rauchstopp“, das hypnotische Elemente mit verhaltenstherapeutischen und motivationspsychologischen Ansätzen verbindet. Ziel ist es, die Wirksamkeit dieses Programms im Vergleich zu einer Selbsthilfemethode zu untersuchen und mögliche Einflussfaktoren auf den Erfolg zu identifizieren.
Zusammenfassung der Kapitel
I. Theorieteil: Dieser Teil der Arbeit legt die theoretischen Grundlagen für die Studie. Es werden der Tabakkonsum in Deutschland, die Nikotinabhängigkeit und verschiedene Erklärungsmodelle, sowie etablierte Methoden der Raucherentwöhnung umfassend dargestellt. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf hypnotherapeutischen Ansätzen und deren empirischen Basis. Die Kapitel bauen aufeinander auf und führen schlussendlich zur Entwicklung der Hypothesen der Studie.
II. Empirischer Teil: Hier wird die Entwicklung und Durchführung der Studie beschrieben. Das Programm „Rauchstopp“ wird detailliert vorgestellt, inklusive der verwendeten Methoden, des Ablaufs der Sitzungen und der eingesetzten Messinstrumente. Die Stichprobenbeschreibung und die Datenauswertung sind ebenfalls enthalten. Die Ergebnisse werden in Bezug auf die aufgestellten Hypothesen diskutiert.
6. Entwicklung des Programms „Rauchstopp“: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Konzeption des „Rauchstopp“-Programms, das verschiedene Ansätze der Hypnotherapie, Verhaltenstherapie und Motivationspsychologie kombiniert. Die Rolle des Therapeuten, der Ablauf der Sitzungen, und die verschiedenen Interventionen werden eingehend erläutert. Das Programm wird sowohl für Einzel- als auch für Gruppensitzungen konzipiert.
7. Methoden: Das Kapitel beschreibt das Studiendesign, die Stichprobenrekrutierung und -beschreibung sowie die verwendeten Messinstrumente. Die Methoden werden kritisch diskutiert und die Grenzen des Designs werden aufgezeigt (z.B. fehlende Randomisierung).
Schlüsselwörter
Raucherentwöhnung, Hypnotherapie, Hypnosystemischer Ansatz, Verhaltenstherapie, Motivationspsychologie, Nikotinabhängigkeit, Suggestibilität, Gruppentherapie, Einzeltherapie, Selbsthilfe, Erfolgsparameter, Rückfallprävention, Qualitative Forschung, Empirische Evaluation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Studie: Raucherentwöhnung mit Hypnose
Was ist das Thema der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit evaluiert ein neu entwickeltes Programm zur Raucherentwöhnung namens „Rauchstopp“, das hypnotische Elemente mit verhaltenstherapeutischen und motivationspsychologischen Ansätzen kombiniert. Ziel ist die Untersuchung der Wirksamkeit dieses Programms im Vergleich zu einer Selbsthilfemethode und die Identifizierung möglicher Einflussfaktoren auf den Erfolg.
Welche Inhalte werden im Theorieteil behandelt?
Der Theorieteil behandelt den Tabakkonsum in Deutschland, die Nikotinabhängigkeit und verschiedene Erklärungsmodelle (systemische, lernpsychologische, psychodynamische Theorien und physiologische Aspekte). Er beschreibt etablierte Methoden der Raucherentwöhnung, mit besonderem Fokus auf hypnotherapeutische Ansätze und deren empirische Basis. Die Kapitel führen schlussendlich zur Entwicklung der Hypothesen der Studie.
Welche Methoden der Raucherentwöhnung werden im Theorieteil vorgestellt?
Der Theorieteil beschreibt sowohl nicht-hypnotische Programme (Allen Carr’s „Easyway“, ärztliche Beratungsangebote, verhaltenstherapeutische Programme, Selbsthilfe-Literatur, Nikotinsubstitution) als auch Hypnose-Programme (SmokeX, Qualmstopp, Das Tübinger Modell). Die Rückfallverhütung wird ebenfalls thematisiert.
Was ist der Fokus des empirischen Teils der Arbeit?
Der empirische Teil beschreibt die Entwicklung und Durchführung der Studie. Es wird das Programm „Rauchstopp“ detailliert vorgestellt, inklusive der verwendeten Methoden, des Ablaufs der Sitzungen und der eingesetzten Messinstrumente. Die Stichprobenbeschreibung, die Datenauswertung und die Diskussion der Ergebnisse in Bezug auf die aufgestellten Hypothesen sind ebenfalls enthalten.
Wie ist das Programm „Rauchstopp“ aufgebaut?
Das Programm „Rauchstopp“ kombiniert Hypnotherapie, Verhaltenstherapie und Motivationspsychologie. Es wird detailliert beschrieben, inklusive der Rolle des Therapeuten, des Ablaufs der Sitzungen und der verschiedenen Interventionen (transparente Interventionen wie Ambivalenzarbeit, Dehypnotisieren der Eigensuggestionen, „Sicherer Ort“, Ideomotorik und Abschiedsdrehbuch; indirekte Methoden wie „My Friend John Technik“, therapeutische und motivierende Geschichten, Minimax-Interventionen). Es umfasst auch Selbsthypnose-Training, Entspannungsmethoden und verhaltenstherapeutische Elemente.
Welche Methoden wurden in der Studie verwendet?
Die Studie verwendet ein experimentelles Design mit einer Experimentalbedingung (Gruppen- und Einzelhypnose-Setting) und einer Vergleichsbedingung. Die Stichprobenrekrutierung und -beschreibung sowie die verwendeten Messinstrumente (soziodemographische Daten, Fagerströmtest für Nikotinabhängigkeit FTNA, Symptomchecklist nach Derogatis SCL-90, Creative Imagination Scale CIS, Veränderungsfragebogen des Erlebens und Verhaltens VEV) werden detailliert erläutert. Die Grenzen des Designs (z.B. fehlende Randomisierung) werden aufgezeigt.
Welche Hypothesen wurden untersucht?
Die Studie untersucht mehrere Hypothesen, unter anderem die Wirksamkeit der Hypnosebehandlung im Vergleich zur Vergleichsgruppe, den Vergleich der Wirksamkeit von Einzel- und Gruppentherapien, den Einfluss von Suggestibilität, Nikotinabhängigkeit und psychischer Belastung auf den Therapieerfolg, sowie den Einfluss demografischer Variablen und der Motivation.
Wie wurden die Ergebnisse ausgewertet?
Die Ergebnisse wurden sowohl quantitativ (mittels statistischer Analysen) als auch qualitativ ausgewertet. Die quantitative Auswertung betrachtet Abstinenzraten, Reduktion der Nikotinabhängigkeit und des Zigarettenkonsums zu verschiedenen Messzeitpunkten. Die qualitative Auswertung untersucht die Motivation der Teilnehmer, deren Zustandsumschreibung und die Gründe für vorzeitige Programmabbruche.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Raucherentwöhnung, Hypnotherapie, Hypnosystemischer Ansatz, Verhaltenstherapie, Motivationspsychologie, Nikotinabhängigkeit, Suggestibilität, Gruppentherapie, Einzeltherapie, Selbsthilfe, Erfolgsparameter, Rückfallprävention, Qualitative Forschung, Empirische Evaluation.
- Arbeit zitieren
- Björn Riegel (Autor:in), 2006, Mehr Vielfalt durch Rauchstopp. Ein Konzept zur Raucher-Entwöhnung mittels Hypnose, Motivationspsychologie und Verhaltenstherapie, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/60323