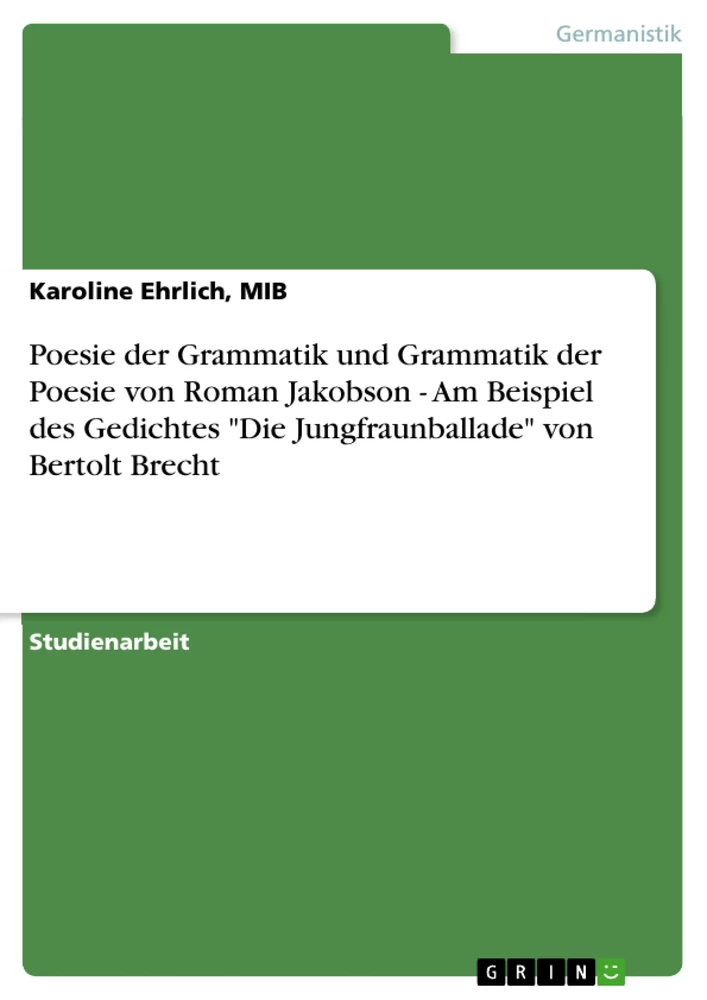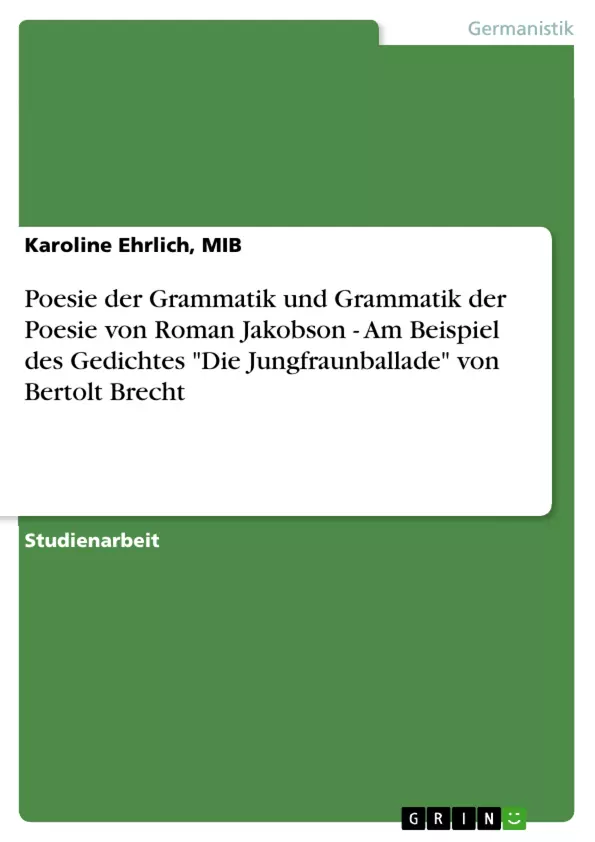Zur Darstellung der Thesen Roman Jakobsons aus dem Aufsatz „Poesie der Grammatik und Grammatik der Poesie“ musste ich einen entsprechenden Text von Bertolt Brecht auswählen, was sich recht schwierig gestaltete, da Brecht eine Vielzahl an Gedichten geschrieben hat, in denen die grammatischen Strukturen im Sinne Jakobsons vorkommen. Allein das Zitat Brechts „Ego, poeta Germanus, super grammaticos“1 (Ich, der deutsche Dichter, stehe über der Grammatik), lässt bereits vermuten, dass ihm die grammatischen Strukturen nicht fremd waren und er sie folglich in seinen Gedichten bewusst und auch reichlich einsetzt. Zur Textauswahl kam noch erschwerend hinzu, dass Jakobson eine klare Begrenzung hinsichtlich der zu untersuchenden Textgröße anführt. Demnach können die Strukturgesetze nur an relativ kurzen Gedichten angewendet werden, da längere poetische Texte von einer anderen strukturalen Organisation beherrscht werden.2 Aus dieser Fülle – und im Rahmen dieser Einschränkung – nun ein einziges Gedicht herauszusuchen, das meinen Vorstellungen entsprach, das heißt, durch das Jakobsons Thesen untermauert werden können und seine Einstellung zu poetischen Gedichten und Grammatik dargestellt werden kann, war nicht ganz einfach. Warum meine Wahl letztlich auf das Gedicht „Die Jungfraunballade“ fiel, versuche ich dann am Anfang des dritten Punktes meiner Arbeit zu verdeutlichen. Nach der Auswahl konnte ich mich dann der Untersuchung des Gedichts auf seine grammatischen Strukturen hin widmen, was somit den größten Teil meiner Arbeit ausmacht. Unter 3.2 wird jeweils eine knappe Zusammenfassung des Aufsatzes „Poesie der Grammatik und Grammatik der Poesie“ vorangestellt, danach werden die Thesen, unter Berücksichtigung der systematischen Untersuchung nach Jakobson, dargelegt. Im Laufe meiner Untersuchung komme ich insofern vom Allgemeinen auf das speziell Jakobson Betreffende. Fremdsprachige Ausdrücke und Zitate aus den jeweiligen Gedichten habe ich in meiner Arbeit kursiv geschrieben, um sie besser hervorzuheben.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Zum Autor
- 3. Arbeit am Gedicht
- 3.1 Zur Auswahl des Gedichtes
- 3.2 Darstellung der Thesen anhand der „Jungfraunballade“
- 3.2.1 Grammatischer Parallelismus
- 3.2.2 Bilderlose Poesie
- 3.2.4 Grammatische Eigenart
- 4. Schluss
- 5. Verwendete Literatur
- 5.1 Primärliteratur
- 5.2 Sekundärliteratur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Roman Jakobsons Thesen zur Interdependenz von Poesie und Grammatik anhand von Bertolt Brechts „Jungfraunballade“. Ziel ist es, Jakobsons Ansatz auf ein konkretes Gedicht anzuwenden und seine Argumentation zu verdeutlichen. Die Analyse konzentriert sich auf die grammatischen Strukturen des Gedichts und deren Bedeutung für die poetische Wirkung.
- Die Beziehung zwischen Poesie und Grammatik nach Jakobson
- Anwendung der linguistischen Analyse auf literarische Texte
- Grammatische Strukturen und ihre Bedeutung in Brechts „Jungfraunballade“
- Der Einfluss grammatischer Parallelismen auf die Poetik
- Analyse der „Bilderlosen Poesie“ im Kontext des Gedichts
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt die Herausforderungen bei der Auswahl eines geeigneten Gedichts von Bertolt Brecht für die Anwendung von Jakobsons Thesen. Die Autorin erklärt die Kriterien für die Auswahl und begründet ihre Entscheidung für die „Jungfraunballade“ aufgrund ihrer kurzen Länge und der reichhaltigen grammatischen Strukturen, die sich gut für Jakobsons Analyse eignen. Der Fokus liegt auf der Verknüpfung von Jakobsons Theorie mit einer konkreten literarischen Analyse.
2. Zum Autor: Dieses Kapitel bietet einen biografischen Überblick über Roman Jakobson, seinen Werdegang und seine Zugehörigkeit zu verschiedenen linguistischen Schulen (Russischer Formalismus und Prager Strukturalismus). Es hebt Jakobsons Beitrag zur Entwicklung einer interdisziplinär anwendbaren Methode der linguistischen Analyse hervor und skizziert seinen Einfluss auf die Literaturwissenschaft.
3. Arbeit am Gedicht: Dieser Abschnitt gliedert sich in die Auswahl des Gedichts und die Darstellung der Thesen anhand der „Jungfraunballade“. Die Auswahl des Gedichts wird detailliert begründet, wobei die Kürze und die grammatischen Besonderheiten der „Jungfraunballade“ als entscheidende Faktoren hervorgehoben werden. Der Hauptteil dieses Kapitels widmet sich der Analyse des Gedichts im Lichte von Jakobsons Thesen, die in drei Unterkapitel (Grammatischer Parallelismus, Bilderlose Poesie, Grammatische Eigenart) gegliedert sind. Die Autorin kündigt an, jeden dieser Aspekte im Detail zu untersuchen.
Schlüsselwörter
Roman Jakobson, Poesie, Grammatik, Bertolt Brecht, Jungfraunballade, Grammatischer Parallelismus, Bilderlose Poesie, Grammatische Eigenart, Linguistische Analyse, Strukturalismus, Russischer Formalismus, Prager Linguistenkreis.
Häufig gestellte Fragen zur Arbeit über Roman Jakobsons Poetik und Bertolt Brechts "Jungfraunballade"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht die Thesen von Roman Jakobson zur Interdependenz von Poesie und Grammatik anhand von Bertolt Brechts „Jungfraunballade“. Das Hauptziel ist die Anwendung und Verdeutlichung von Jakobsons Ansatz auf ein konkretes literarisches Werk.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit der Beziehung zwischen Poesie und Grammatik nach Jakobson, der Anwendung linguistischer Analysemethoden auf Literatur, der Analyse grammatischer Strukturen in Brechts „Jungfraunballade“ und deren Bedeutung für die poetische Wirkung, dem Einfluss grammatischer Parallelismen auf die Poetik und der Analyse der „Bilderlosen Poesie“ im Kontext des Gedichts. Dabei werden Jakobsons biografischer Hintergrund und seine linguistischen Schulen (Russischer Formalismus und Prager Strukturalismus) beleuchtet.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Autor (Roman Jakobson), ein Kapitel zur Analyse der „Jungfraunballade“ (einschließlich Unterkapitel zu grammatischem Parallelismus, bilderloser Poesie und grammatischer Eigenart), einen Schluss und ein Literaturverzeichnis (mit Primär- und Sekundärliteratur).
Warum wurde die „Jungfraunballade“ ausgewählt?
Die „Jungfraunballade“ wurde aufgrund ihrer Kürze und ihrer reichhaltigen grammatischen Strukturen ausgewählt, die sich besonders gut für die Anwendung von Jakobsons Thesen eignen. Ihre Eignung für die Analyse wurde in der Arbeit detailliert begründet.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine linguistische Analysemethode, die auf den Thesen von Roman Jakobson basiert. Der Fokus liegt auf der Untersuchung der grammatischen Strukturen des Gedichts und deren Beitrag zur poetischen Wirkung.
Wer ist Roman Jakobson und welche Bedeutung hat er?
Das Kapitel „Zum Autor“ gibt einen biografischen Überblick über Roman Jakobson, seine linguistischen Schulen (Russischer Formalismus und Prager Strukturalismus) und seinen Beitrag zur Entwicklung einer interdisziplinär anwendbaren Methode der linguistischen Analyse. Sein Einfluss auf die Literaturwissenschaft wird ebenfalls skizziert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Roman Jakobson, Poesie, Grammatik, Bertolt Brecht, Jungfraunballade, Grammatischer Parallelismus, Bilderlose Poesie, Grammatische Eigenart, Linguistische Analyse, Strukturalismus, Russischer Formalismus, Prager Linguistenkreis.
Was ist das Fazit der Arbeit?
Das Fazit (Schluss) der Arbeit wird im bereitgestellten Textfragment nicht explizit genannt. Der Text gibt aber Aufschluss über die Vorgehensweise und die Analyse der „Jungfraunballade“ im Kontext von Jakobsons Theorie.
- Quote paper
- Mag.phil. Karoline Ehrlich, MIB (Author), 2006, Poesie der Grammatik und Grammatik der Poesie von Roman Jakobson - Am Beispiel des Gedichtes "Die Jungfraunballade" von Bertolt Brecht, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/60817