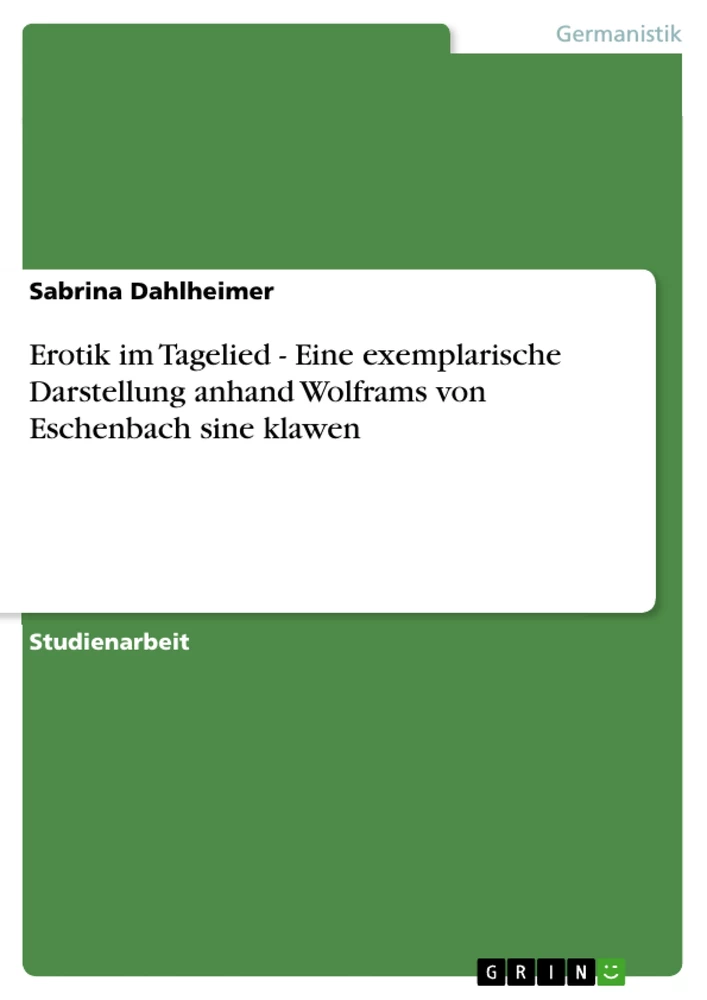„Abschied ist die innigste Weise menschlichen Zusammenseins“. Dieser Darstellung inniger körperlicher Zuneigung beim Abschied von der heimlichen Liebe möchte ich mich in der folgenden Ausführung zuwenden. Anhand der Themen Erotik, dem Verhältnis zwischen Mann und Frau und dem Verständnis von Sexualität, Sinnlichkeit und Körperlichkeit im Mittelalter möchte ich in der vorliegenden Arbeit Wolfram von Eschenbachs Tageliedsîne klâwen entlang der Entwicklung vom Morgengrauen bis hin zum Abschied analysieren. Ziel der Seminararbeit soll es sein, die Darstellung erotischer Liebe unter Berücksichtigung des historischen Kontextes möglichst umfassend zu deuten.
Hierzu möchte ich zunächst einen kurzen Exkurs auf die Stellung der Sexualität im höfischen System des Mittelalters geben, da dies dem Verständnis der weiteren Ausarbeitung dient. Das darauffolgende Kapitel werde ich dann eingehend der Gattung Tagelied widmen und den Versuch unternehmen, diese unter erotischen Gesichtspunkten auf ihre besondere Stellung im Minnesang zu untersuchen und zum Ausgangspunkt der Interpretation des ausgewählten Tageliedes machen. Der vierte Abschnitt umfasst die inhaltliche Analyse von Wolfram von Eschenbachssîne klâwen,welches aufgrund der zahlreichen Aspekte bezüglich Erotik und Sexualität exemplarisch ausgewählt wurde. Der Inhalt muss dabei als bekannt vorausgesetzt werden, da im Rahmen dieser Hausarbeit kein Abdruck des Liedes oder einer vollständigen Übersetzung erfolgen kann. Lediglich die für die Analyse wichtigen Passagen werden im Verlauf der Ausführung wiedergegeben und übersetzt. Abschließend möchte ich im letzten Teil ein kurzes Resümee über die gewonnenen Erkenntnisse ziehen. Da nur sehr vage Quellen über das Leben Wolfram von Eschenbachs existieren, möchte ich auf biographische Spekulationen verzichten und meine Ausarbeitung weitgehend textimmanent auf die erotischen Aspekte beschränken. Erwähnen möchte ich an dieser Stelle lediglich, dass Wolfram von Eschenbach vermutlich von ca. 1190 bis 1220 n. Chr. in Mittelfranken lebte. Herkunft und Stellung sind, bis auf die Tatsache, dass er ein relativ unvermögender Ritter war, nicht vollständig geklärt. Mit seinen Epen „Parzival“, „Willehalm“ und „Titurel“ sowie seinen neun überlieferten Liedern, von denen fünf der Gattung des Tageliedes zugeordnet werden können, zählt er zu den „zwölf alten Meistern“ des Minnesangs.
Inhaltsverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- Einleitung
- Sexualität, Ehe und Geschlechterdiskurs im Mittelalter
- Erotische Elemente in der Hohen Minne – Die besondere Stellung des Tageliedes im Minnesang
- Erotische Momente in Wolfram von Eschenbachs Tagelied sîne klâwen
- Schlussgedanke
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit analysiert Wolfram von Eschenbachs Tagelied sîne klâwen unter Berücksichtigung des historischen Kontextes, um die Darstellung erotischer Liebe zu deuten. Die Arbeit untersucht die erotischen Elemente im Tagelied im Vergleich zum Minnesang und beleuchtet die Sexualität, Ehe und Geschlechterrollen im Mittelalter.
- Erotik und Sexualität im Mittelalter
- Das Tagelied als Gattung des Minnesangs
- Interpretation von Wolfram von Eschenbachs sîne klâwen
- Geschlechterrollen und Ehe im mittelalterlichen Kontext
- Darstellung erotischer Liebe im ausgewählten Tagelied
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Seminararbeit ein und beschreibt das Ziel, die erotische Liebe in Wolfram von Eschenbachs Tagelied sîne klâwen unter Berücksichtigung des historischen Kontextes zu deuten. Sie skizziert den Aufbau der Arbeit mit einem Exkurs zur Sexualität im höfischen Mittelalter, einer Untersuchung der Tageliedgattung und einer detaillierten Analyse von sîne klâwen, wobei der Textinhalt als bekannt vorausgesetzt wird. Abschließend wird ein kurzes Resümee angekündigt, und es wird auf biographische Spekulationen über Wolfram von Eschenbach verzichtet.
Sexualität, Ehe und Geschlechterdiskurs im Mittelalter: Dieses Kapitel beleuchtet die gesellschaftlichen Normen und Vorstellungen von Sexualität, Ehe und Geschlechterrollen im Mittelalter. Im Gegensatz zu heutigen Ansichten war das Sexualleben bis zum hohen Mittelalter vermutlich freizügiger. Die Arbeit beschreibt den Prozess der Zivilisation nach Norbert Elias, der zu einer zunehmenden Selbstkontrolle und Reduktion der Sexualität führte, vor allem in höfischen Kreisen. Die Kirche wertete Sexualität als sündhaft ab, zulässig nur innerhalb der Ehe zur Fortpflanzung. Vorehelicher Geschlechtsverkehr und Ehebruch, insbesondere von Frauen, galten als schwere Vergehen. Die Ehe diente primär der Standesbewahrung und Fortpflanzung, wobei Frauen als labil und minderwertig angesehen wurden. Allerdings wird auch auf die Existenz von Zeugnissen von liebevoller Zuneigung und Akzeptanz hingewiesen, um ein differenziertes Bild zu zeichnen.
Schlüsselwörter
Tagelied, Wolfram von Eschenbach, sîne klâwen, Minnesang, mittelalterliche Erotik, Sexualität, Ehe, Geschlechterrollen, höfisches System, historischer Kontext, Liebeslyrik.
FAQ: Seminararbeit zu Wolfram von Eschenbachs Tagelied "sîne klâwen"
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit analysiert Wolfram von Eschenbachs Tagelied „sîne klâwen“ im Kontext des mittelalterlichen Verständnisses von Erotik, Sexualität, Ehe und Geschlechterrollen. Sie untersucht die erotischen Elemente des Gedichts im Vergleich zum Minnesang und beleuchtet die Darstellung erotischer Liebe.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Erotik und Sexualität im Mittelalter, das Tagelied als Gattung des Minnesangs, die Interpretation von Wolfram von Eschenbachs „sîne klâwen“, Geschlechterrollen und Ehe im mittelalterlichen Kontext sowie die Darstellung erotischer Liebe im ausgewählten Tagelied.
Welche Kapitel enthält die Arbeit?
Die Arbeit umfasst eine Einleitung, ein Kapitel zu Sexualität, Ehe und Geschlechterdiskurs im Mittelalter, ein Kapitel zur Analyse der erotischen Elemente in Wolfram von Eschenbachs „sîne klâwen“ im Vergleich zum Minnesang, einen Schlussgedanken, sowie ein Literaturverzeichnis. Die Einleitung beschreibt Zielsetzung und Aufbau der Arbeit. Das Kapitel zur mittelalterlichen Sexualität beleuchtet die gesellschaftlichen Normen und Vorstellungen der damaligen Zeit. Die Analyse von „sîne klâwen“ bildet den Kern der Arbeit.
Wie wird das Tagelied „sîne klâwen“ interpretiert?
Die Seminararbeit bietet eine detaillierte Interpretation von Wolfram von Eschenbachs „sîne klâwen“, wobei der Textinhalt als bekannt vorausgesetzt wird. Die Interpretation erfolgt unter Berücksichtigung des historischen Kontextes und im Vergleich zur Tagelied-Gattung des Minnesangs. Es werden die darin enthaltenen erotischen Elemente analysiert und im Lichte der mittelalterlichen Moralvorstellungen gedeutet.
Wie wird der historische Kontext berücksichtigt?
Der historische Kontext spielt eine zentrale Rolle in der Arbeit. Das Kapitel zu Sexualität, Ehe und Geschlechterdiskurs im Mittelalter liefert den Hintergrund für das Verständnis der im Tagelied dargestellten erotischen Aspekte. Die Arbeit beleuchtet die gesellschaftlichen Normen, die Vorstellung von Sexualität und die Rolle von Frauen im Mittelalter.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen aus der Analyse von „sîne klâwen“ bezüglich der Darstellung erotischer Liebe im Mittelalter. Ein abschließender Schlussgedanke fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant?
Schlüsselwörter der Arbeit sind: Tagelied, Wolfram von Eschenbach, sîne klâwen, Minnesang, mittelalterliche Erotik, Sexualität, Ehe, Geschlechterrollen, höfisches System, historischer Kontext, Liebeslyrik.
- Quote paper
- Sabrina Dahlheimer (Author), 2006, Erotik im Tagelied - Eine exemplarische Darstellung anhand Wolframs von Eschenbach sine klawen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/60853