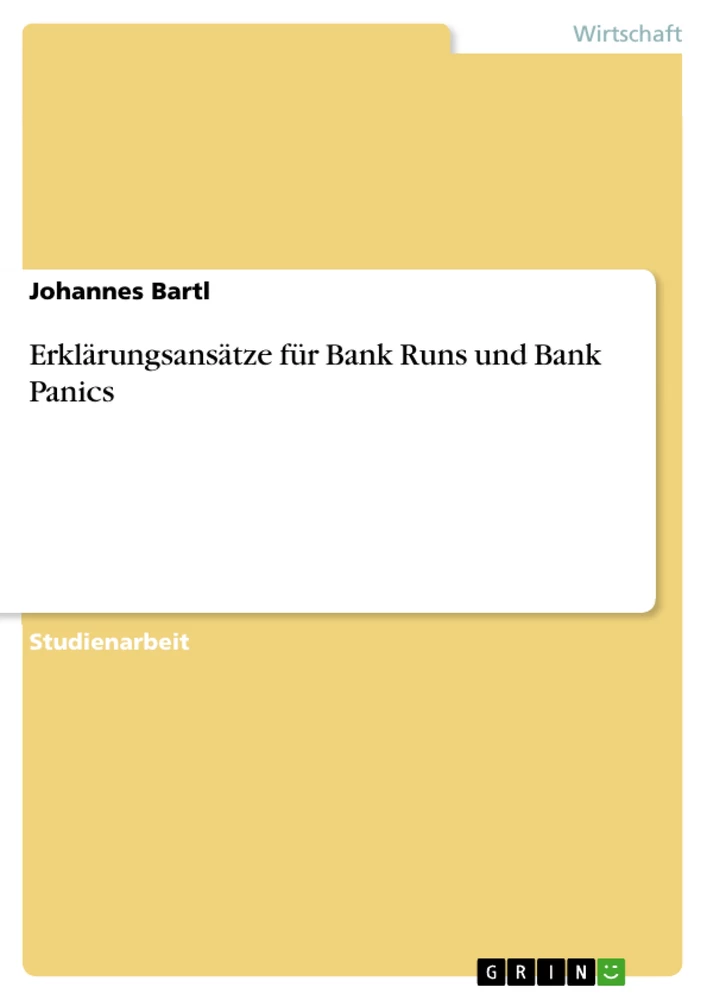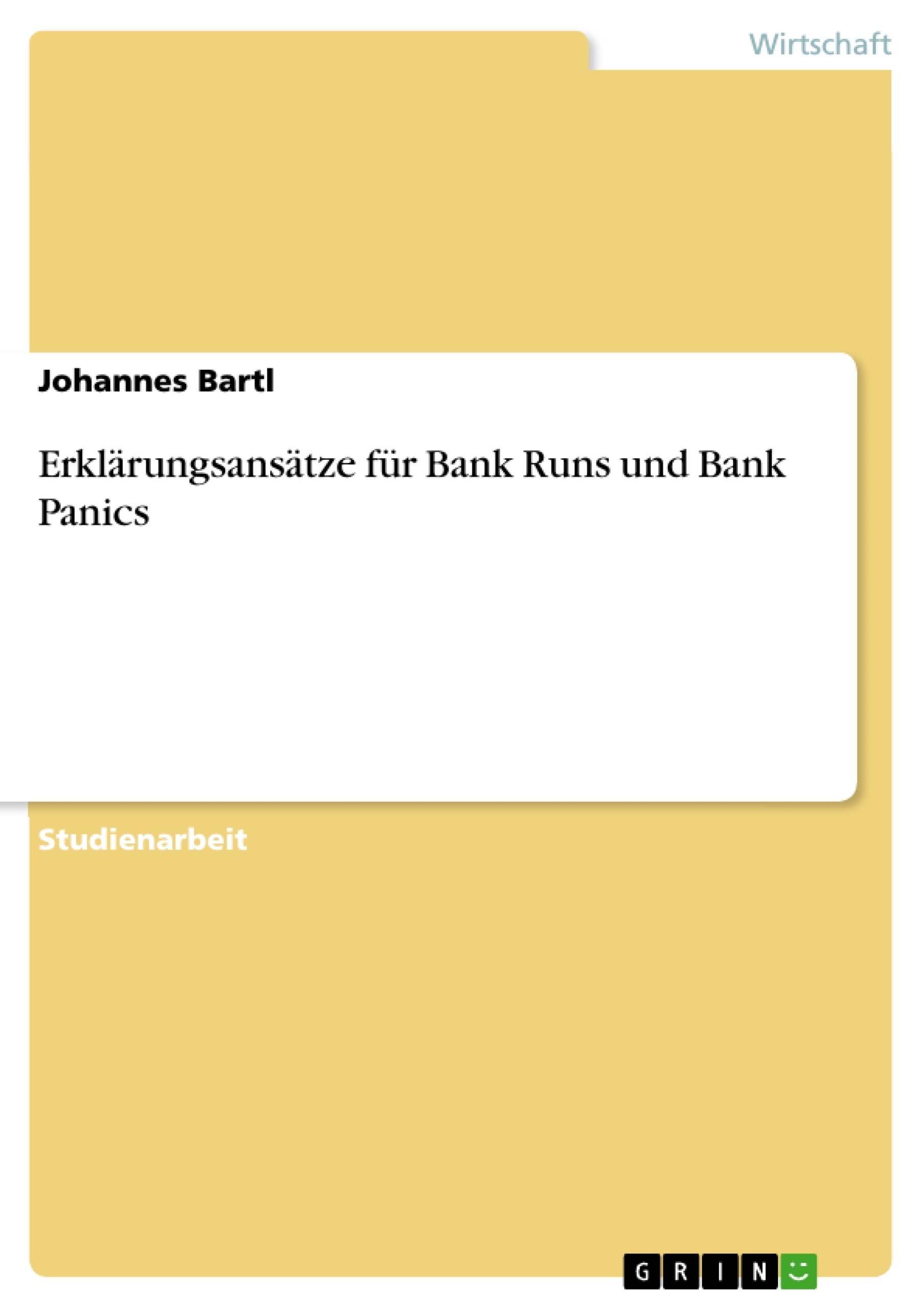Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird vom Autor Johannes Bartl versucht einen Einblick in das Phänomen eines Bank Runs und einer Bank Panik zu geben. Von einem Bank Run spricht man dann, wenn viele oder alle Einleger einer einzelnen Geschäftsbank in kurzer Zeit ihre Einlagen in Primärgeld umwandeln wollen. Überträgt sich ein solcher Run auf mehrere Geschäftsbanken, spricht man von einer Panik. Der Schwerpunkt wird im Rahmen dieses Aufsatzes auf Erklärungsansätze für diese Erscheinungen gelegt. Dabei wird an Hand verschiedener Modelle aufgezeigt, wie Bank Runs entstehen können und es werden auch einige Ansätze vorgestellt, die eine Ausweitung auf eine Panik behandeln. Angesprochen werden danach auch einige konkrete Beispiele von Bankenkrisen um zu verdeutlichen, dass es sich hierbei nicht nur um ein theoretisches Konstrukt handelt, das keine Entsprechung in der Realität findet. Danach folgt dann die Vorstellung und Erklärung einiger Einrichtungen, die zur Vermeidung von solchen Krisen entwickelt wurden. Zum Abschluss wird noch kurz auf die Fragestellung eingegangen, ob und inwieweit es ökonomisch sinnvoll ist Bank Runs und Paniken zu verhindern.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einführung und Begriffe
- 2 Modelle zur Erklärung des Phänomens Bank Run
- 2.1 Der Bank Run als Sonnenflecken-Phänomen
- 2.1.1 Diamond und Dybvig (1983)
- 2.1.2 McCulloch und YU (1998)
- 2.1.3 Jacklin (1993)
- 2.1.4 Gangopadhyay and Singh (2000)
- 2.2 Der Bank Run nicht als Sunspot Event
- 2.2.1 Chari und Jaghanathan (1988)
- 2.2.2 Gontermann (2003)
- 3 Bankenpanik
- 3.1 Vom Run zur Panik
- 4 Bankenaufsicht
- 4.1 Einrichtungen zur Vermeidung von Runs und Paniken
- 4.2 Einlagensicherung und Lender of last resort
- 4.3 Weitere Sicherungsmittel
- 5 Beispiele aus der Vergangenheit
- 6 Volkswirtschaftliche Betrachtung des Phänomens
- 7 Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit bietet einen Überblick über das Phänomen von Bank Runs und Bankpaniken und konzentriert sich auf verschiedene Erklärungsansätze. Anhand verschiedener Modelle werden die Entstehungsmechanismen von Bank Runs beleuchtet, und es werden Ansätze zur Behandlung einer möglichen Ausweitung zu Paniken vorgestellt. Konkrete Beispiele veranschaulichen die Relevanz des Themas. Schließlich werden Einrichtungen zur Krisenvermeidung erläutert und die ökonomische Sinnhaftigkeit der Prävention von Bank Runs und Bankpaniken diskutiert.
- Erklärungsansätze für Bank Runs
- Das Modell von Diamond und Dybvig
- Unterschiede zwischen "Sunspot"- und Informationsansätzen
- Maßnahmen zur Vermeidung von Bank Runs und Paniken
- Volkswirtschaftliche Auswirkungen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einführung und Begriffe: Dieses Kapitel führt in die Thematik von Bank Runs und Bankpaniken ein und definiert die zentralen Begriffe. Es wird die Bedeutung dieser Phänomene für Finanz- und Wirtschaftskrisen hervorgehoben und die beiden gegensätzlichen Erklärungsansätze – Sunspots und reale Konjunkturzyklen – vorgestellt. Das Kapitel legt den Grundstein für die detaillierte Analyse der verschiedenen Modelle und Ansätze in den folgenden Kapiteln. Die enorme wirtschaftliche Tragweite dieser Ereignisse wird unterstrichen und die Notwendigkeit, diese Phänomene zu verstehen und zu verhindern, deutlich gemacht.
2 Modelle zur Erklärung des Phänomens Bank Run: Dieses Kapitel präsentiert eine Auswahl von Modellen und Erklärungsansätzen für Bank Runs. Der Schwerpunkt liegt auf dem Modell von Diamond und Dybvig, das den Bank Run als ein "Sonnenflecken-Phänomen" beschreibt, bei dem der Abzug der Einlagen nicht auf Informationen über den Zustand der Bank zurückzuführen ist, sondern auf sich verändernde Erwartungen der Anleger. Weitere Modelle werden im Hinblick auf ihre Abweichungen und Ergänzungen zu diesem grundlegenden Ansatz betrachtet. Die verschiedenen Perspektiven tragen zum umfassenden Verständnis der komplexen Ursachen von Bank Runs bei. Das Kapitel analysiert sowohl die situationsbedingten Faktoren als auch die Rolle der Erwartungen bei der Entstehung von Bank Runs.
3 Bankenpanik: Dieses Kapitel befasst sich mit der Ausweitung von Bank Runs zu Bankenpaniken. Es untersucht den Übergangsprozess und die Dynamik, die zu einer systemischen Krise führen kann. Die Kapitel fokussiert wahrscheinlich auf die Mechanismen der Ansteckung und die Verstärkungseffekte, die bei einer Bankenpanik auftreten. Es beschreibt wahrscheinlich wie ein anfänglicher Run an einer Bank sich auf andere Banken ausbreitet und zu einer umfassenden Krise führt. Die Analyse der Übertragungsmechanismen und die Erforschung der Faktoren, die zu einer Eskalation beitragen, stehen hier im Vordergrund.
4 Bankenaufsicht: Das Kapitel erörtert die Rolle der Bankenaufsicht bei der Prävention von Bank Runs und Paniken. Es analysiert verschiedene Einrichtungen und Maßnahmen, die entwickelt wurden, um solche Krisen zu vermeiden oder zu mildern. Die detaillierte Betrachtung der Einlagensicherung und des "Lender of last resort"-Mechanismus beleuchtet deren Wirkung und Grenzen. Weitere Sicherungsmittel werden ebenfalls untersucht, und es wird wahrscheinlich eine umfassende Bewertung der Wirksamkeit verschiedener aufsichtsrechtlicher Instrumente vorgenommen.
5 Beispiele aus der Vergangenheit: Dieses Kapitel präsentiert konkrete Beispiele aus der Geschichte, die die Bedeutung und Auswirkungen von Bank Runs und Paniken verdeutlichen. Durch die Analyse realer Ereignisse wird die theoretische Diskussion mit empirischen Erkenntnissen verknüpft und die Relevanz der vorherigen Kapitel unterstrichen. Die ausgewählten Fallstudien bieten wahrscheinlich wertvolle Einblicke in die Dynamik von Bankenkrisen und helfen, die theoretischen Modelle besser zu verstehen und zu bewerten.
6 Volkswirtschaftliche Betrachtung des Phänomens: Dieses Kapitel untersucht die volkswirtschaftlichen Auswirkungen von Bank Runs und Paniken. Es wird wahrscheinlich eine Analyse der gesamtwirtschaftlichen Konsequenzen von solchen Ereignissen und deren Auswirkungen auf die Finanzstabilität präsentieren. Möglicherweise werden auch die Kosten der Prävention von Bank Runs und Paniken mit den Kosten, die durch das Nichthandeln entstehen, verglichen. Das Kapitel bietet somit einen umfassenden Blick auf die Makroökonomischen Implikationen dieser Krisen.
Schlüsselwörter
Bank Run, Bankpanik, Finanzkrisen, Erklärungsansätze, Diamond-Dybvig-Modell, Sunspot-Theorie, Informationsasymmetrie, Bankenaufsicht, Einlagensicherung, Lender of last resort, Volkswirtschaftliche Auswirkungen, Risikomanagement.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Bank Runs und Bankpaniken
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit bietet einen umfassenden Überblick über das Phänomen von Bank Runs und Bankpaniken. Sie behandelt verschiedene Erklärungsansätze, analysiert Modelle zur Entstehung von Bank Runs (insbesondere das Diamond-Dybvig-Modell), untersucht den Übergang von Runs zu Paniken, beleuchtet Maßnahmen der Bankenaufsicht zur Krisenprävention (Einlagensicherung, Lender of last resort), präsentiert historische Beispiele und diskutiert die volkswirtschaftlichen Auswirkungen dieser Ereignisse.
Welche Modelle zur Erklärung von Bank Runs werden behandelt?
Die Arbeit untersucht verschiedene Modelle, die Bank Runs erklären. Ein Schwerpunkt liegt auf dem Diamond-Dybvig-Modell, welches Bank Runs als "Sonnenflecken-Phänomen" beschreibt, also als Ereignisse, die nicht auf fundierten Informationen über die Bank beruhen, sondern auf sich ändernde Erwartungen der Anleger. Weitere Modelle, die sowohl den "Sunspot"-Ansatz als auch Ansätze, die Informationen in den Vordergrund stellen, werden im Hinblick auf ihre Unterschiede und Gemeinsamkeiten analysiert (z.B. McCulloch und YU (1998), Jacklin (1993), Gangopadhyay und Singh (2000), Chari und Jaghanathan (1988), Gontermann (2003)).
Wie wird der Unterschied zwischen "Sunspot"- und Informationsansätzen erklärt?
Die Arbeit unterscheidet zwischen Modellen, die Bank Runs als "Sonnenflecken-Phänomene" (Sunspots) erklären – also als Ereignisse, die durch selbst erfüllende Prophezeiungen und plötzliche, nicht informationsbasierte Panik ausgelöst werden – und Modellen, die Bank Runs auf Informationsasymmetrien oder schlechte Informationen über die tatsächliche Situation der Bank zurückführen. Die Arbeit vergleicht diese verschiedenen Perspektiven und trägt so zu einem umfassenderen Verständnis der Ursachen bei.
Welche Maßnahmen zur Vermeidung von Bank Runs und Paniken werden diskutiert?
Die Arbeit analysiert verschiedene Maßnahmen der Bankenaufsicht zur Prävention von Bank Runs und Paniken. Im Detail werden die Einlagensicherung und der "Lender of last resort"-Mechanismus untersucht, sowie weitere Sicherungsmittel. Die Wirksamkeit verschiedener aufsichtsrechtlicher Instrumente wird bewertet.
Welche volkswirtschaftlichen Auswirkungen von Bank Runs werden behandelt?
Die Arbeit untersucht die gesamtwirtschaftlichen Konsequenzen von Bank Runs und Paniken, einschließlich ihrer Auswirkungen auf die Finanzstabilität. Es wird wahrscheinlich ein Vergleich der Kosten der Prävention mit den Kosten, die durch das Nichthandeln entstehen, angestellt. Die makroökonomischen Implikationen dieser Krisen werden umfassend beleuchtet.
Welche Beispiele aus der Vergangenheit werden genannt?
Die Arbeit enthält konkrete Beispiele aus der Geschichte, um die Bedeutung und Auswirkungen von Bank Runs und Paniken zu verdeutlichen. Diese realen Ereignisse veranschaulichen die theoretischen Modelle und unterstreichen deren Relevanz.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Bank Run, Bankpanik, Finanzkrisen, Erklärungsansätze, Diamond-Dybvig-Modell, Sunspot-Theorie, Informationsasymmetrie, Bankenaufsicht, Einlagensicherung, Lender of last resort, Volkswirtschaftliche Auswirkungen, Risikomanagement.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält Kapitelzusammenfassungen, die jeweils den Inhalt und die Schwerpunkte der einzelnen Kapitel detailliert beschreiben. Diese Zusammenfassungen bieten einen schnellen Überblick über die behandelten Themen und deren Zusammenhang.
- Citar trabajo
- Mag. Johannes Bartl (Autor), 2005, Erklärungsansätze für Bank Runs und Bank Panics, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/60859