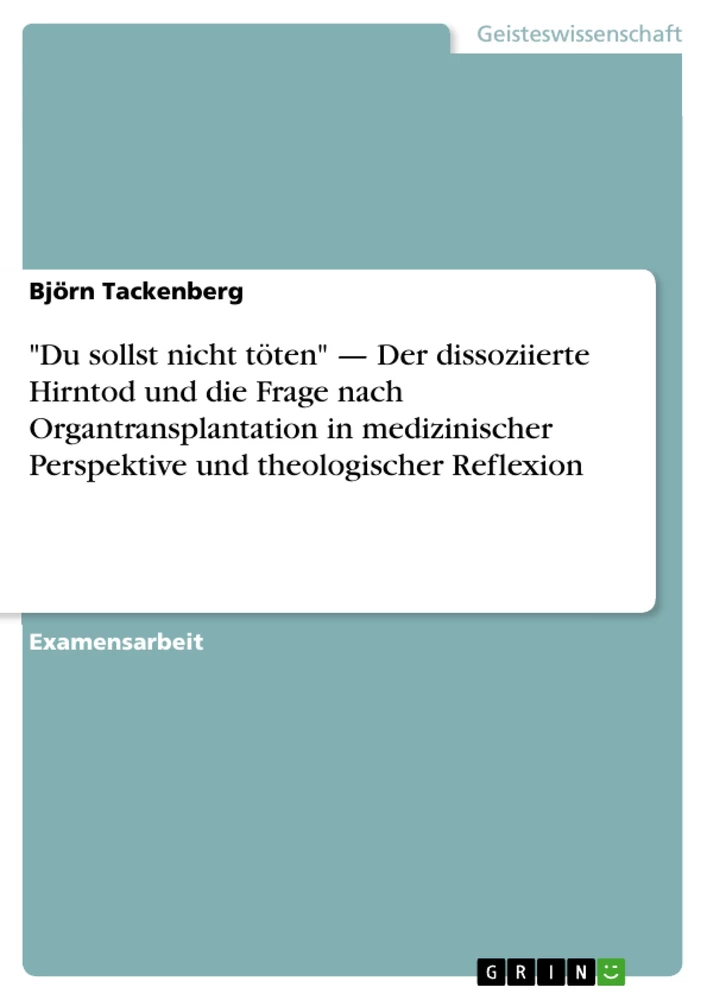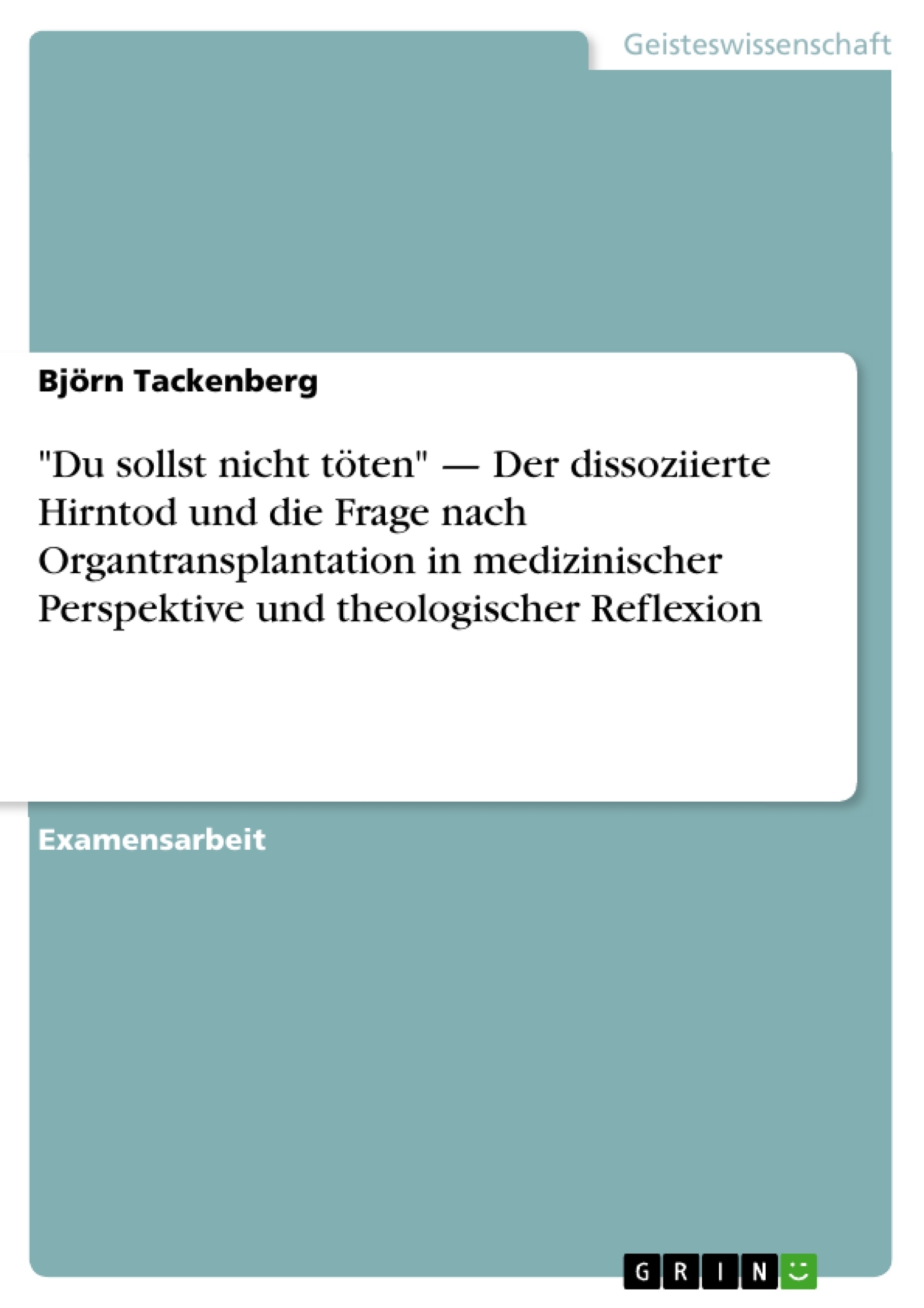Vorbemerkung: Zum ersten Mal kam ich vor fünf Jahren in einem meiner ersten medizinischen Semester während einer vorklinischen Vorlesung über Nierentransplantation mit den Problemen des Hirntodes in Berührung. Der engagierte Professor bot seine ganze Autorität auf, um uns Anfängerinnen und Anfängern nahezubringen, wie wichtig die Definition des Hirntodes für die Transplantationsmedizin ist; auch wie vielen Menschen durch eine Organtransplantation dauerhaft geholfen werden könne. Es sei deswegen, allemal für Studierende der Medizin, eine moralische Pflicht, als Organspenderin und Organspender zur Verfügung zu stehen. Eindringlich bat er uns, entsprechende testamentarische Verfügungen auszufüllen.
Einige Zeit später begann der makroanatomische Präparierkurs an der Leiche. Im wissenschaftlichen Umgang mit einem Toten hatte ich über ein Semester Zeit für eine erste Auseinandersetzung mit Tod und Sterben. Im klinischen Studienabschnitt half ich, ein außercurriculares Seminar für Studierende der Medizin zum Thema „Diagnosemitteilung und Sterbebegleitung“ zu organisieren und konnte dafür Professoren und Dozentinnen der Psychologie, Medizinethik, Inneren Medizin und Theologie gewinnen.
Ich glaubte, eine gewisse Diskrepanz erkennen zu können zwischen dem Menschenbild der Medizin, wie es sich mir in den Vorlesungen, Kursen und im Gespräch mit den Lehrenden erschloß und dem Menschenbild, das ich in meinem Theologiestudium kennenlernte. An (fast) keinem Ort des Medizinstudiums ist der Zweifel didaktisches Konzept. Im Notfall zu zweifeln tötet! Und Medizin wird in der Universität oft vor diesem weiß-schwarzen Hintergrund gelehrt. Ich habe mich deswegen sehr auf die Arbeit an dem vorliegenden Text gefreut. Sie hat mir die Möglichkeit gegeben, mir in einem für die Medizin wichtigen Bereich ein Urteil zu bilden.
Inhaltsverzeichnis
- A. Vorbemerkungen
- B. Einleitung
- C. Hauptteil
- 1. Der Hirntod in medizinischer Perspektive und kritischer Reflexion
- 1.1 Das zugrundeliegende Menschenbild
- 1.2 Einwände
- 2. „Du sollst nicht töten!“ Der Anwendungsbereich des Fünften Gebotes bei Martin Luther
- 2.1 Das zweite Gebot der zweiten Tafel
- 2.2 Darstellung
- 2.3 Anthropologie, Glaube, Ethik
- 2.4 Der Anwendungsbereich des Fünften Gebotes - Fazit
- 3. Die Organexplantation in theologischer Reflexion
- 3.1 Der als Geschöpf Gottes kommunizierende Mensch
- 3.2 Im Vertrauen auf das Versprechen Gottes
- 3.3 Der im Glauben verantwortliche Mensch vor Gott
- 1. Der Hirntod in medizinischer Perspektive und kritischer Reflexion
- D. Schlussteil: Kritische Würdigung
- E. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die ethischen und theologischen Implikationen des Hirntods und der Organtransplantation. Sie analysiert die medizinische Definition des Hirntods im Kontext unterschiedlicher Menschenbilder und prüft die Vereinbarkeit der Organentnahme mit dem biblischen Gebot „Du sollst nicht töten“. Die Arbeit strebt nach einer kritischen Auseinandersetzung mit bestehenden Argumentationslinien und versucht, theologische Perspektiven in die Debatte einzubringen.
- Das medizinische Menschenbild und seine Relevanz für die Definition des Hirntods
- Die ethische und theologische Bewertung der Organtransplantation
- Die Interpretation des Fünften Gebotes im Kontext der modernen Medizin
- Der Spannungsbereich zwischen medizinischem Fortschritt und theologischer Ethik
- Die Rolle des Glaubens im Umgang mit Tod und Sterben
Zusammenfassung der Kapitel
A. Vorbemerkungen: Diese Einleitung beschreibt den persönlichen Werdegang des Autors und seine Auseinandersetzung mit dem Thema Hirntod und Organtransplantation im Kontext seines Medizinstudiums und seines Theologiestudiums. Es wird eine Diskrepanz zwischen dem Menschenbild der Medizin und dem der Theologie aufgezeigt, die die Motivation für die vorliegende Arbeit darstellt. Methodische und formale Aspekte der Arbeit werden erläutert, insbesondere die Zitierweise und das Bemühen um geschlechtergerechte Sprache.
B. Einleitung: Die Einleitung situiert die Thematik historisch und verweist auf die kontroverse Debatte um das Hirntodkriterium, insbesondere die Kritik von Hans Jonas. Sie verdeutlicht die weitgehende Akzeptanz des Hirntodkriteriums in der Medizin und beschreibt den erneuten Aufschwung der Debatte durch den Fall einer hirntoten schwangeren Frau im Jahr 1992, welcher die etablierten Argumentationslinien in Frage stellt.
C. Hauptteil Kapitel 1: Dieses Kapitel beleuchtet den Hirntod aus medizinischer Perspektive und unterzieht die zugrundeliegenden Menschenbilder einer kritischen Reflexion. Es werden die verschiedenen Aspekte des Menschenbildes der Transplantationsmedizin – Leben, Personalität, Körperlichkeit – analysiert und diskutiert. Zusätzlich werden philosophische und theologische Einwände gegen die gängige Definition des Hirntods präsentiert und eingeordnet. Das Kapitel legt den Grundstein für die spätere ethische und theologische Auseinandersetzung.
C. Hauptteil Kapitel 2: Kapitel 2 befasst sich mit der theologischen Interpretation des Fünften Gebotes „Du sollst nicht töten“ anhand der Schriften Martin Luthers. Es analysiert die verschiedenen Aspekte des Gebotes – die horizontale und die vertikale Bewegung – sowie die Relevanz von Anthropologie, Glaube und Ethik für die Anwendung des Gebotes. Es wird untersucht, inwieweit das Gebot im Kontext der Organtransplantation angewendet werden kann.
C. Hauptteil Kapitel 3: Dieses Kapitel widmet sich der theologischen Reflexion der Organexplantation. Es diskutiert den Menschen als Geschöpf Gottes, das im Glauben Verantwortung trägt. Die Bedeutung des Vertrauens in das göttliche Versprechen und die Rolle des Glaubens im Umgang mit Tod und Sterben werden erörtert. Das Kapitel verknüpft die vorhergehenden Kapitel und integriert die verschiedenen theologischen und ethischen Perspektiven.
Schlüsselwörter
Hirntod, Organtransplantation, Medizinische Ethik, Theologische Ethik, Martin Luther, Fünftes Gebot, Menschenbild, Gott, Glaube, Verantwortung, Lebensbegriff.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Ethische und Theologische Implikationen des Hirntods und der Organtransplantation
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die ethischen und theologischen Implikationen des Hirntods und der Organtransplantation. Sie analysiert die medizinische Definition des Hirntods im Kontext unterschiedlicher Menschenbilder und prüft die Vereinbarkeit der Organentnahme mit dem biblischen Gebot „Du sollst nicht töten“. Die Arbeit strebt nach einer kritischen Auseinandersetzung mit bestehenden Argumentationslinien und versucht, theologische Perspektiven in die Debatte einzubringen.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunktthemen: Das medizinische Menschenbild und seine Relevanz für die Definition des Hirntods; die ethische und theologische Bewertung der Organtransplantation; die Interpretation des Fünften Gebotes im Kontext der modernen Medizin; den Spannungsbereich zwischen medizinischem Fortschritt und theologischer Ethik; und die Rolle des Glaubens im Umgang mit Tod und Sterben.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in Vorbemerkungen, Einleitung, Hauptteil (mit drei Kapiteln: Hirntod in medizinischer Perspektive, Das Fünfte Gebot bei Martin Luther und Organexplantation in theologischer Reflexion), Schlussteil und Literaturverzeichnis. Der Hauptteil analysiert den Hirntod aus medizinischer und theologischer Sicht, interpretiert das Fünfte Gebot im Kontext der Organtransplantation und reflektiert die Organexplantation theologisch.
Was wird im Kapitel zum Hirntod behandelt?
Kapitel 1 beleuchtet den Hirntod aus medizinischer Perspektive und unterzieht die zugrundeliegenden Menschenbilder einer kritischen Reflexion. Es werden verschiedene Aspekte des Menschenbildes der Transplantationsmedizin (Leben, Personalität, Körperlichkeit) analysiert und diskutiert. Philosophische und theologische Einwände gegen die gängige Definition des Hirntods werden präsentiert und eingeordnet.
Wie wird das Fünfte Gebot ("Du sollst nicht töten") interpretiert?
Kapitel 2 befasst sich mit der theologischen Interpretation des Fünften Gebotes anhand der Schriften Martin Luthers. Es analysiert verschiedene Aspekte des Gebotes (horizontale und vertikale Bewegung) sowie die Relevanz von Anthropologie, Glaube und Ethik für dessen Anwendung. Es wird untersucht, inwieweit das Gebot im Kontext der Organtransplantation angewendet werden kann.
Welche theologische Perspektive wird auf die Organexplantation eingenommen?
Kapitel 3 widmet sich der theologischen Reflexion der Organexplantation. Es diskutiert den Menschen als Geschöpf Gottes, das im Glauben Verantwortung trägt. Die Bedeutung des Vertrauens in das göttliche Versprechen und die Rolle des Glaubens im Umgang mit Tod und Sterben werden erörtert. Das Kapitel verknüpft die vorhergehenden Kapitel und integriert die verschiedenen theologischen und ethischen Perspektiven.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Hirntod, Organtransplantation, Medizinische Ethik, Theologische Ethik, Martin Luther, Fünftes Gebot, Menschenbild, Gott, Glaube, Verantwortung, Lebensbegriff.
Welche methodischen Aspekte werden in der Arbeit berücksichtigt?
Die Vorbemerkungen erläutern methodische und formale Aspekte der Arbeit, insbesondere die Zitierweise und das Bemühen um geschlechtergerechte Sprache. Die Einleitung situiert die Thematik historisch und verweist auf die kontroverse Debatte um das Hirntodkriterium.
Welche Zusammenfassung der Kapitel wird geboten?
Die Arbeit bietet Kapitelzusammenfassungen, die die wichtigsten Punkte jedes Kapitels kurz und prägnant darstellen und den Lesern einen Überblick über den Inhalt der Arbeit ermöglichen.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Theologen, Mediziner, Ethiker und alle, die sich mit den ethischen und theologischen Fragen im Kontext von Hirntod und Organtransplantation auseinandersetzen.
- Quote paper
- Dr. Björn Tackenberg (Author), 1997, "Du sollst nicht töten" — Der dissoziierte Hirntod und die Frage nach Organtransplantation in medizinischer Perspektive und theologischer Reflexion, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/61044