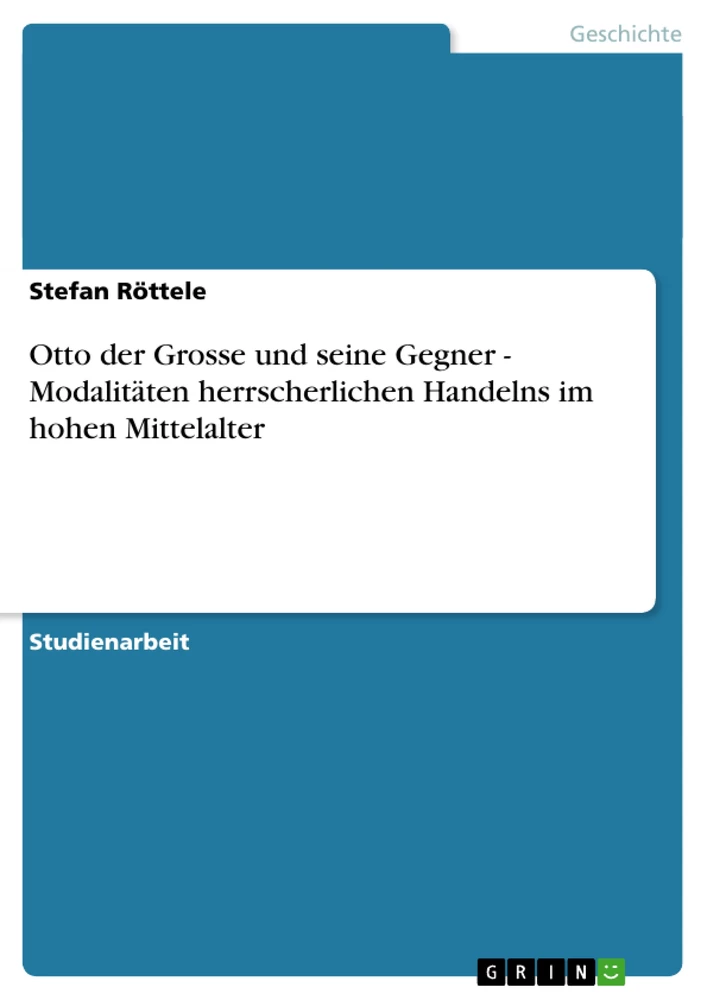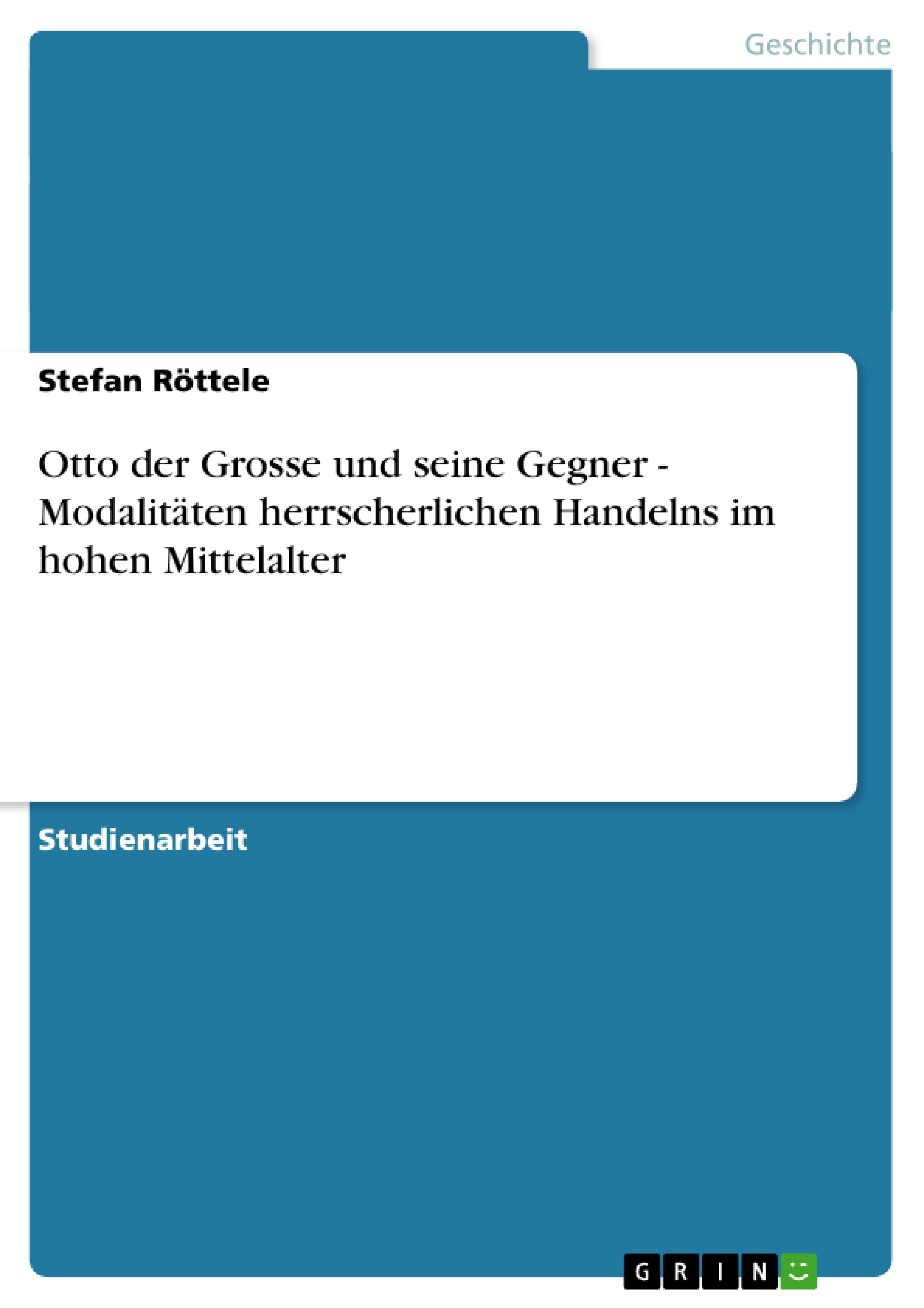[...] Zusätzlich sollen in dieser Hausarbeit neben den skizzierten allgemeinen Zügen herrscherlichen Handelns auch individuelle Eigenschaften, also politische Planung oder Konzeption, in der Regierungszeit Ottos des Großen untersucht werden. Denn viele Mediävisten lassen das Erklärungsmodell Althoffs nur eingeschränkt gelten: Boshof beispielsweise wirft ihm im Zusammenhang mit der Konfliktbeilegung vor, „zu stark systematisierend“ gearbeitet zu haben. In einer Rezension zu Laudages Biographie weist Christian Hillen auf einen entscheidenden Widerspruch hin. Allein dessen Kapitelüberschrift „Die dynastische Herrschaftskonzeption“ verrate diesen. Mit der erfolgreichen Einrichtung des Erzbistums Magdeburg - so gibt Laudage selber zu - „endete die konzeptionell aktivste Phase im Leben des Herrschers“. Die Errichtung, die sich über Jahre hinzog, spreche dafür, dass Otto nicht völlig ohne politische Konzepte, in diesem Fall auch recht langfristige, regierte. Im zweiten Teil sollen Ottos Charakter, individuelle Konzeption und politische Planung deshalb im Fokus der Überlegungen stehen.
Im ersten Teil stützt sich die Argumentation neben den wichtigsten erzählenden Quellen besonders auf Werke oder Aufsätze Gerd Althoffs, der bei diesen Überlegungen als Begründer einer Forschungstradition und methodischen Herangehensweise an eine von Quellen nur spärlich erleuchtete Zeit zu gelten hat. Im zweiten Teil folgen die Überlegungen weitgehend der kürzlich erschienen Biografie Ottos des Großen von Johannes Laudage. An Urkunden und anderen Primärquellen wird überprüft, ob man individuelle Momente herausfiltern kann, die wir heute am ehesten mit planerischen Konzepten des Herrschers identifizieren könnten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Historischer Kontext
- 3. Sakrales Königtum und die Herrschertugend humilitas
- I. Teil: Allgemeine Modalitäten herrscherlichen Handelns
- I.1. Der ottonische Herrschaftsverband
- I.2. dignitas und honor
- I.3. Ritualisierte Eskalation von Konflikten und Emotionen
- I.4. Das Ritual der deditio
- I.5. Der honor des Vermittlers
- II. Teil: Otto der Große als Person, Konzeption und politische Planung
- II.1. Ausgangslage
- II.2. Charakter
- II.3. Die Aachener Tradition
- II.4. Ottos Kaiseridee
- II.5. Magdeburg und die Mission
- II.6. Dynastisches Prinzip im Herrschaftsverständnis
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Modalitäten herrscherlichen Handelns im 10. Jahrhundert, insbesondere während der Regierungszeit Ottos des Großen. Sie hinterfragt die These, dass ottonisches Handeln primär reaktiv und inszeniert war, und prüft den Einfluss von Planung und Konzeption auf Ottos politische Entscheidungen. Die Arbeit analysiert die Rahmenbedingungen der Herrschaft Ottos, ausgehend von seiner sakralen Legitimierung und den christlichen Herrschertugenden.
- Ottos Herrschaft im Kontext der ottonischen Herrschaftsordnung
- Die Bedeutung von "dignitas" und "honor" im ottonischen Herrschaftsverband
- Konfliktbewältigung und Vermittlungsstrategien im ottonischen Reich
- Analyse von Ottos individuellem Charakter und seiner politischen Planung
- Die Rolle der Aachener Tradition und Ottos Kaiseridee
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Forschungsdiskussion um die Modalitäten herrscherlichen Handelns im 10. Jahrhundert ein. Sie stellt die gegensätzlichen Thesen von Althoff und Laudage vor, die entweder von reaktivem und inszeniertem Handeln oder von langfristig geplanten Konzepten ausgehen. Die Arbeit kündigt die Untersuchung der Rahmenbedingungen von Ottos Herrschaft an, basierend auf seiner sakralen Legitimation, der Netzwerktheorie Althoffs, sowie der Analyse von Konflikten und deren Beilegung durch Vermittler. Zusätzlich wird die Rolle individueller Eigenschaften und politischer Planung Ottos des Großen untersucht, um die These Althoffs zu überprüfen.
2. Historischer Kontext: Dieses Kapitel beschreibt die Situation, die Otto der Große nach dem Tod Heinrichs I. antraf. Es beleuchtet die Thronerhebung in Aachen, die Betonung der karolingischen Tradition und die Bedeutung der vier germanischen Hausämter. Der Abschnitt beschreibt detailliert die verschiedenen Aufstände gegen Otto, angefangen von Eberhard von Bayern bis hin zu den Aufständen seines Bruders Heinrich. Die Aufstände werden in ihren Ursachen und Hintergründen analysiert, wobei persönliche Motive, territoriale Streitigkeiten und der Kampf um die Thronfolge im Vordergrund stehen. Das Kapitel gipfelt in der Darstellung von Ottos Erfolgen bei der Unterdrückung dieser Aufstände und der anschließenden Konsolidierung seiner Herrschaft.
3. Sakrales Königtum und die Herrschertugend humilitas: Dieses Kapitel analysiert die Rahmenbedingungen ottonischer Herrschaft im Detail. Der erste Teil behandelt den ottonischen Herrschaftsverband unter Berücksichtigung der "Netzwerktheorie" Althoffs. Die zentralen Begriffe "dignitas" und "honor" werden geklärt, um die Dynamik von Konflikten und deren rituelle Eskalation zu verstehen. Die Rolle von Vermittlern innerhalb des Netzwerks wird ebenfalls beleuchtet. Im zweiten Teil wendet sich die Arbeit Ottos des Großen zu. Es analysiert Ottos Charakter, seine Konzeption von Herrschaft und seine politische Planung im Lichte der gegensätzlichen Interpretationen der Forschung. Das Kapitel untersucht, ob Ottos Handeln langfristigen Konzepten folgte oder eher auf spontanen Reaktionen beruhte, wobei die Errichtung des Erzbistums Magdeburg als Schlüsselbeispiel diskutiert wird.
Schlüsselwörter
Otto der Große, ottonische Herrschaft, Modalitäten herrscherlichen Handelns, Konfliktbewältigung, Netzwerktheorie, dignitas, honor, humilitas, clementia, sakrales Königtum, politische Planung, Konzeption, Aachener Tradition, Magdeburg.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Modalitäten herrscherlichen Handelns im 10. Jahrhundert
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Modalitäten herrscherlichen Handelns im 10. Jahrhundert, insbesondere während der Regierungszeit Ottos des Großen. Sie hinterfragt die These, dass ottonisches Handeln primär reaktiv und inszeniert war und prüft den Einfluss von Planung und Konzeption auf Ottos politische Entscheidungen. Die Analyse basiert auf Ottos sakraler Legitimierung und den christlichen Herrschertugenden.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Schwerpunkte: Ottos Herrschaft im Kontext der ottonischen Herrschaftsordnung; die Bedeutung von "dignitas" und "honor"; Konfliktbewältigung und Vermittlungsstrategien; Analyse von Ottos individuellem Charakter und seiner politischen Planung; und die Rolle der Aachener Tradition und Ottos Kaiseridee.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit besteht aus vier Kapiteln: Kapitel 1 (Einleitung): Einführung in die Forschungsdiskussion und Vorstellung gegensätzlicher Thesen zu ottonischem Handeln. Kapitel 2 (Historischer Kontext): Beschreibung der Situation nach Heinrichs I. Tod, Ottos Thronerhebung und die Aufstände gegen seine Herrschaft. Kapitel 3 (Sakrales Königtum und die Herrschertugend humilitas): Detaillierte Analyse der Rahmenbedingungen ottonischer Herrschaft, einschließlich "dignitas," "honor," und der Rolle von Vermittlern. Analyse von Ottos Charakter, Konzeption von Herrschaft und politischer Planung. Kapitel 4 (Fazit): Zusammenfassung der Ergebnisse und Schlussfolgerungen (nicht im detaillierten Überblick enthalten).
Welche Thesen werden in der Arbeit diskutiert?
Die Arbeit diskutiert gegensätzliche Thesen von Althoff und Laudage. Althoff betont reaktives und inszeniertes Handeln, während Laudage langfristig geplante Konzepte annimmt. Die Arbeit untersucht, ob Ottos Handeln eher auf langfristigen Konzepten oder spontanen Reaktionen beruhte.
Welche Konzepte und Theorien werden verwendet?
Die Arbeit verwendet die Netzwerktheorie Althoffs zur Analyse des ottonischen Herrschaftsverbands und untersucht die Bedeutung von Begriffen wie "dignitas" und "honor" zur Erklärung der Dynamik von Konflikten. Die sakrale Legitimation Ottos und die christlichen Herrschertugenden bilden einen weiteren wichtigen Rahmen der Analyse.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für die Arbeit?
Schlüsselbegriffe sind: Otto der Große, ottonische Herrschaft, Modalitäten herrscherlichen Handelns, Konfliktbewältigung, Netzwerktheorie, dignitas, honor, humilitas, clementia, sakrales Königtum, politische Planung, Konzeption, Aachener Tradition, Magdeburg.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für Wissenschaftler und Studierende gedacht, die sich mit der Geschichte des 10. Jahrhunderts, der ottonischen Herrschaft und den Modalitäten herrscherlichen Handelns im Mittelalter auseinandersetzen.
Wo finde ich das vollständige Inhaltsverzeichnis?
Das vollständige Inhaltsverzeichnis befindet sich im einleitenden Teil der vorliegenden Arbeit (siehe oben im HTML-Code).
- Arbeit zitieren
- Stefan Röttele (Autor:in), 2004, Otto der Grosse und seine Gegner - Modalitäten herrscherlichen Handelns im hohen Mittelalter, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/61244