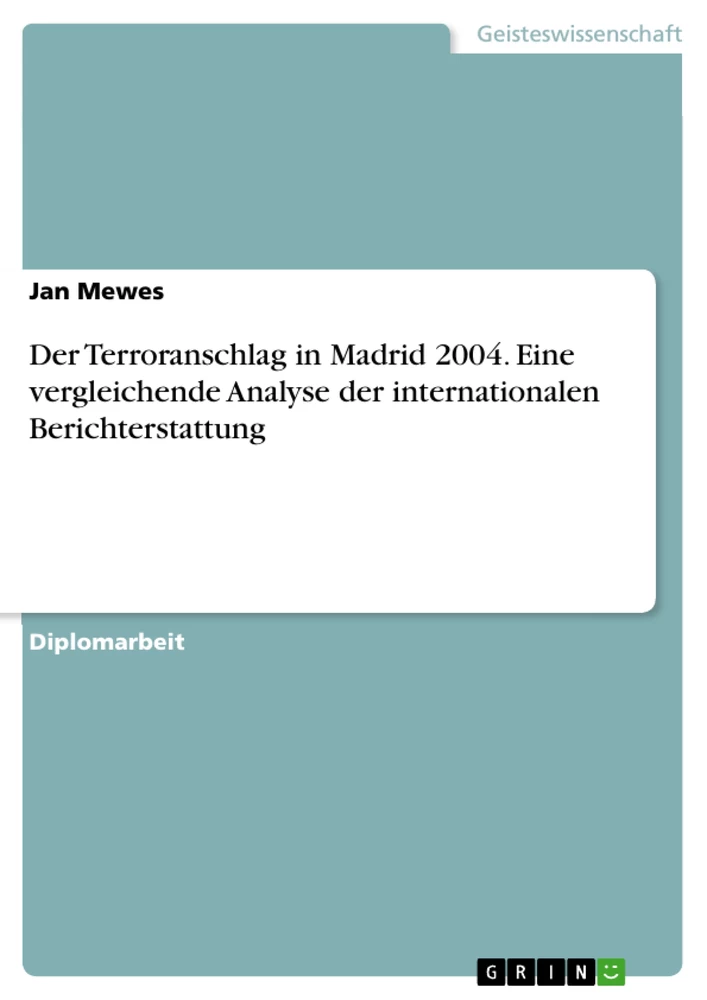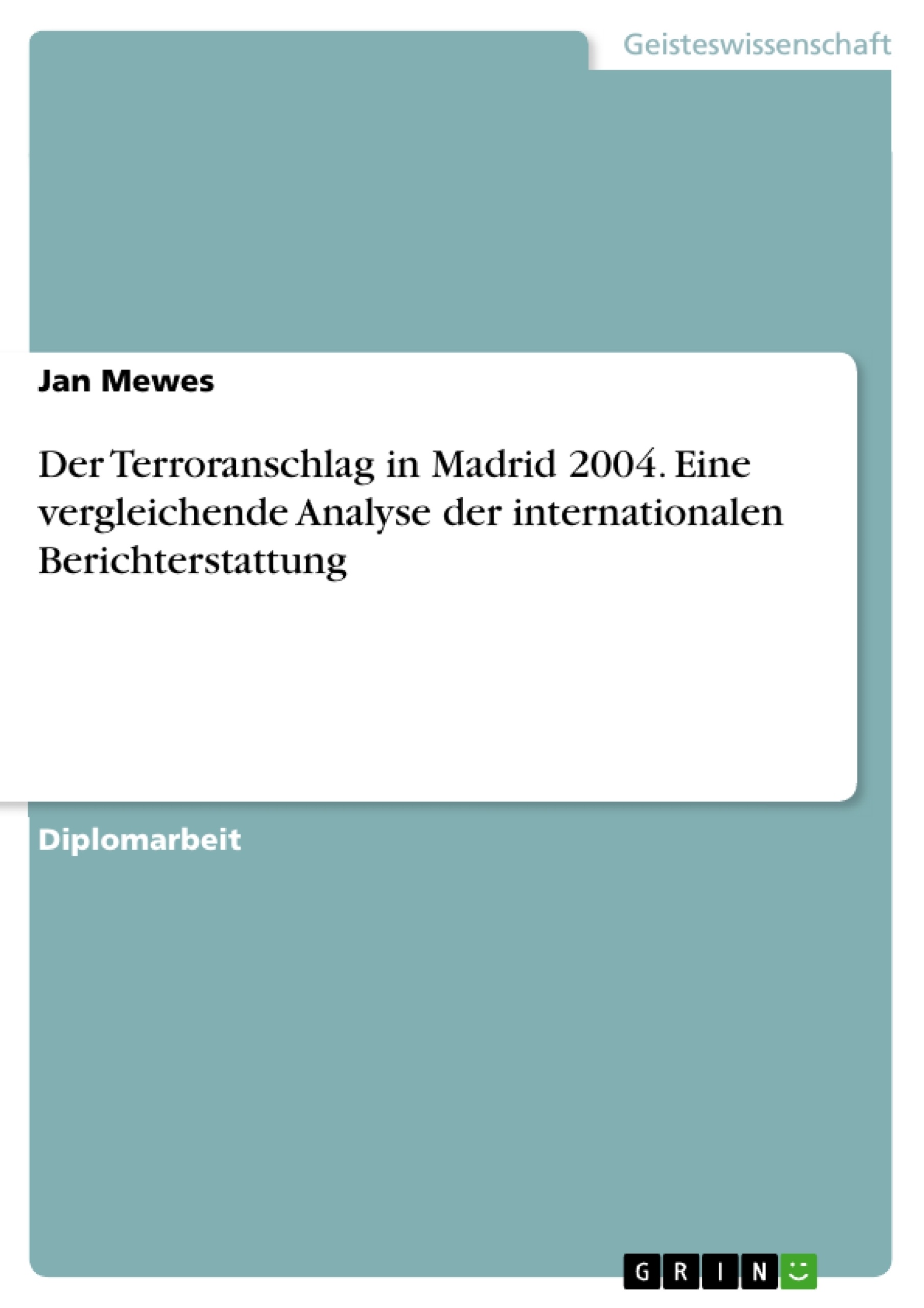Am Morgen des 11. März 2004 detonierten in Madrid nahezu gleichzeitig Sprengladungen in vier Pendlerzügen, die zu dieser Zeit in den Bahnhöfen Atocha, El Pozo und Santa Eugenia Halt machten. Dabei kamen 191 Menschen ums Leben, weitere 1400 wurden verletzt. Ging die die damalige konservative spanische Regierung unter Aznar kurz nach dem Anschlag noch davon aus dass die baskische Untergrundorganisation ETA für den Anschlag verantwortlich zeichne, so erwiesen sich alsbald Terroristen mit islamistischem Hintergrund als Urheber der Tat.
Jan Mewes geht in seiner Studie der Frage nach, wie deutsche und amerikanische Qualitätszeitungen über den schwerwiegendsten islamistischen Terroranschlag auf westlichem Boden seit dem 11. September 2001 berichten. Auf Basis einer detailreichen und vergleichenden Inhaltsanalyse aller 267 Artikel, die im Zeitraum von zwei Monaten nach dem Attentat in den Tageszeitungen "New York Times", "Frankfurter Rundschau" und "FAZ" erschienen sind, wird untersucht, welchen Ereignisaspekten besondere mediale Aufmerksamkeit zuteil wird. Das Hauptaugenmerk gilt dabei der Frage, welche Rolle der von George W. Bush ausgerufene "war on terrorism" in der journalistischen Berichterstattung spielt. Werden in den Artikeln Parallelen zwischen den Anschlägen von Madrid und 9/11 gezogen, und wenn ja, zeigen sich hier Unterschiede zwischen den untersuchten Zeitungen? Werden Tat und Täter im deutsch-amerikanischen Vergleich unterschiedlich bezeichnet? Richtet die US-amerikanische Berichterstattung ihren Fokus auf andere Themen als die der deutschen Blätter? Weiterhin untersucht der Autor, ob Printmedien auf mögliche strukturelle Hintergründe des islamistischen Terrorismus eingehen oder ob sie lediglich Schlaglichter auf die Biographien der beteiligten Täter werfen. Ein weiterer Schwerpunkt der Studie liegt auf der Analyse der journalistischen Darstellung über die proklamierten religiösen Tatmotive. Inwiefern differenzieren die Tageszeitungen zwischen islamischem Glauben einerseits und islamistisch motiviertem Terrorismus andererseits? Um diese Fragen zu beantworten, bemüht der Autor sowohl soziologische als auch historische Erklärungsansätze des islamistischen Terrorismus und stellt diese den Realitätskonstruktionen der untersuchten Printmedien gegenüber.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Kapitel 1: Terrorismus als soziales Problem
- 1.1 Soziale Probleme als Zustand
- 1.2 Die Konstruktion sozialer Probleme
- Kapitel 2: Was ist Terrorismus?
- Kapitel 3: Die Bewegung des islamischen Fundamentalismus
- 3.1 Politologische und soziologische Antworten auf das Phänomen des islamischen Fundamentalismus
- 3.2 Der islamische Fundamentalismus in Europa
- 3.3 Warum Spanien?
- 3.4 Terrorismus und islamischer Terrorismus – eine Zusammenfassung der bisherigen Diskussion
- Kapitel 4: Massenmedien und Nachrichtenselektion
- 4.1 Massenmedien und die Konstruktion gesellschaftlicher Wirklichkeit
- 4.2 Die Nachrichtenselektion
- 4.3 Die Nachrichtenwerttheorie
- Kapitel 5: Die Darstellung von Terrorismus in den Massenmedien
- Kapitel 6: Methodisches Vorgehen
- 6.1 Die Methode der Inhaltsanalyse
- 6.2 Die hier verwendeten Verfahren der Inhaltsanalyse
- 6.3 Stichprobe und Grundgesamtheit in der vorliegenden Inhaltsanalyse
- 6.4 Beobachtungszeitraum und Auswahlkriterien
- 6.5 Die Ziehung der Stichprobe
- 6.6 Die untersuchten Tagezeitungen
- 6.7 Hypothesen und Kategorien
- Kapitel 7: Ergebnisse
- 7.1 Umfang und Darstellungsformen
- 7.2 Nachrichtenagenturen
- 7.3 Fotos und graphische Darstellungen
- 7.4 Die Thematisierung der spanischen Regierungswahlen
- 7.5 "war on terrorism"
- 7.6 Umfang der Berichterstattung
- 7.7 Personalisierung
- 7.8 Parteienbias in der deutschen Presse?
- 7.9 Negativismus
- 7.10 Motive und Ursachen bezüglich des Anschlags
- 7.11 Links-Rechts-Berichterstattung in der deutschen Presse?
- 7.12 'Affective labeling'
- 7.13 Anonyme Quellen in der Berichterstattung
- 7.14 Zusammenfassung der Ergebnisse
- Kapitel 8: Zusammenfassung und Diskussion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit untersucht die Berichterstattung über den Terroranschlag von Madrid am 11. März 2004 in drei ausgewählten Printmedien: der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung”, der „Frankfurter Rundschau” und der „New York Times”. Die Arbeit analysiert die Inhalte der Berichterstattung mit dem Ziel, die Konstruktion von Terrorismus und die Rolle der Massenmedien in diesem Prozess zu beleuchten.
- Die Konstruktion sozialer Probleme und die Rolle der Medien in der Definition von Terrorismus
- Die Darstellung von Terrorismus in den Massenmedien und die Nachrichtenwerttheorie
- Die Berichterstattung über den islamischen Fundamentalismus und dessen Rolle im Zusammenhang mit dem Terrorismus
- Der Einfluss von Nachrichtenagenturen und die Personalisierung der Berichterstattung
- Die Frage nach einem „war on terrorism”-Newsframe und dessen Auswirkungen auf die Berichterstattung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung gibt einen Überblick über das Thema der Diplomarbeit und erläutert die Relevanz der Untersuchung. Kapitel 1 beleuchtet die theoretischen Grundlagen der Konstruktion sozialer Probleme, insbesondere im Kontext von Terrorismus. Kapitel 2 geht der Frage nach, was Terrorismus ist und welche Definitionen im wissenschaftlichen Diskurs diskutiert werden. Kapitel 3 befasst sich mit der Bewegung des islamischen Fundamentalismus und dessen Rolle im Zusammenhang mit dem Terrorismus. Die Kapitel 4 und 5 analysieren die Rolle der Massenmedien in der Konstruktion gesellschaftlicher Wirklichkeit und die Selektion von Nachrichten, insbesondere im Kontext der Berichterstattung über Terrorismus.
Kapitel 6 erläutert die methodischen Grundlagen der Inhaltsanalyse und beschreibt die verwendeten Verfahren, die Stichprobe und die Auswahlkriterien. Kapitel 7 präsentiert die Ergebnisse der Inhaltsanalyse, die verschiedene Aspekte der Berichterstattung über den Terroranschlag von Madrid untersuchen, wie z. B. den Umfang der Berichterstattung, die Personalisierung, den Einfluss von Nachrichtenagenturen und den Einsatz von „affective labeling”.
Das abschließende Kapitel 8 fasst die Ergebnisse zusammen und diskutiert die Ergebnisse im Kontext der Forschungsliteratur. Es beleuchtet die Bedeutung der Medien für die Konstruktion von Terrorismus und die Herausforderungen, die sich aus der medialen Darstellung von Terrorismus ergeben.
Schlüsselwörter
Terrorismus, islamischer Fundamentalismus, Massenmedien, Inhaltsanalyse, Nachrichtenselektion, Nachrichtenwerttheorie, 'war on terrorism', 'affective labeling', Personalisierung, Konstruktion sozialer Probleme, gesellschaftliche Wirklichkeit, Madrid, 11. März 2004, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurter Rundschau, New York Times.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Hauptthema der Studie von Jan Mewes?
Die Studie untersucht die internationale Berichterstattung über den Terroranschlag in Madrid vom 11. März 2004 durch eine vergleichende Inhaltsanalyse deutscher und US-amerikanischer Qualitätszeitungen.
Welche Zeitungen wurden in der Analyse untersucht?
Analysiert wurden insgesamt 267 Artikel aus der "New York Times", der "Frankfurter Rundschau" und der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ).
Welche Rolle spielt der "war on terrorism" in der Arbeit?
Der Autor untersucht, ob und wie der von George W. Bush ausgerufene "Krieg gegen den Terror" als Deutungsrahmen (Newsframe) in der Berichterstattung genutzt wurde und ob Parallelen zu 9/11 gezogen wurden.
Wie differenzieren die Medien zwischen Islam und Islamismus?
Ein Schwerpunkt der Studie liegt auf der Analyse, inwiefern die Tageszeitungen zwischen dem islamischen Glauben und dem politisch motivierten islamistischen Terrorismus unterscheiden.
Wer wurde ursprünglich für den Anschlag verantwortlich gemacht?
Die damalige konservative Regierung unter Aznar beschuldigte zunächst die baskische Untergrundorganisation ETA, bevor sich islamistische Terroristen als Urheber herausstellten.
Welche theoretischen Ansätze nutzt der Autor?
Der Autor nutzt soziologische und historische Erklärungsansätze des islamistischen Terrorismus sowie die Nachrichtenwerttheorie und Konzepte zur Konstruktion sozialer Probleme.
- Citar trabajo
- Dipl.-Soz. Jan Mewes (Autor), 2005, Der Terroranschlag in Madrid 2004. Eine vergleichende Analyse der internationalen Berichterstattung, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/62050