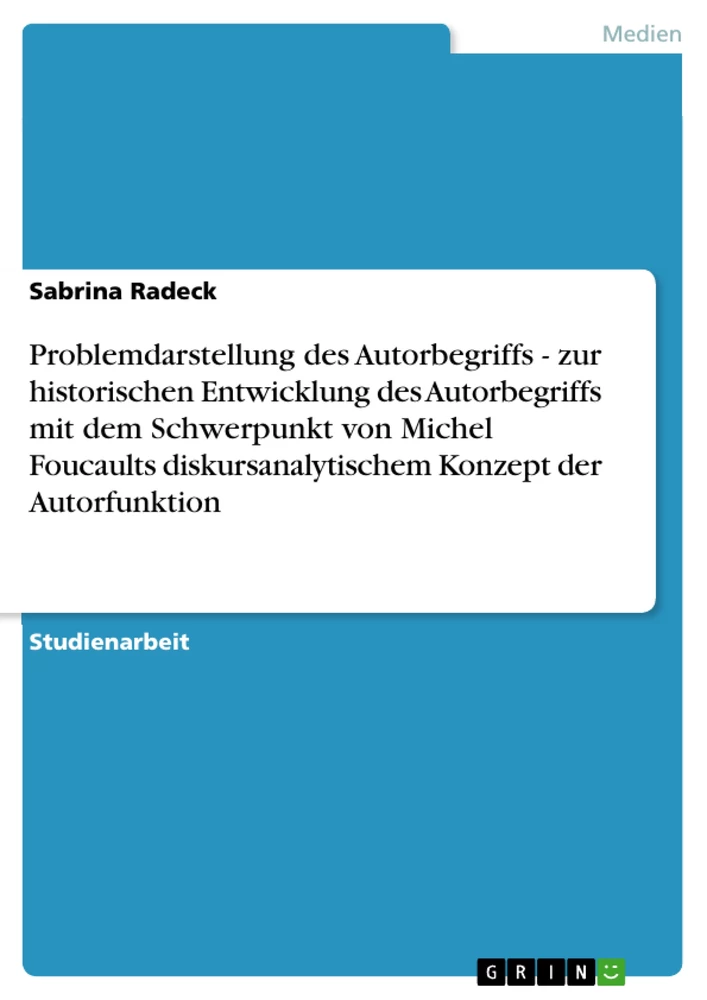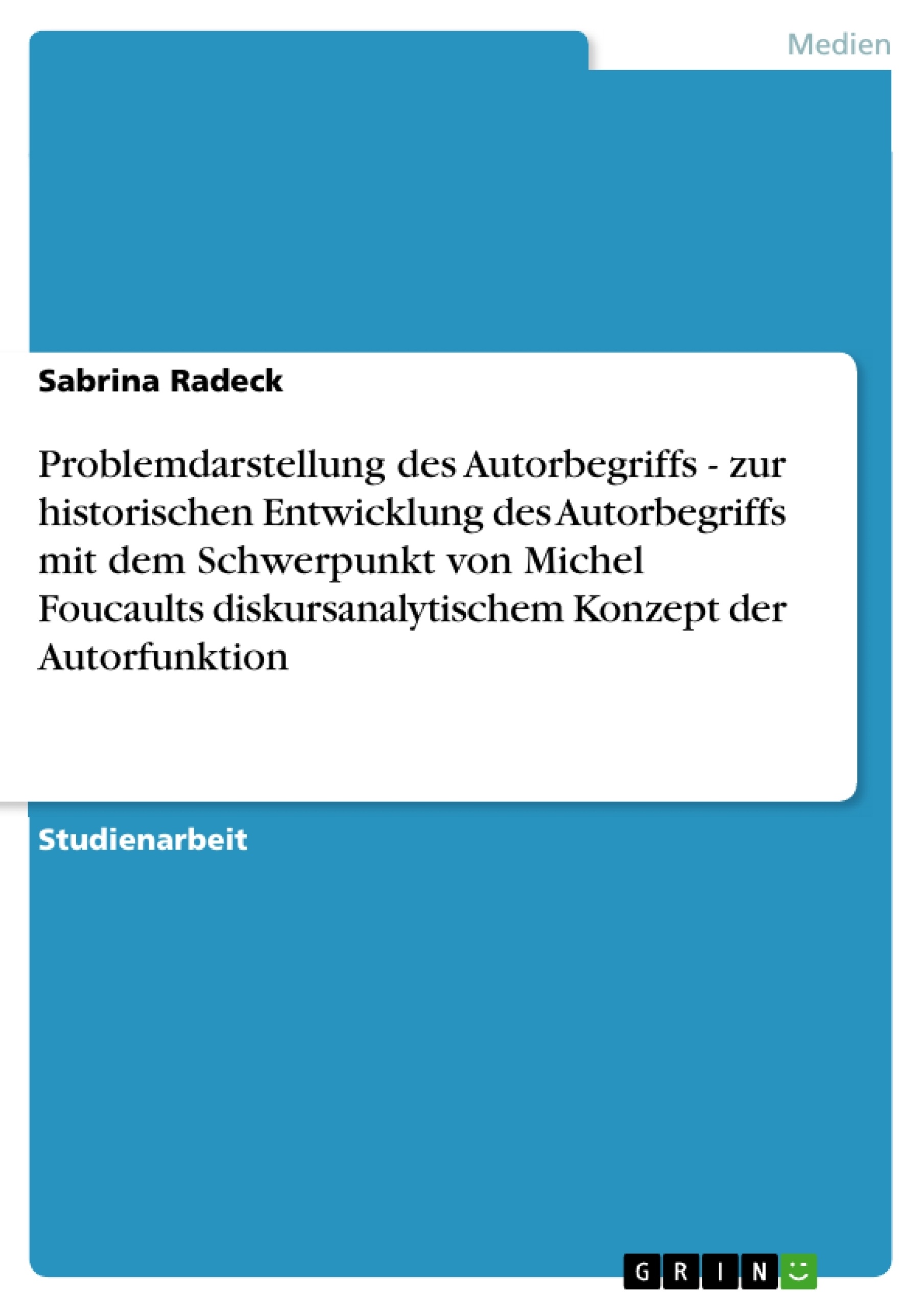Da es in der Geschichte seit der Antike nicht immer gleich um den Autor, seine Funktion und seinen Einfluss bestellt war, soll im folgenden Kapitel eine skizzenhafte Vorstellung verschiedener Autorenmodelle und des Urheberrechts vorgenommen werden. Foucault erwähnt diese historische Entwicklung lediglich, hier soll sie aber verdeutlichen, wie es zu der gegenwärtigen Funktion des Autors, die Foucault untersucht, gekommen ist. Welche Funktion der Autor in den Diskursen der Gegenwart übernimmt, oder unter welchen Bedingungen die Funktion eines Autors existieren kann, analysiert Foucault in seinem Vortrag „Was ist ein Autor?“, den er 1969 am Collège de France hielt. Ein Jahr zuvor hatte Roland Barthes seinen Aufsatz „Le mort de l’auteur“ veröffentlicht und die Diskussion um die Bedeutung der Autorbiographie für die Interpretation eines Werkes erneut belebt. Bevor es aber um die erwähnten Aufsätze, dabei schwerpunktmäßig um Foucaults Ansatz, gehen soll, wird im dritten Kapitel eine kurze Einführung in das strukturalistische und das poststrukturalistische Denken gegeben, denen Foucault und Barthes zugerechnet werden. Der zwischengeschaltete Exkurs zu Foucaults Subjektphilosophie soll die Parallelität des Status’ erklären, den das Subjekt und der Autor in der Moderne einnehmen. Dazu wird auf Foucaults Werk „Die Ordnung der Dinge“ (1966) in kurzer Form eingegangen. Der Schwerpunkt liegt hier auf dem Kapitel „Der Mensch und sein Doppel“, in dem Foucault darstellt, wie sich die Existenz des modernen Subjekts von der Renaissance über das klassische Zeitalter bis heute herausbilden konnte. Da Foucault in „Die Ordnung der Dinge“ dem Menschen, kaum dass er aufgetaucht ist, sein baldiges Verschwinden prophezeit, muss sich der Autor als Subjekt notwendig auch auflösen. Das vierte Kapitel hat deshalb das Verschwinden des Autors zum Thema, wobei sich mit Foucault zunächst herausstellen wird, dass er trotzdem und sogar in bereicherter Form als Funktion wieder auftaucht.
Im Schlusskapitel werden die vorherigen Analysen zusammengefügt. Dabei soll noch einmal besonders herausgestellt werden, ob der Autor um seine Existenz fürchten muss, wie er vielleicht weiterexistieren kann und was nötig wäre, damit er verschwindet.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Vom Werden des Autors
- Der technisch versierte und der göttlich inspirierte Dichter
- Mittelalterliche Anonymität
- Genialität muss geschützt werden
- Der Autor als variable Größe
- Das autorzentrierte Interpretationsmodell
- Das werkbezogene Interpretationsmodell
- Strukturalismus und Poststrukturalismus
- Exkurs: Ähnlichkeit, Repräsentation und Mensch
- Der Autor - lebendig begraben
- Schrift statt Autor
- Funktion statt Tod
- Kritik an den Lückenbüßern
- Autorname vs. Eigenname
- Merkmale der Autorfunktion
- Diskursivitätsbegründer
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit der historischen Entwicklung des Autorbegriffs und analysiert dabei insbesondere Michel Foucaults diskursanalytisches Konzept der Autorfunktion. Ziel ist es, die Entstehung und Veränderung des Autorbegriffs aufzuzeigen, um zu verstehen, welche Funktion der Autor im heutigen Diskurs einnimmt und unter welchen Bedingungen die Funktion eines Autors überhaupt existieren kann.
- Die Entwicklung der Autorfunktion von der Antike bis zur Moderne
- Die Bedeutung des Urheberrechts für die Entstehung der Autorintentionalität
- Foucaults Kritik an der Überbewertung der Autorbiographie für die Textinterpretation
- Das Verhältnis von Autor und Subjekt in der Moderne
- Die Frage nach dem Verschwinden des Autors und der Entstehung der Autorfunktion
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Autorbegriffs ein und stellt Foucaults Konzept der Autorfunktion vor. Kapitel 2 beleuchtet die historische Entwicklung des Autors von der Antike bis zur Moderne und zeigt auf, wie sich die Vorstellung von einem individuellen Schöpfer in der Literatur herausbildete. Das Kapitel fokussiert auf die Entstehung des Urheberrechts und die damit einhergehende Bedeutung der Autorintentionalität für die Textinterpretation. Kapitel 3 beschäftigt sich mit den strukturalistischen und poststrukturalistischen Ansätzen, die Foucaults Werk maßgeblich beeinflussen. Es bietet einen Exkurs zu Foucaults Subjektphilosophie, der die Parallelität des Status von Subjekt und Autor in der Moderne beleuchtet. Kapitel 4 thematisiert das Verschwinden des Autors und stellt dar, dass dieser trotz seines Verschwindens als Funktion wieder auftaucht. Das Kapitel analysiert verschiedene Aspekte der Autorfunktion, wie die Kritik an den Lückenbüßern, die Unterscheidung zwischen Autorname und Eigenname und die Merkmale der Autorfunktion.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Autorbegriff, der Autorfunktion, Michel Foucault, Diskursanalyse, Urheberrecht, Autorintentionalität, Strukturalismus, Poststrukturalismus, Subjektphilosophie, "Die Ordnung der Dinge", "Was ist ein Autor?", "Le mort de l'auteur".
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Michel Foucault unter der "Autorfunktion"?
Foucault sieht den Autor nicht als reale Person, sondern als eine Funktion des Diskurses, die dazu dient, Texte zu klassifizieren, zu gruppieren und zu legitimieren.
Wie hat sich der Autorbegriff historisch entwickelt?
Die Vorstellung wandelte sich vom göttlich inspirierten Dichter der Antike über die mittelalterliche Anonymität bis hin zum modernen Konzept des schutzwürdigen Genies durch das Urheberrecht.
Was bedeutet Roland Barthes' These vom "Tod des Autors"?
Barthes argumentiert, dass die Biografie des Autors für die Interpretation eines Werkes irrelevant sein sollte und der Fokus allein auf dem Text und dem Leser liegen muss.
Welche Rolle spielt das Urheberrecht für den Autorbegriff?
Das Urheberrecht institutionalisierte die Autorintentionalität und machte den Autor rechtlich für seine Texte verantwortlich, was die moderne Autorfunktion erst ermöglichte.
Was ist der Unterschied zwischen Autorname und Eigenname?
Ein Eigenname bezeichnet eine reale Person, während ein Autorname eine diskursive Funktion erfüllt und eine bestimmte Erwartungshaltung an den Textinhalt knüpft.
- Quote paper
- Sabrina Radeck (Author), 2005, Problemdarstellung des Autorbegriffs - zur historischen Entwicklung des Autorbegriffs mit dem Schwerpunkt von Michel Foucaults diskursanalytischem Konzept der Autorfunktion , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/62242