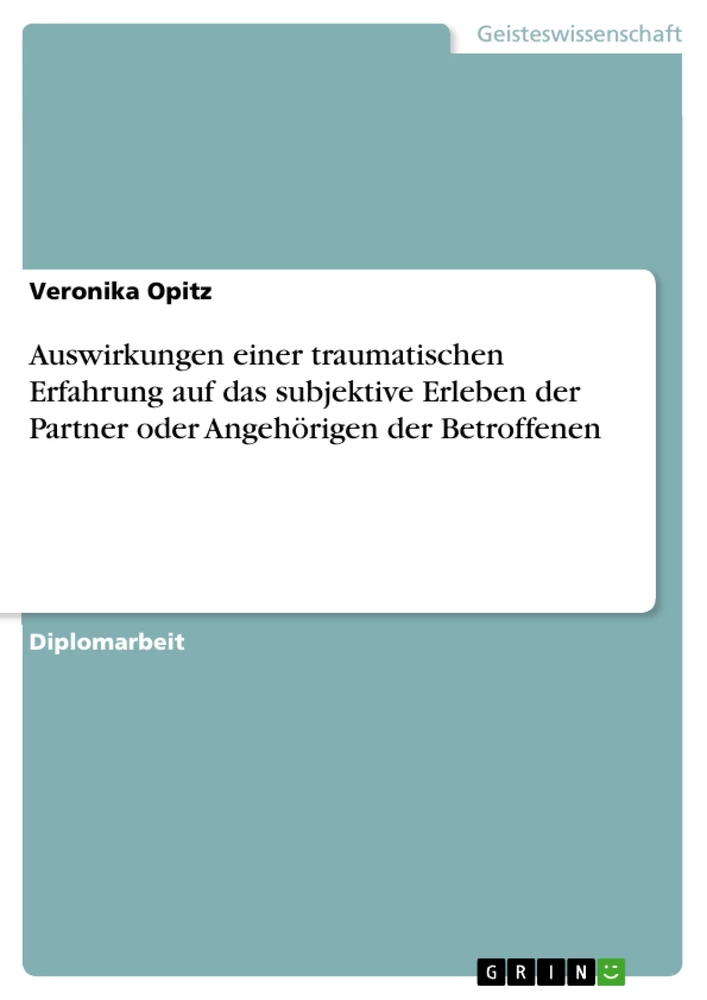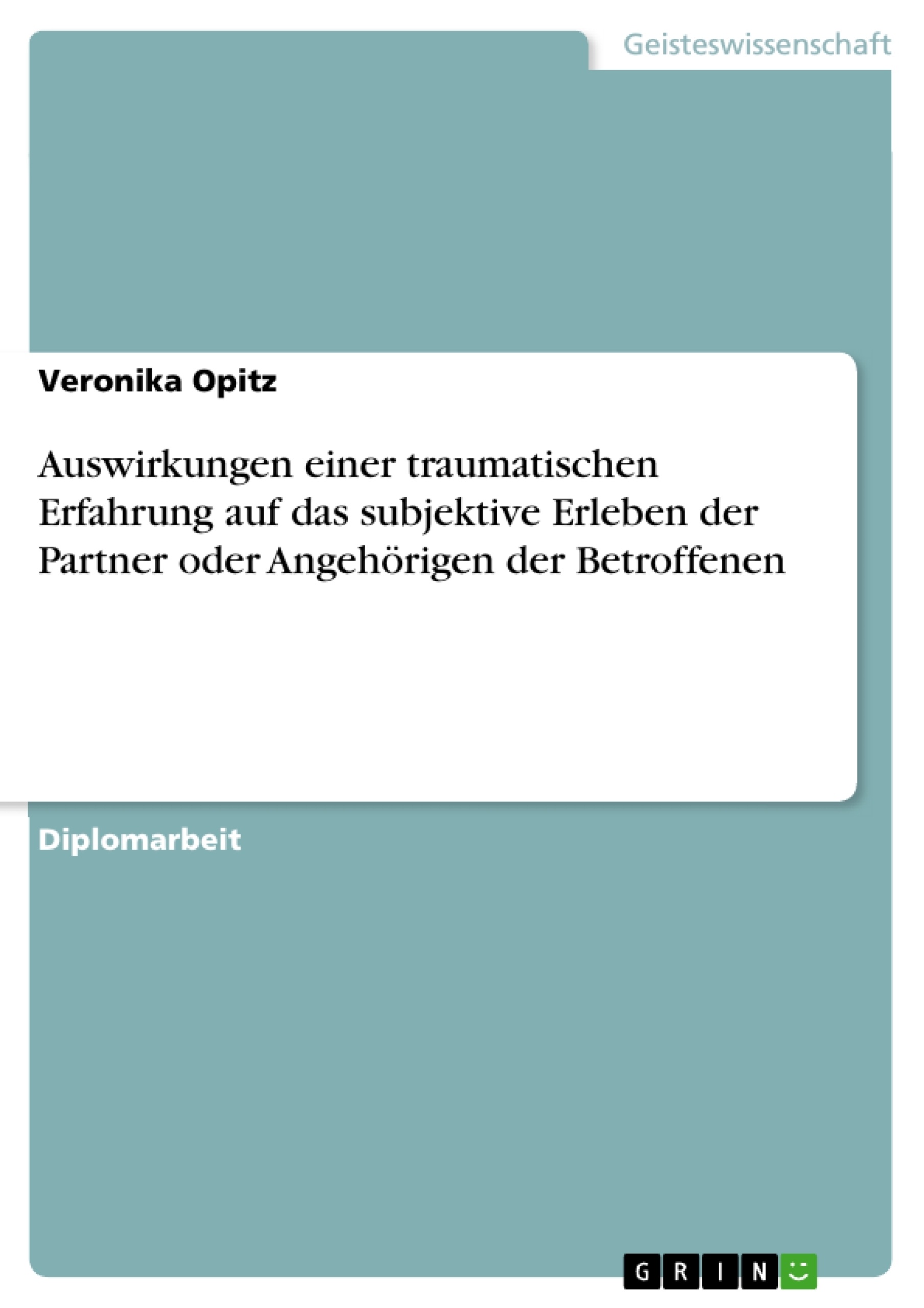Die Idee zu dieser Diplomarbeit hatte einen langen Vorlauf. Schon seit langer Zeit galt mein Interesse den menschlichen Folgen von Katastrophen, im großen wie im kleinen. Ausgelöst wurde dieses Interesse durch die Flugschau-Katastrophe von Ramstein. Die Meldungen darüber fesselten meine Aufmerksamkeit über einige Tage, ähnlich den Ereignissen des Zugunglückes von Eschede und der WTC-Katatstrophe. Viele Fragen gingen mir durch den Kopf: Was geschieht dort mit den Menschen? Erhalten sie genug Hilfe? Wer kümmert sich um die Retter, wenn sie verzweifelt am Wegrand sitzen bleiben? Wie geht es den Angehörigen der Primär-Betroffenen, wer kümmert sich um sie?
Im Rahmen meiner Diplomarbeit wollte ich nun eine dieser Fragen untersuchen. Meine Wahl fiel auf die Betrachtung der Gruppe der erwachsenen Angehörigen (wobei ich die Ehe- und Lebenspartner mit einschließe) von Primär-Betroffenen, denn diese sind, wie ich noch aufzeigen werde, vor allem in Deutschland noch kaum erforscht.
Bislang galt das wissenschaftliche und auch öffentliche Interesse in erster Linie natürlich den Betroffenen. Außerdem begann man sich zu fragen, wie es wohl den Helfern vor Ort gehen könnte, den Feuerwehrleuten, Notärzten oder Polizisten. Forschungsarbeiten zu diesem Thema gelangten regelmäßig zu dem Schluß, dass diese Personengruppe ebenso traumatisiert und in der Folge eine posttraumatische Belastungsstörung ausbilden kann, wie die Hauptbetroffenen (siehe Maercker/Pieper, 1999 u. Stamm, 2002).
Die Situation der Angehörigen bleibt weiterhin im dunkeln. Zwar perfektioniert sich die Kette derer, die Menschen in Unglückssituationen zu Hilfe eilen, zu nennen wären hier die Notärzte, Sanitäter, Feuerwehren und weiterhin Notfallpsychologen. Eine Aufgabe der Notfallpsychologen ist u.a. die Begleitung und Betreuung von Angehörigen während und nach der Überbringung einer Todes- oder Unfallnachricht. Die Betreuung erstreckt sich auf maximal eine Woche (Berliner Krisendienst).
In das Feld der Betrachtung rücken die Angehörigen dann erst wieder bei der Behandlung des Posttraumatischen Belastungssyndrom's ihrer nahen Verwandten oder Partner. Hier wird ihnen die schwierige Situation des Erkrankten ausführlich erklärt, denn es hat sich gezeigt, dass das soziale Netz um einen Traumatisierten herum von äußerster Wichtigkeit ist (Fischer, 2000).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Anstoß zu diesem Thema
- Aufbau und Überblick über die Arbeit
- Theoretischer Teil
- Kapitel 1 - Der Traumatisierte
- Das Trauma
- Kritische Lebensereignisse
- Trauma
- Typ I/II Traumatisierungen
- Historie
- Reaktionsweisen
- Häufigkeiten und Komorbiditäten
- Unfälle
- Lagererfahrungen
- Sekundäre Traumatisierung
- Behandlungsmöglichkeiten
- Kapitel 2 - Der Angehörige
- Inhalt der Untersuchung
- Der Angehörige in der Psychotraumatologischen Forschung
- Exkurs: Sekundäre vs. Teritäre Traumatisierung
- Definition der Sekundären Traumatisierung
- Theorie der Entstehung von Sekundärer Traumatisierung bei Angehörigen
- Compassion Fatigue
- Der Angehörige in der Therapie des Traumatisierten
- Das System Familie
- Familiäre Bewältigung
- Das ABCX Modell
- Bedeutung des Traumas für das Zusammenleben
- Generationseffekt/ Familienaufgaben
- Eigene Emotionen
- Methodenteil
- Kapitel 3 - Die Durchführung der Untersuchung
- Qualitative Sozialforschung
- Die Grounded Theory
- Das Problemzentrierte Interview
- Bestandteile des Interviews
- Der Interviewleitfaden
- Festlegung der Stichprobe
- Einschlusskriterien
- Ausschlusskriterien
- Stichprobengröße
- Rekrutierung
- Durchführung der Interviews
- Computergestütze Auswertung
- Gütekriterien
- Ergebnisteil
- Kapitel 4 – Die Darstellung der Ergebnisse
- Die Ergebnisse
- Personenbezogene Daten
- Die Interviewpartner
- Das Paradigmatische Modell
- Das Kernphänomen: Enttäuschung/ Frustration des Anlehnungsbedürfnisses
- Ursächliche Bedingungen
- Emotionen Unerreichbarkeit des Traumatisierten
- Traumabedingte Isolation des Traumatisierten
- Seelische und gesundheitliche Traumafolgen
- Intervenierende Bedingungen
- Gesicherte Versorgung vs. Existenzsorgen
- Gute vs. schlechte Therapie
- Soziales Umfeld
- Kontext
- Interaktion mit dem Traumatisierten
- Bekanntes Trauma
- Traumabewertung durch den Angehörigen
- Unbekanntes Trauma
- Überforderung durch Leistungsanspruch
- Mehrbelastung durch Aufgabenübernahme
- Pflichtbewusstsein
- Schuld und Scham
- Emotionale Kontamination
- Handlungs- und Interaktionalen Strategien
- Gespräche und andere Integrationsversuche
- Konfliktvermeidung
- Leugnung eigener Belastung
- Versuch der aktiven Bewältigung
- Interaktiv
- Individuell
- Hilfe von außen
- Konsequenzen
- Partnerschaftliche Bewältigung
- Wünsche
- Trost durch überleben
- Akzeptanz der bestehenden Bedingungen
- Autonomiezuwachs
- Unzufriedenheit mit der partnerschaftlichen Beziehung
- Fatalismus
- Selbstüberforderungstendenzen
- Zusammenfassung der Ergebnisse
- Kapitel 5 – Die Diskussion der Ergebnisse
- Geltungsbereich
- Repräsentativität
- Sättigung
- Methodendiskussion
- Grounded Theory
- Problemzentriertes Interview
- Diskussion der Befunde
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die subjektiven Erfahrungen von erwachsenen Angehörigen von Menschen, die traumatische Erlebnisse durchgemacht haben. Der Fokus liegt dabei auf der emotionalen und psychischen Belastung, die Angehörige erfahren, sowie auf ihren Bewältigungsstrategien. Die Arbeit will zum Verständnis der Herausforderungen beitragen, die Angehörige in dieser Situation bewältigen müssen.
- Die Auswirkungen von Trauma auf das subjektive Erleben von Angehörigen
- Die Entstehung von Sekundärer Traumatisierung bei Angehörigen
- Die Rolle des sozialen Netzwerks im Kontext von Trauma
- Bewältigungsstrategien von Angehörigen
- Die Bedeutung der eigenen Emotionen und des Anlehnungsbedürfnisses
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert die Relevanz der Untersuchung. Es wird auf die Forschungslücke im Bereich der Angehörigen von Traumatisierten hingewiesen und die Zielsetzung der Arbeit dargelegt.
Im ersten Kapitel wird das Trauma aus psychologischer Perspektive beleuchtet. Es werden verschiedene Arten von Traumatisierungen, die Entstehung und Folgen sowie mögliche Behandlungsmöglichkeiten vorgestellt.
Kapitel 2 widmet sich dem Angehörigen. Es wird die Rolle des Angehörigen in der Psychotraumatologischen Forschung und die Definition der Sekundären Traumatisierung erläutert. Die Entstehung von Compassion Fatigue und die Bedeutung des Familiensystems im Kontext der Bewältigung von Trauma werden ebenfalls behandelt.
Der Methodenteil beschreibt die qualitative Forschung, die in der Arbeit angewendet wurde. Es werden die Grounded Theory und das problemzentrierte Interview vorgestellt.
Kapitel 4 stellt die Ergebnisse der Untersuchung dar. Es wird ein Paradigmatisches Modell entwickelt, welches das Kernphänomen "Enttäuschung/Frustration des Anlehnungsbedürfnisses" und seine ursächlichen und intervenierenden Bedingungen beleuchtet. Die Ergebnisse werden in Bezug auf die Handlungs- und Interaktionalen Strategien der Angehörigen interpretiert.
Schlüsselwörter
Traumatisierung, Sekundäre Traumatisierung, Angehörige, Traumafolgen, Compassion Fatigue, Familiensystem, Bewältigungsstrategien, Qualitative Sozialforschung, Grounded Theory, Problemzentriertes Interview.
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine sekundäre Traumatisierung?
Sekundäre Traumatisierung beschreibt die psychische Belastung von Angehörigen oder Helfern, die durch den engen Kontakt mit einer primär traumatisierten Person ähnliche Symptome wie eine posttraumatische Belastungsstörung entwickeln.
Was bedeutet der Begriff „Compassion Fatigue“?
Compassion Fatigue oder Mitgefühlsmüdigkeit bezeichnet die emotionale Erschöpfung, die entsteht, wenn Angehörige über lange Zeit die traumatischen Erlebnisse eines Partners miterleben und mitleiden.
Wie wirkt sich ein Trauma auf das Anlehnungsbedürfnis in der Partnerschaft aus?
Ein Kernphänomen ist die Frustration des Anlehnungsbedürfnisses. Angehörige fühlen sich oft emotional isoliert, da der Traumatisierte aufgrund seiner eigenen Belastung emotional unerreichbar sein kann.
Welche Rolle spielt das soziale Umfeld für Traumatisierte und ihre Familien?
Ein stabiles soziales Netz ist entscheidend für die Bewältigung. Isolation hingegen verstärkt die Belastung für das gesamte Familiensystem und kann die Heilung verzögern.
Welche Bewältigungsstrategien nutzen Angehörige?
Strategien reichen von aktiver Suche nach Hilfe und Gesprächen über Konfliktvermeidung bis hin zur Leugnung der eigenen Belastung, um den Partner zu schonen.
- Quote paper
- Veronika Opitz (Author), 2004, Auswirkungen einer traumatischen Erfahrung auf das subjektive Erleben der Partner oder Angehörigen der Betroffenen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/62646