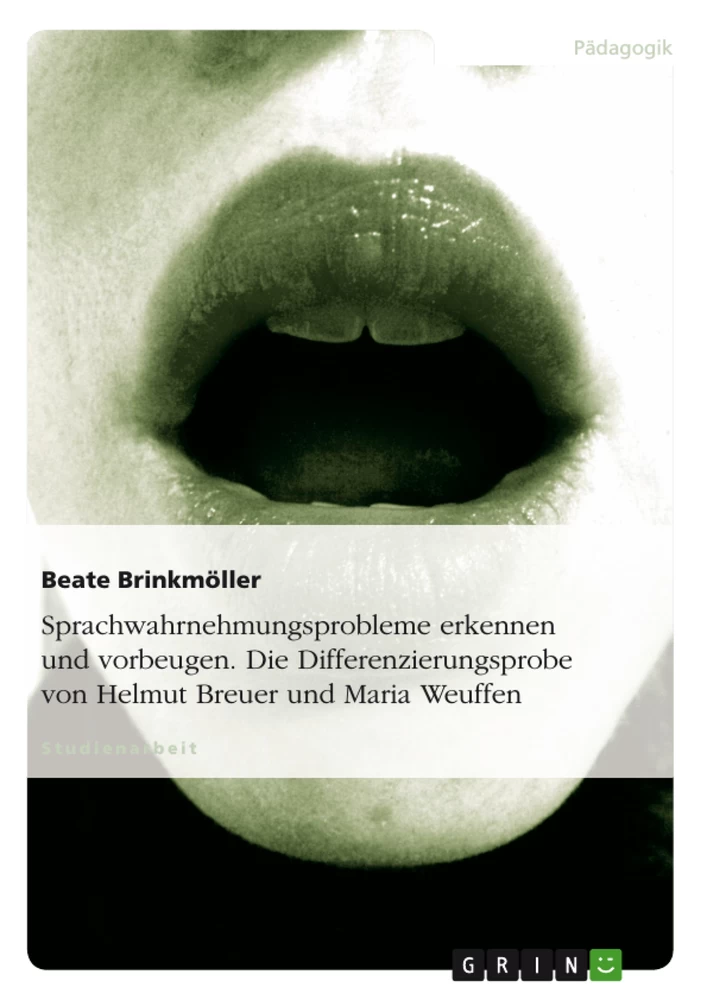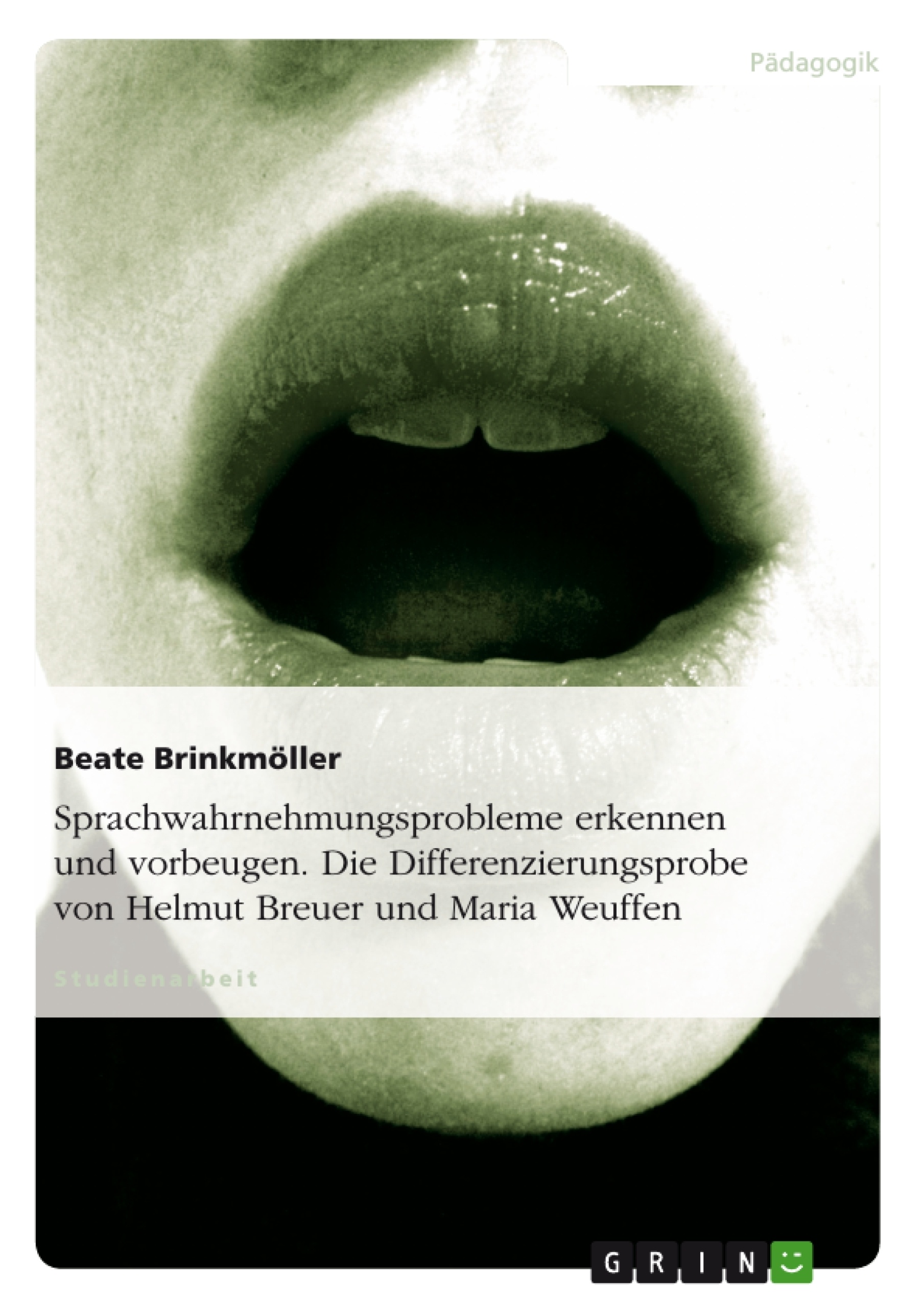Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Beurteilung der Differenzierungsprobe von Helmut Breuer und Maria Weuffen, einem Testverfahren zur Ermittlung von Sprachwahrnehmungsleistungen.
Sie bezieht sich auf das Buch "Lernschwierigkeiten am Schulanfang, Schuleingangsdiagnostik zur Früherkennung und Frühförderung" von Breuer und Weuffen, erschienen im Beltz Verlag, Weinheim und Basel, 2000.
Hintergründe der Förderdiagnostik werden erläutert, sowie Gründe für eine frühzeitige Feststellung von Entwicklungsbelastungen aufgezeigt. Die Diagnostik mit Hilfe der Differenzierungsprobe wird kritisch betrachtet: Welche Vor- und Nachteile bietet sie und welche Grenzen und Möglichkeiten ergeben sich?
Inhaltsverzeichnis
- 1. Problemstellung
- 2. Diagnostik im Wandel
- 3. Schuleingangsdiagnostik zur Früherkennung und Förderung nach Breuer und Weuffen
- 3.1 Gründe für eine frühzeitige Feststellung des Förderbedarfs
- 3.2 Die Differenzierungsproben
- 3.2.1 Voraussetzungen
- 3.2.2 Überprüfen der optisch-graphomotorischen Differenzierungsfähigkeit
- 3.2.3 Überprüfen der phonematisch-akustischen Differenzierungsfähigkeit
- 3.2.4 Überprüfen der kinästetisch-artikulatorischen Differenzierungsfähigkeit
- 3.2.5 Überprüfen der melodisch-intonatorischen Differenzierungsfähigkeit
- 3.2.6 Überprüfen der rhythmisch-strukturierenden Differenzierungsfähigkeit
- 4. Beurteilung nach Gütekriterien
- 4.1 Objektivität
- 4.2 Reliabilität
- 4.3 Validität
- 4.4 Normierung
- 4.5 Durchführbarkeit
- 4.6 Ökonomie
- 5. Kritik und Grenzen der Förderdiagnostik
- 6. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Differenzierungsprobe von Breuer und Weuffen, ein Verfahren zur Erkennung von Sprachwahrnehmungsleistungen bei Kindern im Vorschul- und Schulalter. Ziel ist die kritische Betrachtung des Tests hinsichtlich seiner Vor- und Nachteile sowie der Grenzen und Möglichkeiten seiner Anwendung in der Förderdiagnostik.
- Frühzeitige Erkennung von Entwicklungsbelastungen im Bereich der Sprachwahrnehmung
- Bewertung der Differenzierungsprobe nach Gütekriterien
- Der Wandel der Diagnostik von der Selektions- zur Förderdiagnostik
- Die Bedeutung frühzeitiger Förderung für den Schulerfolg
- Kritisches Hinterfragen der Grenzen und Möglichkeiten des Testverfahrens
Zusammenfassung der Kapitel
1. Problemstellung: Die Arbeit untersucht die Differenzierungsprobe von Breuer und Weuffen, einen Test zur Erfassung von Sprachwahrnehmungsfähigkeiten. Sie beleuchtet den Hintergrund der Förderdiagnostik und die Notwendigkeit frühzeitiger Erkennung von Entwicklungsbelastungen, um den späteren Schulerfolg zu sichern. Die Arbeit kündigt eine kritische Betrachtung der Differenzierungsprobe an, inklusive der Analyse von Vor- und Nachteilen sowie der damit verbundenen Grenzen und Möglichkeiten.
2. Diagnostik im Wandel: Dieses Kapitel beschreibt den Wandel der diagnostischen Ansätze im 20. Jahrhundert. Es kontrastiert die frühere, defektorientierte Selektionsdiagnostik, die sich auf die Identifizierung individueller Defizite konzentrierte, mit der modernen Förderdiagnostik. Die Förderdiagnostik betrachtet schulische Probleme als komplexes Zusammenspiel verschiedener Faktoren und zielt auf Lernprozesse und die Veränderung von Problemsituationen ab. Der Fokus liegt auf dem ganzen Kind in seinem sozialen Kontext, inklusive der Rolle des Lehrers. Der Begriff "Entwicklungsbelastung" ersetzt den Begriff "Störung".
3. Schuleingangsdiagnostik zur Früherkennung und Förderung nach Breuer und Weuffen: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Notwendigkeit frühzeitiger Fördermaßnahmen bei Lese-Rechtschreib-Schwierigkeiten. Es argumentiert, dass zu spätes Eingreifen die Lernmotivation der Kinder negativ beeinflusst und zu langfristigen negativen Folgen für den Schulerfolg führt. Die frühzeitige Diagnose ermöglicht eine rechtzeitige Intervention und somit die Vermeidung von negativen Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl und den sozialen Status des Kindes. Das Kapitel betont die Bedeutung von proaktiven Maßnahmen, um den Schulerfolg langfristig zu sichern. Die Bedeutung der Differenzierungsproben wird im Kontext frühzeitiger Förderung und deren Auswirkungen auf den weiteren Verlauf der Schullaufbahn erläutert.
3.2 Die Differenzierungsproben: Dieser Abschnitt beschreibt die fünf von Breuer und Weuffen definierten Wahrnehmungsbereiche (optisch-graphomotorisch, phonematisch-akustisch, kinästhetisch-artikulatorisch, melodisch-intonatorisch und rhythmisch-strukturierend), auf denen die Differenzierungsproben basieren. Es werden drei Altersgruppen (vier- bis fünfjährig, fünf- bis sechsjährig, sechs- bis siebenjährig) und die jeweiligen Testverfahren (DP 0, DP I, DP II) vorgestellt. Die Bezugspunkte für die Bewertung (EU, NU, KU) werden erläutert, und der methodische Ansatz zur Bestimmung des altersgemäßen Schwierigkeitsgrades wird beschrieben. Zusammenfassend beschreibt dieser Abschnitt die Struktur und den Aufbau der Differenzierungsproben.
Schlüsselwörter
Differenzierungsprobe, Breuer, Weuffen, Förderdiagnostik, Schuleingangsdiagnostik, Sprachwahrnehmung, Lese-Rechtschreib-Schwäche, Entwicklungsbelastung, Früherkennung, Frühförderung, Gütekriterien, Objektivität, Reliabilität, Validität.
Häufig gestellte Fragen zur Differenzierungsprobe von Breuer und Weuffen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Differenzierungsprobe von Breuer und Weuffen, ein Verfahren zur Früherkennung von Sprachwahrnehmungsstörungen bei Kindern im Vorschul- und Schulalter. Sie untersucht die Vor- und Nachteile des Tests, seine Grenzen und Anwendungsmöglichkeiten in der Förderdiagnostik.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Wandel der Diagnostik von der Selektions- zur Förderdiagnostik, die Bedeutung frühzeitiger Förderung, die Bewertung der Differenzierungsprobe nach Gütekriterien (Objektivität, Reliabilität, Validität etc.) und eine kritische Auseinandersetzung mit den Grenzen des Testverfahrens. Es werden die verschiedenen Wahrnehmungsbereiche der Differenzierungsprobe (optisch-graphomotorisch, phonematisch-akustisch, kinästhetisch-artikulatorisch, melodisch-intonatorisch und rhythmisch-strukturierend) detailliert beschrieben.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Differenzierungsprobe von Breuer und Weuffen kritisch zu betrachten und ihre Eignung für die frühzeitige Erkennung von Entwicklungsbelastungen im Bereich der Sprachwahrnehmung zu bewerten. Der Fokus liegt auf der Beurteilung des Tests im Kontext der Förderdiagnostik und seiner Auswirkungen auf den Schulerfolg.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Problemstellung, Diagnostik im Wandel, Schuleingangsdiagnostik nach Breuer und Weuffen (inklusive detaillierter Beschreibung der Differenzierungsproben), Beurteilung nach Gütekriterien, Kritik und Grenzen der Förderdiagnostik und Fazit.
Wie werden die Differenzierungsproben beschrieben?
Die Differenzierungsproben werden im Detail beschrieben, inklusive der fünf Wahrnehmungsbereiche, der drei Altersgruppen (4-5, 5-6, 6-7 Jahre) und der jeweiligen Testverfahren (DP 0, DP I, DP II). Die Bewertungskriterien (EU, NU, KU) und die Bestimmung des altersgemäßen Schwierigkeitsgrades werden erläutert.
Was ist der Unterschied zwischen Selektions- und Förderdiagnostik?
Die Arbeit beschreibt den Wandel von der defektorientierten Selektionsdiagnostik (Fokus auf Defizite) zur Förderdiagnostik (Fokus auf Lernprozesse und die Veränderung von Problemsituationen). Die Förderdiagnostik betrachtet schulische Probleme als komplexes Zusammenspiel verschiedener Faktoren und berücksichtigt das ganze Kind in seinem sozialen Kontext.
Welche Bedeutung hat die Früherkennung von Sprachwahrnehmungsstörungen?
Die Arbeit betont die Wichtigkeit der frühzeitigen Erkennung von Sprachwahrnehmungsstörungen, um rechtzeitig Fördermaßnahmen einzuleiten und negative Auswirkungen auf die Lernmotivation, den Schulerfolg, das Selbstwertgefühl und den sozialen Status des Kindes zu vermeiden.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Differenzierungsprobe, Breuer, Weuffen, Förderdiagnostik, Schuleingangsdiagnostik, Sprachwahrnehmung, Lese-Rechtschreib-Schwäche, Entwicklungsbelastung, Früherkennung, Frühförderung, Gütekriterien, Objektivität, Reliabilität, Validität.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Pädagogen, Logopäden, Psychologen und alle anderen Fachkräfte, die im Bereich der frühkindlichen Förderung und Diagnostik tätig sind.
- Quote paper
- Beate Brinkmöller (Author), 2005, Sprachwahrnehmungsprobleme erkennen und vorbeugen. Die Differenzierungsprobe von Helmut Breuer und Maria Weuffen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/63488