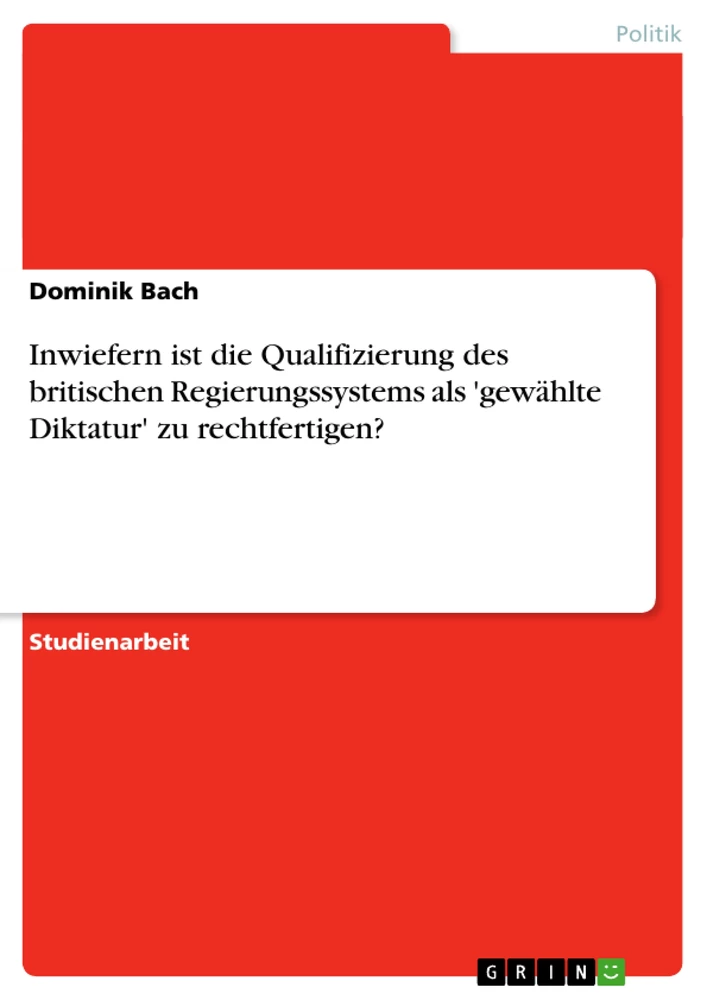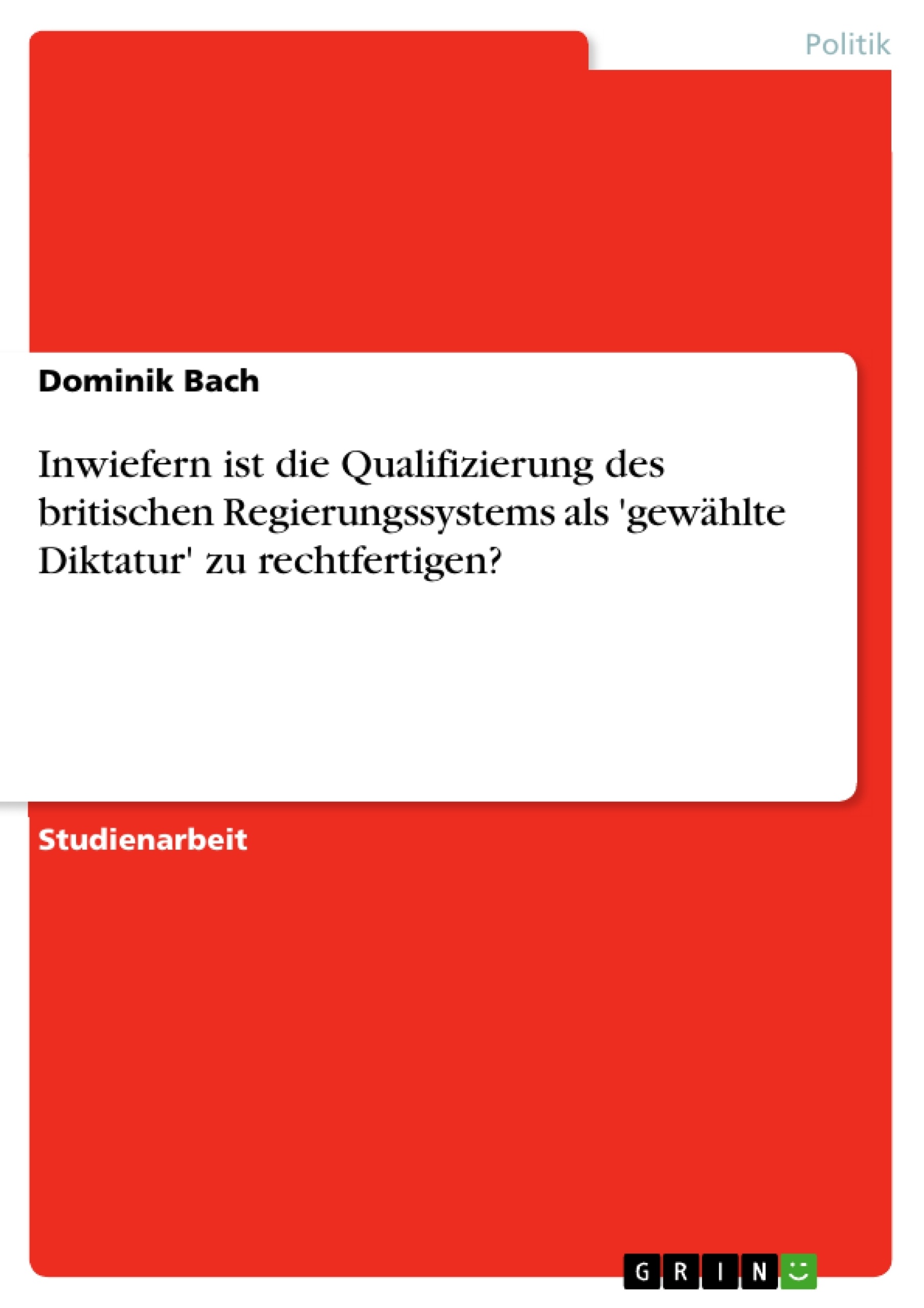Die Tatsache, dass der britische Premierminister seit der Entstehung des Amtes in den 40er Jahren des 18. Jahrhunderts spürbar an Macht und Einfluss gewonnen hat, steht außer Frage. Diesen Machtzuwachs verdeutlicht bereits die zunehmende Fülle an Literatur, die sich insbesondere wieder seit der Ära Thatcher mit diesem Thema auseinandersetzt und die Stellung des Premierministers im Institutionsgefüge der britischen Verfassung näher untersucht. In diesem Zusammenhang wird häufig von einer "British presidency", also einer britischen Präsidentschaft oder von einer "Präsidentialisierung des Westminster Modells" gesprochen. Eine simple Analogie muss jedoch zwangsläufig an der Verschiedenheit der beiden Systeme - des präsidialen auf der einen und des parlamentarischen auf der anderen Seite - scheitern. Kritiker der heutigen Machstellung des Premierministers sprechen daher immer häufiger von einer "Autokratie" des britischen Kabinetts, oder, wenn man das Kabinett als ein vom Premierminister dominiertes Organ ansieht, von einer "elective dictatorship", einer gewählten Diktatur. In dieselbe Richtung weist Leslie Wolf-Phillips wenn er das Westminster Modell als autoritäre Ein-Parteien-Regierung in einem vom Premierminister dominierten und mit disziplinierten Parteien besetztem Unterhaus beschreibt.
Gerade angesichts solcher Stimmen erscheint es unerlässlich die einzelnen Faktoren, welche den Machtzuwachs des britischen Premierministers ermöglicht oder begünstigt haben näher zu betrachten. Hierzu zählen sicherlich unter anderem das Fehlen einer kodifizierten Verfassung, das Konzept der Parlamentssouveränität und das britische Mehrheitswahlrecht. Faktoren also, die auf den ersten Blick den Premierminister und seine Stellung gar nicht berühren. Bei näherer Betrachtung wird sich jedoch zeigen, dass gerade diese Faktoren es überhaupt ermöglicht haben, dass der Premierminister heute solch eine überragende Stellung im britischen Institutionsgefüge einnimmt.
Dies mag aus der Sicht kontinental-europäischer parlamentarischer Demokratien nach dem Vorbild des Westminster Modells zunächst beruhigend klingen, da die oben aufgeführten Faktoren Eigenarten des britischen Systems darstellen. Das kann aber nicht über die Tatsache hinweg täuschen, dass Tendenzen zu einer Stärkung des Regierungschefs beispielsweise auch in Deutschland ausgemacht worden sind. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Die Entstehungsgeschichte des Premierministeramtes in Großbritannien
- II. Relevante Eckpfeiler des britischen Verfassungsgefüges heute
- 1. Die drei traditionellen Quellen der Verfassung
- a) Das Statute law
- b) Das Common law
- c) Die Constitutional Conventions
- 2. Das Paradigma der Parlamentssouveränität
- 1. Die drei traditionellen Quellen der Verfassung
- III. Einzelne Machtfaktoren
- 1. Die Parlamentssouveränität als primärer Faktor?
- a) Aufstellung der Dominanzthese
- b) Überprüfung der Dominanzthese
- i) Das Verhältniswahlrecht
- ii) Die fehlende Kontrollmöglichkeit des Parlaments
- iii) Verantwortlichkeit der Minister
- iv) Die Fraktionsdisziplin
- v) Burmah Oil als Beispiel für einen Machtmissbrauch
- c) Bestätigung der Dominanzthese
- 2. Weitere Machtfaktoren
- a) Der Beraterstab des Premierministers
- i) Das Büro des Premierministers
- ii) Das Cabinet Office
- iii) Fazit
- b) Die Anforderungen der Öffentlichkeit
- a) Der Beraterstab des Premierministers
- 1. Die Parlamentssouveränität als primärer Faktor?
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die zunehmende Macht des britischen Premierministers und die Frage, ob diese Entwicklung zu einer „gewählten Diktatur“ führt. Sie analysiert die historische Entwicklung des Premierministeramtes, relevante Aspekte der britischen Verfassung und die Rolle der Parlamentssouveränität.
- Die Entstehung und Entwicklung des Premierministeramtes in Großbritannien
- Die Relevanz des britischen Verfassungsgefüges und die drei traditionellen Quellen der Verfassung
- Die Rolle der Parlamentssouveränität als Machtfaktor
- Die Dominanz des Premierministers im Unterhaus
- Weitere Machtfaktoren, wie der Beraterstab des Premierministers und die Anforderungen der Öffentlichkeit
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit befasst sich mit der wachsenden Macht des britischen Premierministers und der Frage, ob diese zu einer „gewählten Diktatur“ führt.
- I. Die Entstehungsgeschichte des Premierministeramtes in Großbritannien: Dieses Kapitel gibt einen historischen Überblick über die Entstehung und Entwicklung des Premierministeramtes in Großbritannien.
- II. Relevante Eckpfeiler des britischen Verfassungsgefüges heute: Dieses Kapitel erläutert die relevanten Eckpfeiler der britischen Verfassung, insbesondere die drei traditionellen Quellen der Verfassung (Statute law, Common law und Constitutional Conventions) sowie das Konzept der Parlamentssouveränität.
- III. Einzelne Machtfaktoren: Dieses Kapitel analysiert die Rolle der Parlamentssouveränität als primärer Faktor für die Macht des Premierministers, untersucht das Verhältniswahlrecht und die fehlende Kontrollmöglichkeit des Parlaments und beleuchtet die Verantwortlichkeit der Minister und die Fraktionsdisziplin.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen der britischen Politik und Verfassung, insbesondere mit der Macht des Premierministers, der Parlamentssouveränität, dem britischen Wahlrecht und dem Westminster-Modell. Weitere wichtige Begriffe sind die „gewählte Diktatur“, die „British presidency“ und die „Präsidentialisierung des Westminster Modells“.
Häufig gestellte Fragen
Warum wird das britische Regierungssystem als „gewählte Diktatur“ bezeichnet?
Der Begriff (elective dictatorship) beschreibt die enorme Machtfülle des Premierministers, der durch eine disziplinierte Mehrheit im Unterhaus fast ungehindert regieren kann.
Welchen Einfluss hat das Fehlen einer kodifizierten Verfassung?
Ohne eine geschriebene Verfassung basieren viele Regeln auf Konventionen, was der Exekutive unter Ausnutzung der Parlamentssouveränität große Spielräume lässt.
Was versteht man unter „Parlamentssouveränität“?
Das Prinzip, dass das Parlament das höchste gesetzgebende Organ ist und kein Gesetz durch ein Gericht (wie ein Verfassungsgericht) für ungültig erklärt werden kann.
Wie fördert das britische Wahlrecht die Macht des Premierministers?
Das Mehrheitswahlrecht führt meist zu klaren Ein-Parteien-Regierungen, was Koalitionszwänge vermeidet und die Position des Regierungschefs stärkt.
Was ist die „Präsidentialisierung“ des Westminster-Modells?
Es beschreibt den Trend, dass der Premierminister zunehmend wie ein Präsident agiert, sich auf einen eigenen Beraterstab stützt und im Zentrum der medialen Aufmerksamkeit steht.
- Arbeit zitieren
- Dominik Bach (Autor:in), 2002, Inwiefern ist die Qualifizierung des britischen Regierungssystems als 'gewählte Diktatur' zu rechtfertigen?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/6375