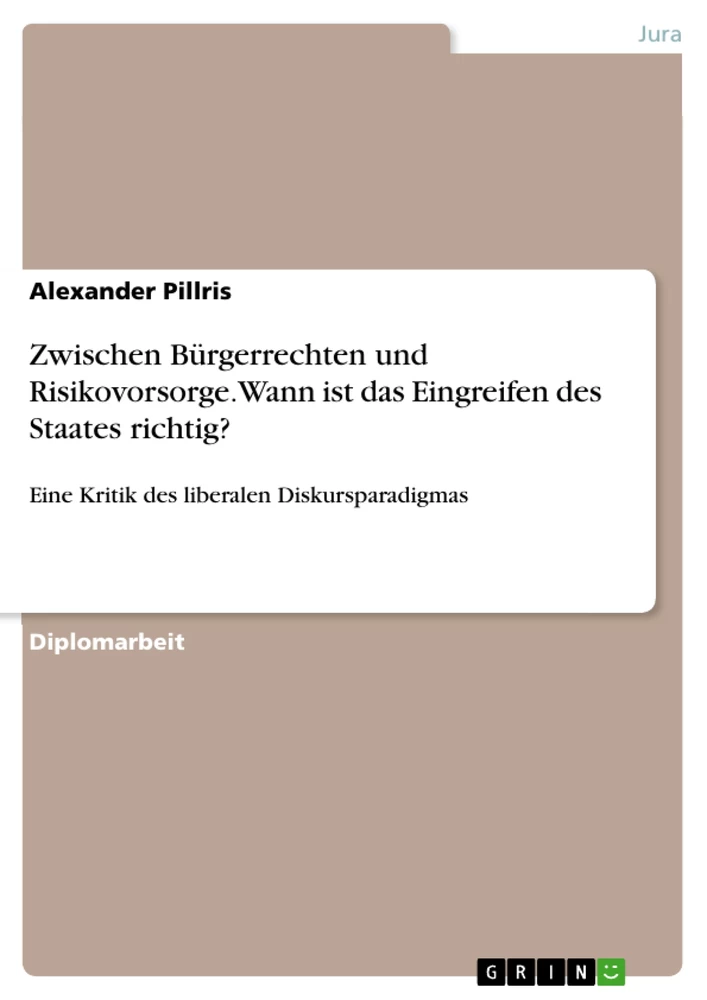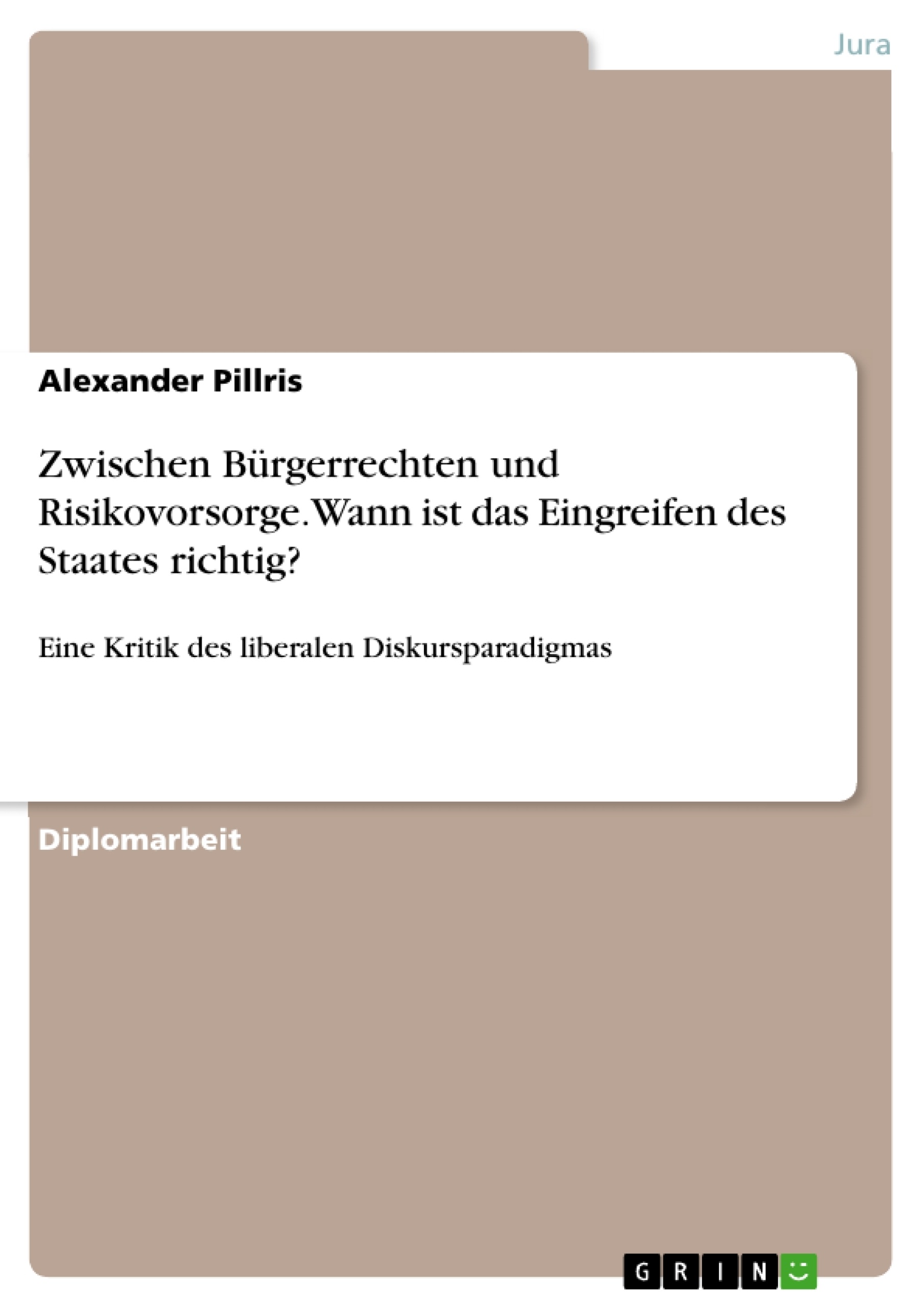Die bis dahin beispiellosen islamistisch motivierten terroristischen Anschläge vom 11.09.2001 auf Ziele in den USA gelten mit ihren weitreichenden politischen und gesellschaftlichen Implikationen weithin (berechtigterweise) als zeitlicher Wendepunkt auch der deutschen Rechtsentwicklung.
Richtete sich bis dahin die bundesdeutsche Anti-Terrorgesetzgebung noch vornehmlich gegen den binnenstaatlichen RAF-Terrorismus, der in der Nachschau doch mit einem Mindestmaß an Täterrationalität und Vorhersehbarkeit ausgestattet war, markieren die Anschläge vom 11.09.2001 eine grundlegend neue Risikolage. So kann dem nunmehr transnational operierenden und religiös fanatisierten Terrorismus eben keine Rationalität mehr eingeräumt werden; seine Aktionen sind zudem nahezu vollkommen unvorhersehbar. Angesichts der neuen Qualität der Bedrohung ändert sich auch die Qualität der legislativen Anti-Terrormaßnahmen.
Hier gilt nun ein „ganzheitlicher Bekämpfungsansatz“, der, im Gegensatz zur vormaligen Anti-Terrorgesetzgebung, eine Vielzahl von eben nicht originär sicherheitspolitischen Rechtsgebieten betrifft, und zunehmend sogar nichtstaatliche Akteure umfasst (beispielsweise durch die Verpflichtung von Telekommunikationsanbietern oder Finanzdienstleistern zu einer verstärkten Informationsvorsorge). Daneben wird die Terrorismusbekämpfung nunmehr als Gegenstand eines „Mehr-Ebenen-Systems der Rechtserzeugung“ betrieben. Der „ganzheitliche Ansatz“ wird nicht nur durch die nationale Gesetzgebung verfolgt, sondern auch in erheblichem Maße durch inter-und supranationale Akteure induziert. Es geht hierbei kaum noch um die klassischen Strategien der präventiven polizeilichen Gefahrenabwehr und repressiver Strafverfolgung, stattdessen „wird der Ausweg in einer Ausweitung und Verselbstständigung der Informationsvorsorge gesucht.“
Der ganzheitliche Bekämpfungsansatz im Mehr-Ebenen-System spiegelt sich in der bundesdeutschen Rechtsentwicklung ab dem 11.09.2001 wieder, die ebenfalls vermehrt auf Informationsvorsorge abzielt. Dadurch soll ein terroristischer Anschlag mit seinen verheerenden Folgen möglichst frühzeitig verhütet werden. Nach allgemeinem Dafürhalten ist die herkömmliche polizeiliche Prävention hier eher ungeeignet, da sie - auch in Anbetracht der bedrohten Rechtsgüter - zu spät komme, und ebenso eine Strafverfolgungnacheinem Anschlag nachrangig sei.
Inhaltsverzeichnis
- A Einführung
- I. Fragestellung und Erkenntnisinteresse
- II. Methodik und Quellenlage
- III. Zentrale Definitionen
- B Die Begriffe „Sicherheit“, „Rechtsstaat“ und „Bürgerrechte“..als Variablen vorherrschender gesellschaftlicher Paradigmen
- I. Die Verwendung im „liberalen Paradigma“
- II. Die Verwendung im „sozialen Paradigma“
- III. Die zunehmende Überlagerung durch das ,,Paradigma der Risikogesellschaft“
- IV. Die mangelnde Rezeption der Begriffsvarianz im sicherheitsrechtlichen Diskurs
- C Ausgangspunkt: Der „klassische“ Bundesnachrichtendienst im liberalen Paradigma bis 1994
- I. Der BND innerhalb der Sicherheitsarchitektur Deutschlands unter besonderer Berücksichtigung des Trennungsgebotes
- II. Formale und materielle Rechtsgrundlagen des BND
- 1.Verfassungsrechtliche Grundlagen: Legitimation und Gesetzgebungskompetenz
- 2.Gesetzliche Aufgabenbereiche des BND nach dem BND-Gesetz
- 3. Gesetzliche Befugnisse zum Eingriff in die Grundrechte nach Art. 10 GG (Gesetz G 10)
- a) Zum Schutzbereich von Art. 10 GG
- b) Das Gesetz G 10 in der Fassung von 1991
- 4. Die parlamentarische Kontrolle des BND
- a) Die Parlamentarische Kontrollkommission
- b) Das G 10-Gremium
- c) Die G 10-Kommission
- III. Die praktische Arbeitsweise des BND
- IV. Die ersten Befugniserweiterungen
- 1. Erweiterung der Kontrollbefugnisse der Parlamentarischen Kontrollkommission
- 2. Erweiterung der nachrichtendienstlichen Befugnisse bei Individual und strategischer Fernmeldekontrolle
- 3. Reaktion: BVerfGE 100,313 (,,III. Abhörentscheidung\") vom 14.7.1999
- a) Zulässigkeit des neuen Instrumentariums
- b) Übermittlung an andere Behörden
- c) Mitteilungspflicht
- d) Der neue Befugniszuschnitt des BND und der Risikogedanke
- e) Eigene Bewertung der BVerfGE 100,313
- Exkurs: Die neue nachrichtendienstliche Herausforderung: Der islamistische Terrorismus und der Reflex der Risikogesellschaft
- E Die Entwicklung des BND im Zuge der weiteren Ausbreitung. des „Paradigmas der Risikogesellschaft“
- I. Die Novellierung des G 10 vom 29.06.2001
- 1. Änderungen bezüglich der Individualmaßnahmen
- 2. Änderungen bezüglich der strategischen Überwachungsmaßnahmen
- 3. Änderungen bezüglich der Übermittlungspflicht
- 4. Die strategische Überwachung bei einer im Einzelfall im Ausland bestehenden Gefahr für Leib und Leben
- 5. Änderungen der Kontrollvorschriften für die strategische Aufklärung
- 6. Änderungen bei den Benachrichtigungspflichten
- 7. Diskussion des novellierten G 10
- II. Übernationale Einflüsse auf die weitere Gesetzgebung
- III. Das Terrorismusbekämpfungsgesetz vom 09.01.2002
- 1. Die wesentlichen, für den BND relevanten Änderungen
- 2. Die herkömmlichen Argumentationen im Schrifttum
- 3. Diskussion der Geeignetheit, unter besonderer Berücksichtigung von Risikosteuerungsbestrebungen
- IV. Verstärkte informationelle Zusammenarbeit
- V. Ausblick: „Terrorismusbekämpfungsergänzungsgesetzentwurf“
- I. Die Novellierung des G 10 vom 29.06.2001
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit analysiert die Befugnismodifikationen des Bundesnachrichtendienstes (BND) seit 1991 im Kontext des Spannungsverhältnisses zwischen Bürgerrechten und Risikovorsorgebedürfnissen im Präventionsstaat. Dabei steht die Kritik des liberalen Diskursparadigmas im Fokus, das die Abwägung zwischen Sicherheit und Freiheit zu stark zugunsten des liberalen Freiheitsbegriffs verschiebt.
- Entwicklung des BND im Kontext des liberalen und des Risikogesellschaft-Paradigmas
- Analyse der Befugniserweiterungen des BND seit 1991
- Kritik des liberalen Diskursparadigmas im Hinblick auf die Abwägung von Bürgerrechten und Risikovorsorge
- Einfluss des islamistischen Terrorismus auf die Sicherheitsarchitektur Deutschlands
- Bedeutung übernationaler Einflüsse auf die Gesetzgebung im Bereich des Nachrichtendienstrechts
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Fragestellung, die Methodik und die zentralen Definitionen. Kapitel B beleuchtet die Verwendung der Begriffe „Sicherheit“, „Rechtsstaat“ und „Bürgerrechte“ im liberalen und im sozialen Paradigma sowie im Kontext des Risikogesellschaft-Paradigmas. Kapitel C widmet sich dem „klassischen“ BND im liberalen Paradigma bis 1994, analysiert die formalen und materiellen Rechtsgrundlagen des BND, die gesetzliche Befugnisse zum Eingriff in die Grundrechte nach Art. 10 GG sowie die parlamentarische Kontrolle des BND. Kapitel D beschäftigt sich mit den ersten Befugniserweiterungen des BND seit 1994 und der Reaktion des Bundesverfassungsgerichts in der „Abhörentscheidung“. Der Exkurs behandelt die neue nachrichtendienstliche Herausforderung durch den islamistischen Terrorismus und den Reflex der Risikogesellschaft. Kapitel E fokussiert auf die Entwicklung des BND im Zuge der weiteren Ausbreitung des Risikogesellschaft-Paradigmas, analysiert die Novellierung des G 10 im Jahr 2001, das Terrorismusbekämpfungsgesetz von 2002 und die verstärkte informationelle Zusammenarbeit.
Schlüsselwörter
Bundesnachrichtendienst (BND), Bürgerrechte, Risikovorsorge, Präventionsstaat, liberales Diskursparadigma, Islamistischer Terrorismus, Risikogesellschaft, Gesetz G 10, Parlamentarische Kontrolle, Verfassungsschutz, Überwachung, Datenschutz, Informationsfreiheit.
Häufig gestellte Fragen
Wie veränderte der 11. September 2001 die deutsche Sicherheitsgesetzgebung?
Die Anschläge markierten einen Wendepunkt hin zu einem „ganzheitlichen Bekämpfungsansatz“, der verstärkt auf Informationsvorsorge und die Ausweitung nachrichtendienstlicher Befugnisse setzt.
Was regelt das Gesetz G 10?
Das G 10-Gesetz regelt die Befugnisse der Nachrichtendienste, unter bestimmten Voraussetzungen in das Fernmeldegeheimnis (Art. 10 GG) einzugreifen, um Gefahren für die staatliche Sicherheit abzuwehren.
Wie wird der Bundesnachrichtendienst (BND) kontrolliert?
Die Kontrolle erfolgt durch parlamentarische Gremien wie die Parlamentarische Kontrollkommission (PKGr), das G 10-Gremium und die G 10-Kommission.
Was versteht man unter dem „Paradigma der Risikogesellschaft“?
Es beschreibt einen gesellschaftlichen Zustand, in dem die Abwehr unvorhersehbarer, globaler Risiken (wie Terrorismus) Vorrang vor klassischen liberalen Freiheitsrechten gewinnt.
Welche Befugnisse erhielt der BND durch das Terrorismusbekämpfungsgesetz?
Das Gesetz von 2002 erweiterte die Möglichkeiten zur strategischen Fernmeldeaufklärung und verbesserte den Informationsaustausch zwischen verschiedenen Sicherheitsbehörden.
- Quote paper
- Alexander Pillris (Author), 2006, Zwischen Bürgerrechten und Risikovorsorge. Wann ist das Eingreifen des Staates richtig?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/64111