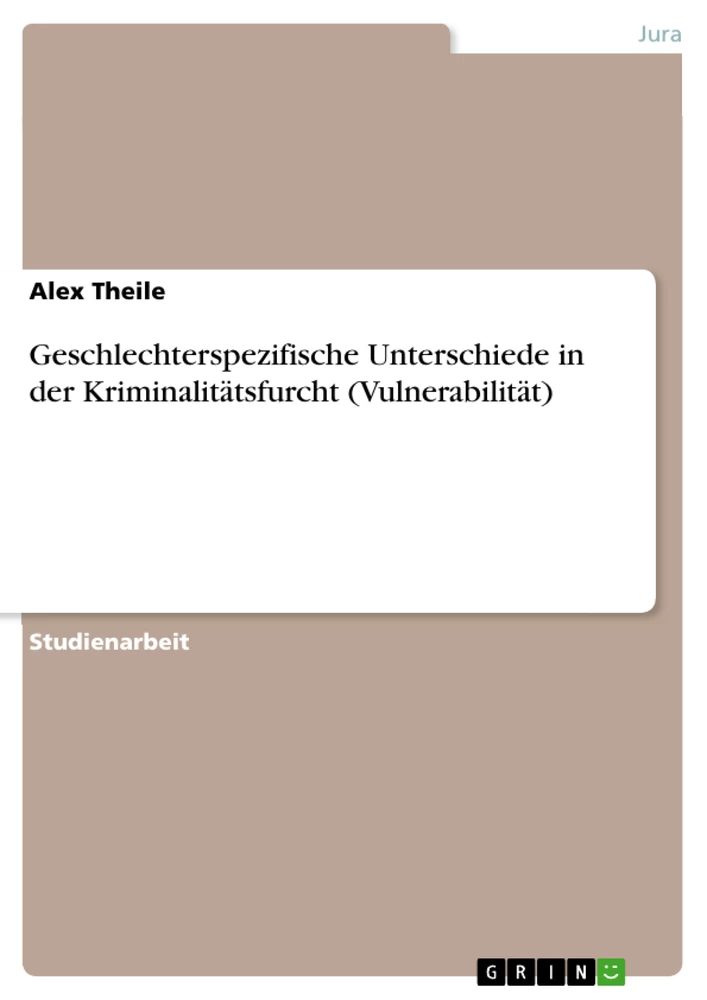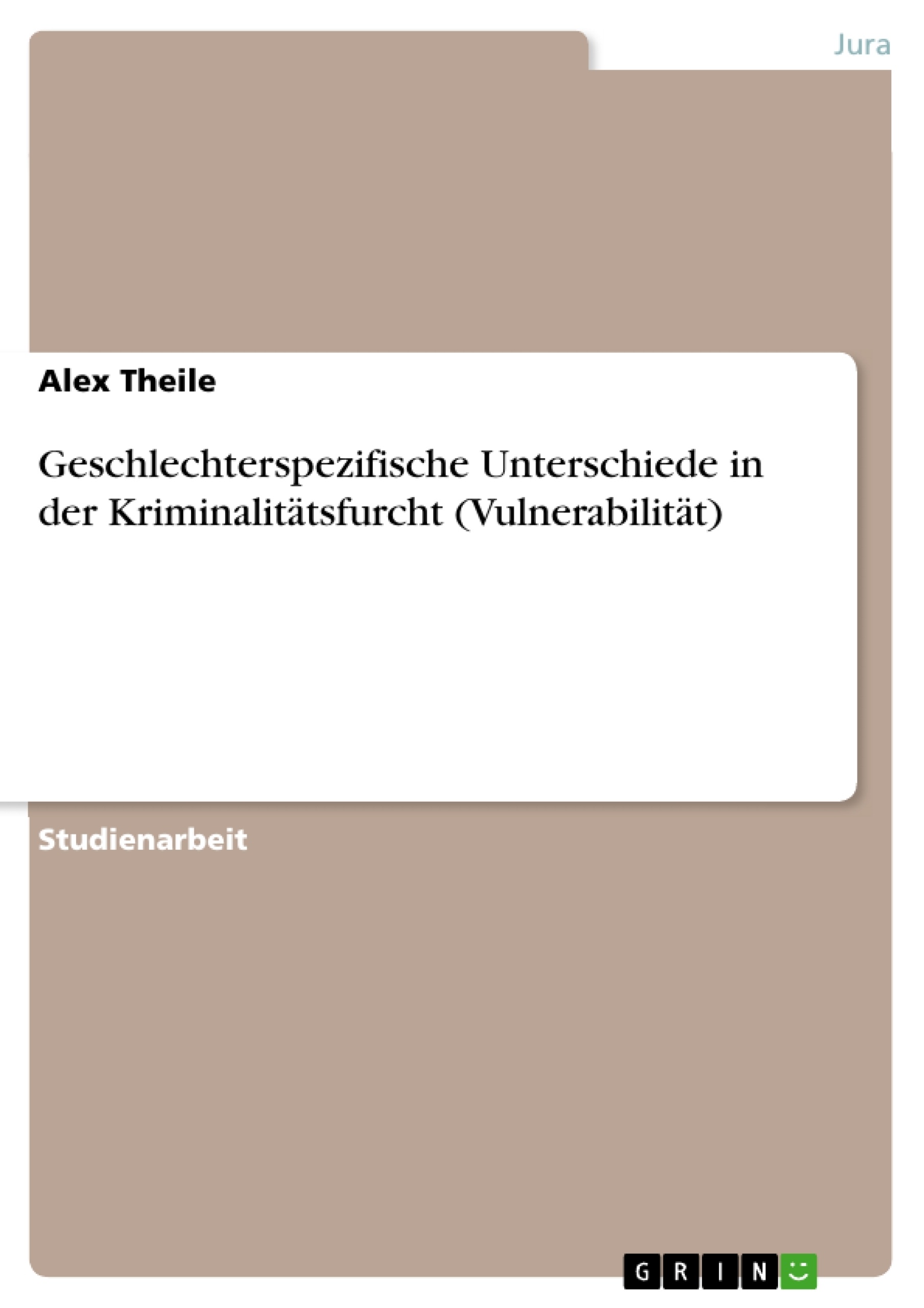Wenn man mich fragen würde, wer die meiste Angst vor Kriminalität hätte, so würde ich spontan an das weibliche Geschlecht denken. In erster Linie sicherlich wegen meiner Sozialisation, in der das Bild der Frau als körperlich schwächeres Geschlecht immer mit der größeren Angst vor „Untaten“ in Verbindung gebracht wird. Des Weiteren aber auch durch einschlägige mediale Mittel, wie z.B. Kino- und Fernsehfilme, in denen Frauen als besonders gefährdete Individuen dargestellt werden.
Mein folgender Text wird sich hauptsächlich mit der Untersuchung von K.-H. Reuband auseinandersetzen.
Inhaltsverzeichnis
- Vorbemerkung
- Einleitung
- Zielsetzung und methodisches Vorgehen
- Viktimisierung und Kriminalitätsfurcht
- Vulnerabilität und Frauen: Möglichkeiten des Selbstschutzes
- Sexuelle Elemente der Bedrohung
- Vermeidungsstrategien
- Schlussbemerkung
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht das Kriminalitätsfurcht-Paradoxon, die Tatsache, dass Frauen trotz geringerer Viktimisierungsrate eine höhere Kriminalitätsfurcht zeigen als Männer. Sie analysiert das Vulnerabilitätskonzept als Erklärungsmuster und untersucht geschlechterspezifische Unterschiede in der Kriminalitätsfurcht anhand einer empirischen Studie von K.-H. Reuband.
- Das Kriminalitätsfurcht-Paradoxon
- Das Vulnerabilitätskonzept
- Geschlechterspezifische Unterschiede in der Kriminalitätsfurcht
- Methodische Aspekte der Kriminalitätsfurchtforschung
- Vermeidungsstrategien im Kontext von Kriminalitätsfurcht
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt das Kriminalitätsfurcht-Paradoxon vor – Frauen haben mehr Angst vor Kriminalität, obwohl sie seltener Opfer werden. Reuband präsentiert das Vulnerabilitätskonzept als Erklärung: Individuen mit weniger Ressourcen und Kompetenzen empfinden höhere Furcht, da die Konsequenzen von Kriminalität für sie gravierender sind. Das Konzept bezieht sich auf die geringere körperliche Stärke von Frauen und ihre unterschiedliche Wahrnehmung von Delikten, insbesondere sexueller Gewalt.
Zielsetzung und methodisches Vorgehen: Dieser Abschnitt beschreibt die Forschungsfrage nach geschlechterspezifischen Einflussfaktoren auf die Kriminalitätsfurcht. Reuband kritisiert bestehende Indikatoren als unzureichend und verwendet eine postalische Befragung in drei ostdeutschen Städten, um Interviewereinflüsse zu minimieren und natürliche Antworten zu erhalten. Die Stichprobe basiert auf Einwohnermeldeamtsdaten, mit einem Mindestalter von 18 Jahren und einer Ausschöpfungsrate von ca. 69%.
Viktimisierung und Kriminalitätsfurcht: Dieser zentrale Abschnitt präsentiert drei Untersuchungen. Die erste zeigt, dass Frauen seltener Opfer von Kriminalität sind als Männer, außer bei einigen Delikten wie Körperverletzung. Die zweite untersucht die objektive Bedrohung mithilfe des Indikators „Sicherheit beim nächtlichen Spaziergang“. Hier zeigen sich höhere Unsicherheitsgefühle bei Frauen. Reuband problematisiert die Verwendung dieses Indikators aufgrund von geschlechterspezifischem Antwortverhalten und der fehlenden expliziten Erwähnung von Kriminalität. Die dritte Untersuchung (nicht detailliert im Auszug beschrieben) liefert vermutlich weitere Erkenntnisse zur Verbindung von Viktimisierung und Kriminalitätsfurcht.
Schlüsselwörter
Kriminalitätsfurcht, Vulnerabilität, Viktimisierung, Geschlechterunterschiede, empirische Forschung, Befragung, objektive und subjektive Sicherheit, sexuelle Gewalt, Vermeidungsstrategien, Kriminalitätsfurcht-Paradoxon, soziale Lage, Ressourcen, Kompetenzen.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse der Kriminalitätsfurcht bei Frauen
Was ist das zentrale Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht das Kriminalitätsfurcht-Paradoxon: Frauen haben trotz geringerer Viktimisierungsraten eine höhere Kriminalitätsfurcht als Männer. Sie analysiert das Vulnerabilitätskonzept als Erklärung und untersucht geschlechterspezifische Unterschiede in der Kriminalitätsfurcht anhand einer empirischen Studie.
Welche Forschungsfrage steht im Mittelpunkt?
Die zentrale Forschungsfrage befasst sich mit den geschlechterspezifischen Einflussfaktoren auf die Kriminalitätsfurcht. Die Studie von K.-H. Reuband untersucht, warum Frauen trotz geringerer Opferwahrscheinlichkeit mehr Angst vor Kriminalität haben.
Welches Konzept wird zur Erklärung des Kriminalitätsfurcht-Paradoxons verwendet?
Das Vulnerabilitätskonzept dient als Erklärungsmuster. Es besagt, dass Individuen mit weniger Ressourcen und Kompetenzen eine höhere Kriminalitätsfurcht empfinden, da die Konsequenzen von Kriminalität für sie gravierender sind. Dies bezieht sich auf die oft geringere körperliche Stärke von Frauen und ihre unterschiedliche Wahrnehmung von Delikten, insbesondere sexueller Gewalt.
Welche Methodik wurde in der Studie angewendet?
Reuband verwendet eine postalische Befragung in drei ostdeutschen Städten, um Interviewereinflüsse zu minimieren und natürliche Antworten zu erhalten. Die Stichprobe basiert auf Einwohnermeldeamtsdaten (Mindestalter 18 Jahre) mit einer Ausschöpfungsrate von ca. 69%. Bestehende Indikatoren zur Kriminalitätsfurcht werden kritisch hinterfragt.
Welche Ergebnisse liefert die Studie bezüglich Viktimisierung und Kriminalitätsfurcht?
Die Studie zeigt, dass Frauen seltener Opfer von Kriminalität sind als Männer, außer bei bestimmten Delikten wie Körperverletzung. In Bezug auf die subjektive Sicherheit (z.B. Sicherheit beim nächtlichen Spaziergang) zeigen Frauen höhere Unsicherheitsgefühle. Die Studie problematisiert dabei die Verwendung von Indikatoren wie „Sicherheit beim nächtlichen Spaziergang“ aufgrund von geschlechterspezifischem Antwortverhalten und fehlender expliziter Erwähnung von Kriminalität.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Kriminalitätsfurcht, Vulnerabilität, Viktimisierung, Geschlechterunterschiede, empirische Forschung, Befragung, objektive und subjektive Sicherheit, sexuelle Gewalt, Vermeidungsstrategien, Kriminalitätsfurcht-Paradoxon, soziale Lage, Ressourcen, Kompetenzen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit enthält eine Vorbemerkung, Einleitung, Zielsetzung und methodisches Vorgehen, Kapitel zu Viktimisierung und Kriminalitätsfurcht, Vulnerabilität und Frauen, sexuellen Elementen der Bedrohung, Vermeidungsstrategien, Schlussbemerkung und Resümee.
- Arbeit zitieren
- Alex Theile (Autor:in), 2004, Geschlechterspezifische Unterschiede in der Kriminalitätsfurcht (Vulnerabilität), München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65712