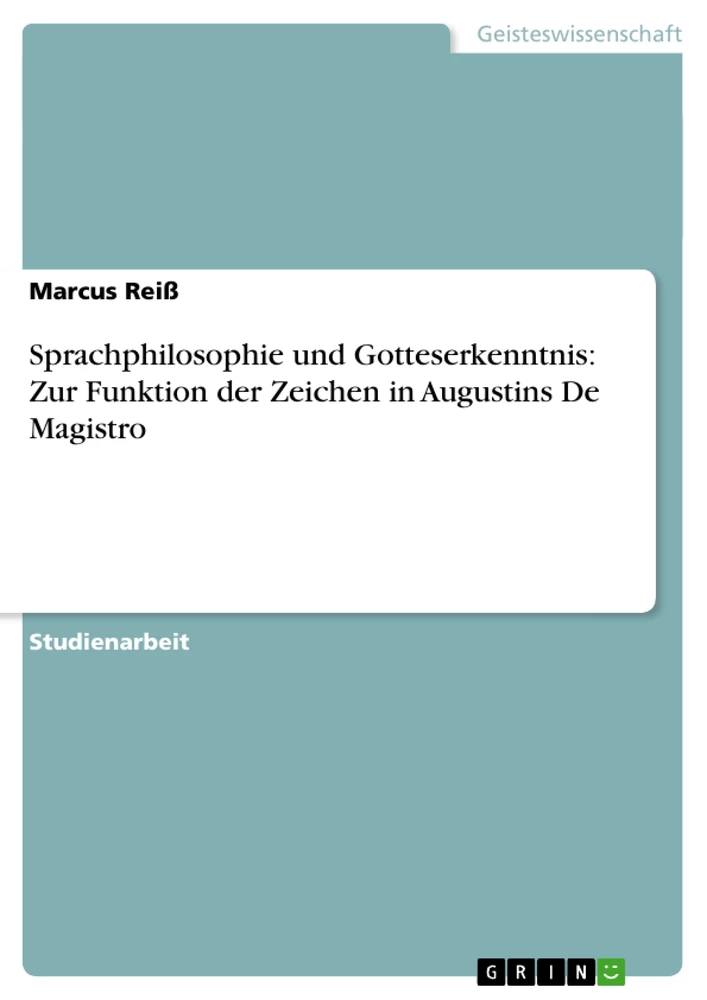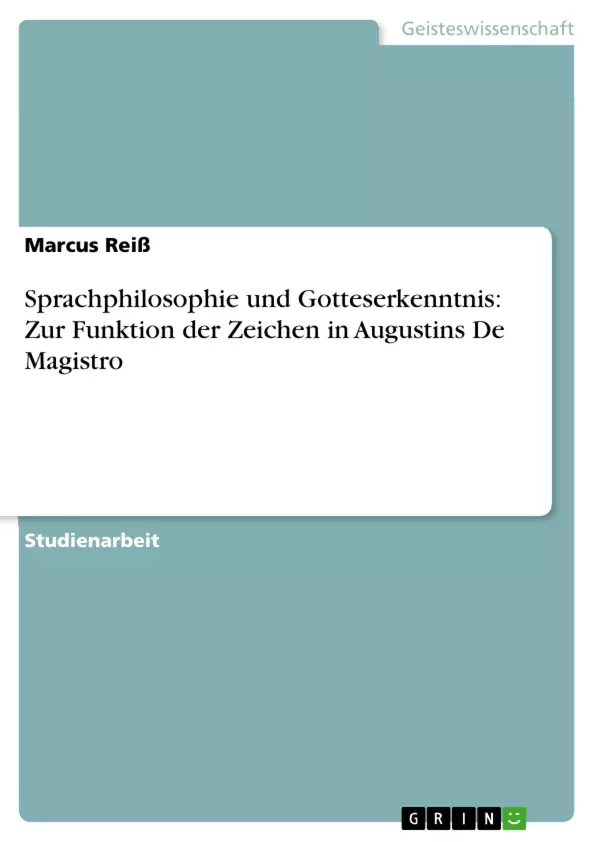„Was, meinst du, wollen wir bewirken, wenn wir sprechen?“ Mit dieser Frage
beginnt Aurelius Augustinus das als Dialog konzipierte Gespräch mit seinem Sohn
Adeodat. Klingt es zunächst noch nach einem scheinbar einfach zu lösenden,
sprachphilosophischen Problem, bleibt es jedoch nicht lange bei diesem
Themenkomplex, da das zu erreichende Ziel im Grunde klar umrissen ist: Es geht
darum, Christus als den einzigen Lehrer jeglicher Wahrheit vorzustellen. Um dies zu
erreichen, entwickelt der Kirchenvater, wie schon Platon vor ihm, ein klassisches
Lehrgespräch, das einerseits als bloss geistige Übung dient, andererseits aber schon
bald Schwierigkeiten aufwirft, die zumeist im Disput gelöst und verdeutlicht werden
können.
Mein Anliegen wird es sein, den Gedankengang nachzuzeichnen, den Augustin
langsam entwickelt und der in der Behauptung mündet, jegliche Erkenntnis finde
ausserhalb von Sprache statt. Ausgehend von obiger Frage geht es zunächst um
Arten und Funktionen von Zeichen, sowie die Darlegung ihrer Fähigkeit, auf sich
selbst zeigen bzw. verweisen zu können.
Darauf wird zu untersuchen sein, in welchem Verhältnis Zeichen, Wörter und Namen
zueinander stehen und welche Schlüsse sich daraus hinsichtlich einer Eignung der
Wörter zu Zwecken der Erkenntnis für den weiteren Verlauf ziehen lassen.
Rückblickend auf vorherige Bestimmungen werde ich dann zu skizzieren versuchen,
warum Erkenntnisvermittlung durch sprachliche Zeichen bei Augustin nicht möglich
ist und warum er den sinnvollen Gebrauch von Wörtern radikal einschränkt. Auch
geht es um den Zusammenhang zwischen Wahrnehmung auf der einen und Wahrheit
auf der anderen Seite: Ist eine Sache ohne eine jemals stattfindende sinnliche
Anschauung überhaupt adäquat erkennbar?
Abschliessend werde ich noch kurz erläutern, warum Christus allein die einzige
Wahrheit darstellt und letztere vom Menschen selbst doch nie erreicht werden kann.
Resümierend werden die zentralen Punkte gebündelt vorgestellt, um am Ende einer
Kritik des Dialogs Platz zu machen, der trotz aller sprachlichen Schönheit auch
inhaltliche „Mängel“ aufweist. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hierarchie der Zeichen
- Warum sprechen wir?
- Möglichkeiten der Bezeichnung
- Wörter und deren reflexive Funktion
- Wörter = Namen = Zeichen ?
- Stufen der Reflexivität
- Relation: Zeichen - Bezeichenbares
- Prädominanz: Sache - Zeichen
- Prädominanz: Zeichen - Erkenntnis
- Durch sich selbst aufzeigbare Sachen?
- Wahrnehmung und Erkenntnis
- Der Lehrer
- Zur Kritik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht Augustins „De Magistro“ mit dem Fokus auf die sprachphilosophischen Aspekte des Werks und die Rolle von Zeichen in Bezug auf Gotteserkenntnis. Augustin argumentiert, dass Erkenntnis außerhalb von Sprache stattfindet und dass Sprache lediglich eine Funktion der Vergegenwärtigung von Wissen erfüllt.
- Die Hierarchie von Zeichen und ihre unterschiedlichen Funktionen
- Die Beziehung zwischen Zeichen, Wörtern und Namen
- Die Grenzen von sprachlicher Erkenntnisvermittlung
- Der Zusammenhang zwischen Wahrnehmung und Erkenntnis
- Die Rolle Christi als dem einzigen Lehrer der Wahrheit
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel erörtert Augustin verschiedene Funktionen von Sprache, wobei er beleuchtet, dass Sprache vorrangig zur Belehrung oder Vergegenwärtigung dient. In Kapitel 2 wird die Hierarchie von Zeichen diskutiert, wobei Augustin verschiedene Arten von Zeichen und ihre jeweiligen Funktionen in Bezug auf die Erkenntnis untersucht. Kapitel 3 behandelt die Relation zwischen Zeichen und dem Bezeichenbaren, wobei Augustins Argumentation deutlich macht, dass Erkenntnis unabhängig von sprachlichen Zeichen stattfindet. Das vierte Kapitel thematisiert die Rolle des Lehrers und wie dieser im Rahmen der sprachlichen Kommunikation Erkenntnis vermittelt. Schließlich wird in Kapitel 5 eine kritische Analyse des Dialogs „De Magistro“ präsentiert.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit sind Sprachphilosophie, Gotteserkenntnis, Zeichen, Wörter, Namen, Reflexivität, Erkenntnisvermittlung, Wahrnehmung, Wahrheit, Christus, und Kritik. Augustins Argumentation im „De Magistro“ stellt die Frage nach den Grenzen von sprachlicher Erkenntnis in den Vordergrund, die sich auf die Frage nach der Natur von Gotteserkenntnis und der Rolle des Lehrers bezieht.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Augustins Werk "De Magistro"?
Das Werk ist ein Dialog zwischen Augustin und seinem Sohn Adeodat über die Sprache. Die zentrale These ist, dass Sprache allein keine Wahrheit vermitteln kann, sondern Christus der einzige wahre Lehrer im Inneren des Menschen ist.
Warum kann Sprache laut Augustin keine Erkenntnis vermitteln?
Wörter sind lediglich Zeichen, die auf Dinge verweisen. Wenn man die Sache hinter dem Zeichen nicht bereits kennt, kann das Wort allein kein Wissen über die Realität erzeugen; es dient nur der Vergegenwärtigung.
Was ist die reflexive Funktion von Wörtern?
Augustin untersucht, wie Wörter auf sich selbst verweisen können (z.B. wenn man über das Wort „Wort“ spricht). Er analysiert die hierarchischen Stufen der Bezeichnung zwischen Zeichen, Namen und Sachen.
Welche Rolle spielt die Wahrnehmung für die Wahrheit?
Augustin hinterfragt, ob eine Sache ohne sinnliche oder geistige Anschauung adäquat erkennbar ist. Er kommt zu dem Schluss, dass wahre Erkenntnis eine direkte Schau der Wahrheit im Inneren erfordert.
Wer ist der „innere Lehrer“ bei Augustin?
Für Augustin ist Christus die personifizierte Wahrheit, die im Inneren jedes Menschen wohnt und ihn erleuchtet, sodass er die Wahrheit hinter den äußeren Zeichen der Sprache erkennen kann.
- Quote paper
- Marcus Reiß (Author), 2000, Sprachphilosophie und Gotteserkenntnis: Zur Funktion der Zeichen in Augustins De Magistro, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/6804