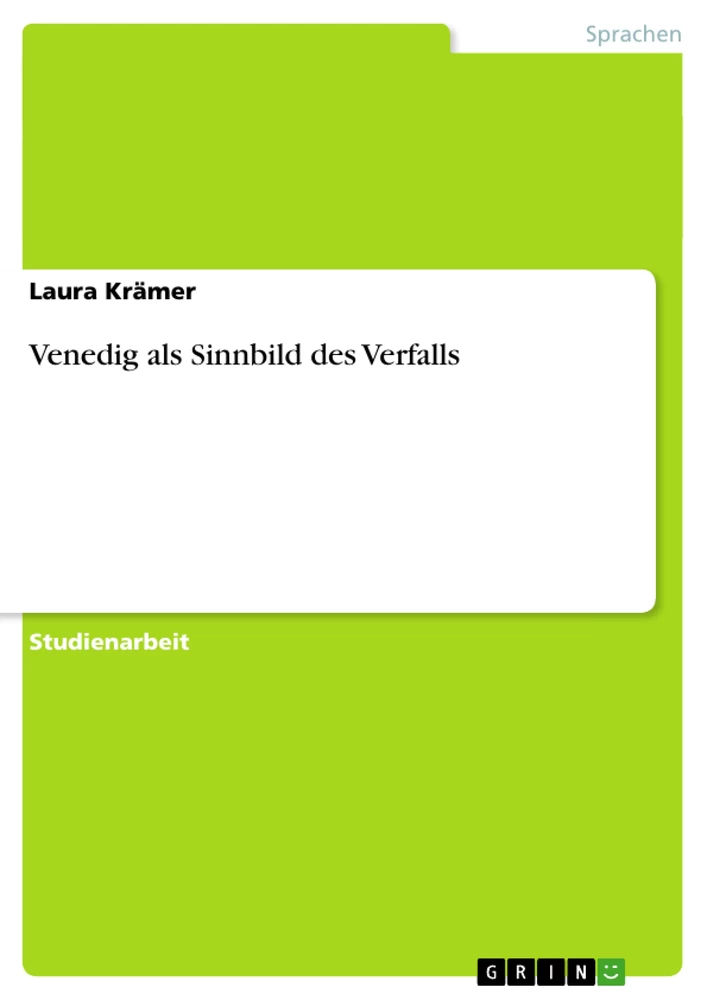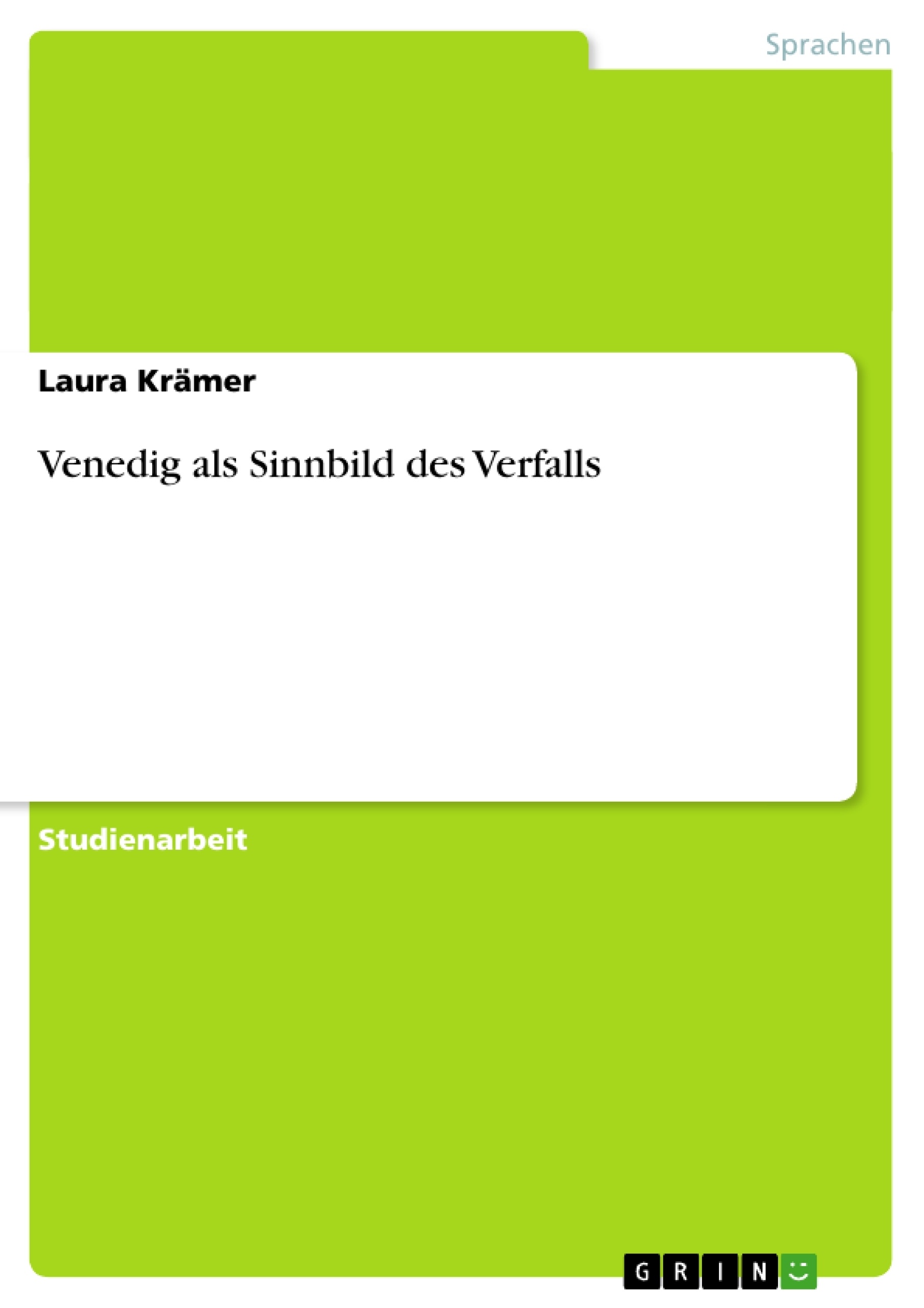Venedig gehört zu den gefragtesten Reisezielen weltweit. Fast zu jeder Jahreszeit ist die Stadt angefüllt mit Touristen, die das architektonische Wunderwerk der Wasserstadt und die überreichen Kunstschätze, die sie beherbergt, besichtigen wollen. Viele ziehen auch die allgemeinen Verlockungen eines italienischen Ferienaufenthalts an, gutes Essen, Eis, Sonne, Meer, Entspannung im Café, die in Venedig vor einer einzigartigen Kulisse eine besondere Romantik erhalten. Dies mag für die häufige Wahl Venedigs als Ziel von Hochzeitsreisen eine Rolle spielen. Besondere kulturelle Veranstaltungen wie die Filmbiennale, Opern- und Theateraufführungen haben wiederum ihr eigenes Publikum, und auch ausländische Geisteswissenschaftler finden hier lohnende Beschäftigung, zum Beispiel an der Universität, am Deutschen Institut für venezianische Studien oder dem Archivio Luigi Nono auf der Giudecca. Auf der klassischen italienischen Bildungsreise, die auch heute noch unternommen wird, darf Venedig auf keinen Fall fehlen. Dieses nicht abreißende oder auch nur nachlassende internationale Interesse an der Hafenstadt ist nicht etwa ein Phänomen der neuesten Zeit, es ist vielmehr eine Konstante in der europäischen Geschichte seit dem Mittelalter, freilich aus den unterschiedlichsten, historisch wechselnden Gründen. So fragt es sich, wie es geschehen konnte, daß dieser Ort der Bildung, Kultur, des Reichtums und Wohllebens in der europäischen Literatur des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts zu einem beliebten Topos für Verfall und Tod werden konnte. Es ist davon auszugehen, daß eine solche literarische Tendenz eine allgemeine Sichtweise der Zeit spiegelt und das Phänomen nicht nur in Schriftstellerkreisen relevant war. Wie kam La Serenissima in diesen ihrem Beinamen so konträren Ruf? Wann fing man an, in Venedig vor allem das Vergangene im Sinne des Heruntergekommenen, Abgestiegenen zu sehen? Was führte zu diesem Wandel der Sichtweise? Welche tatsächlichen Dekadenzprozesse spielten sich in der politischen und sozialen Geschichte der Seerepublik ab? Auf welche Weise bedienen sich Autoren des Venedig-Topos? Wird er auch in jüngster Zeit noch bemüht? Diesen Fragen will die vorliegende Arbeit auf den Grund gehen. Dies ist eine kulturwissenschaftliche und keine literaturwissenschaftliche Arbeit. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2. Begriffsklärung Topos
- 3. Dekadenzprozesse in der venezianischen Geschichte
- 3.1 Aufstieg
- 3.2 Verlust der Vormachtstellung im Welthandel
- 3.3 Politische Untätigkeit, Unselbständigkeit
- 3.4 17./18. Jahrhundert: Kulturelle Blüte und fragwürdige Vergnügungskultur
- 4. Thomas Mann: Der Tod in Venedig
- 4.1 Lob Venedigs
- 4.2 Venedig als Verführerin
- 4.3 Moralisch verkommene Einwohner
- 4.4 Ekel
- 4.5 Wetter
- 5. Die objektive Sichtweise: Karl Schefflers Reisebericht
- 5.1 Deutsche Italien-Bewunderung und Italien-Sehnsucht
- 5.2 Venedig als Verführerin
- 5.3 Enttäuschung bei der Anreise per Bahn
- 5.4 Singen die Gondoliere?
- 5.5 Ekel
- 5.6 Proletarische Einwohner
- 5.7 Dirnenschönheit
- 6. Fazit
- 7. Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die literarische Darstellung Venedigs als Sinnbild des Verfalls im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert. Sie analysiert, wie dieser Topos in der Literatur entstanden ist und welche gesellschaftlichen und historischen Hintergründe dazu beigetragen haben. Die Arbeit konzentriert sich auf die Ambivalenz des Bildes Venedigs, zwischen idyllischer Schönheit und moralischer Dekadenz.
- Der Topos von Venedig als Symbol des Verfalls in der Literatur
- Historische Dekadenzprozesse in Venedig
- Ambivalente Darstellung Venedigs in Literatur und Reiseberichten
- Vergleichende Analyse von Thomas Manns "Der Tod in Venedig" und Karl Schefflers Reisebericht
- Entwicklung und Rezeption des Venedig-Topos
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und stellt die Forschungsfrage nach der Entstehung des Topos von Venedig als Symbol des Verfalls in der Literatur. Sie begründet die Auswahl von Thomas Manns "Der Tod in Venedig" und Karl Schefflers Reisebericht als Fallstudien und skizziert den methodischen Ansatz der Arbeit.
2. Begriffsklärung Topos: Dieses Kapitel klärt den Begriff "Topos" aus der Literaturwissenschaft. Es unterscheidet den literaturwissenschaftlichen Topos-Begriff von stehenden Wendungen und Gemeinplätzen und erläutert die methodischen Herausforderungen der Topos-Forschung.
3. Dekadenzprozesse in der venezianischen Geschichte: Dieses Kapitel untersucht die historischen und gesellschaftlichen Veränderungen in Venedig, die zur Entstehung des Topos des Verfalls beigetragen haben. Es beleuchtet den Aufstieg Venedigs als Seemacht, den Verlust seiner Vormachtstellung im Welthandel, politische Untätigkeit und die Entwicklung einer ambivalenten Kultur im 17. und 18. Jahrhundert, die Aspekte von Blüte und Dekadenz vereint.
4. Thomas Mann: Der Tod in Venedig: Dieses Kapitel analysiert Thomas Manns Erzählung "Der Tod in Venedig" als exemplarische Darstellung des Venedig-Topos. Es untersucht die ambivalente Darstellung Venedigs als verführerische Ferienidylle, beeindruckende Pracht und gleichzeitig gefährliche, abstoßende Falle. Die Analyse berücksichtigt die beschriebenen Aspekte des moralischen Verfalls der Einwohner und die Rolle des Wetters in der Erzählung.
5. Die objektive Sichtweise: Karl Schefflers Reisebericht: Dieses Kapitel analysiert Karl Schefflers Reisebericht von 1911 als Gegenpol zu Manns literarischer Darstellung. Es untersucht Schefflers Beobachtungen Venedigs und vergleicht diese mit Manns Beschreibungen. Der Vergleich soll aufzeigen, inwiefern die Wahrnehmung Venedigs als verfallen tatsächlich eine verbreitete Sichtweise der Zeit widerspiegelt und nicht allein auf Manns Werk zurückzuführen ist. Die Analyse betrachtet Schefflers Eindrücke von der Anreise, den Einwohnern und der Stadt, um die objektive Perspektive zu beleuchten.
Schlüsselwörter
Venedig, Topos, Verfall, Dekadenz, Literatur, Reisebericht, Thomas Mann, Karl Scheffler, Ambivalenz, Italien, 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, Kulturgeschichte, Seemacht.
Häufig gestellte Fragen zu: Literarische Darstellung Venedigs als Sinnbild des Verfalls
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht die literarische Darstellung Venedigs als Symbol des Verfalls im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert. Sie analysiert die Entstehung dieses Topos in der Literatur und die dazugehörigen gesellschaftlichen und historischen Hintergründe. Ein besonderer Fokus liegt auf der Ambivalenz des Venedig-Bildes zwischen idyllischer Schönheit und moralischer Dekadenz.
Welche Texte werden analysiert?
Die Arbeit konzentriert sich auf einen Vergleich zwischen Thomas Manns Erzählung "Der Tod in Venedig" und einem Reisebericht von Karl Scheffler aus dem Jahr 1911. Mann's literarische Darstellung wird mit der vermeintlich "objektiveren" Perspektive des Reiseberichts konfrontiert, um die Verbreitung und die Hintergründe der Wahrnehmung Venedigs als verfallen zu beleuchten.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: den Topos von Venedig als Symbol des Verfalls in der Literatur; historische Dekadenzprozesse in Venedig; die ambivalente Darstellung Venedigs in Literatur und Reiseberichten; eine vergleichende Analyse von Thomas Manns "Der Tod in Venedig" und Karl Schefflers Reisebericht; sowie die Entwicklung und Rezeption des Venedig-Topos.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Eine Einleitung, die den Forschungsgegenstand und die Methode einführt; eine Begriffsklärung des Topos; eine Untersuchung der historischen Dekadenzprozesse in Venedig; eine Analyse von Thomas Manns "Der Tod in Venedig"; eine Analyse von Karl Schefflers Reisebericht; ein Fazit; und ein Literaturverzeichnis.
Welche Aspekte Venedigs werden in den Texten untersucht?
Die Analysen untersuchen verschiedene Aspekte der Darstellung Venedigs, darunter: Venedigs Aufstieg und Fall als Seemacht; politische und gesellschaftliche Veränderungen; die kulturelle Blüte und die fragwürdige Vergnügungskultur des 17. und 18. Jahrhunderts; Venedigs Darstellung als verführerische Idylle und gleichzeitig als moralisch verkommen und abstoßend; die Rolle des Wetters in der literarischen Darstellung; und die Eindrücke der Anreise, der Einwohner und der Stadt im Reisebericht.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Venedig, Topos, Verfall, Dekadenz, Literatur, Reisebericht, Thomas Mann, Karl Scheffler, Ambivalenz, Italien, 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert, Kulturgeschichte, Seemacht.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Entstehung und die literarische Rezeption des Topos von Venedig als Symbol des Verfalls zu untersuchen und die ambivalente Darstellung Venedigs in der Literatur des ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts zu analysieren. Durch den Vergleich von Literatur und Reisebericht soll die Verbreitung dieser Wahrnehmung in der damaligen Zeit beleuchtet werden.
- Quote paper
- Laura Krämer (Author), 2004, Venedig als Sinnbild des Verfalls, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/68247