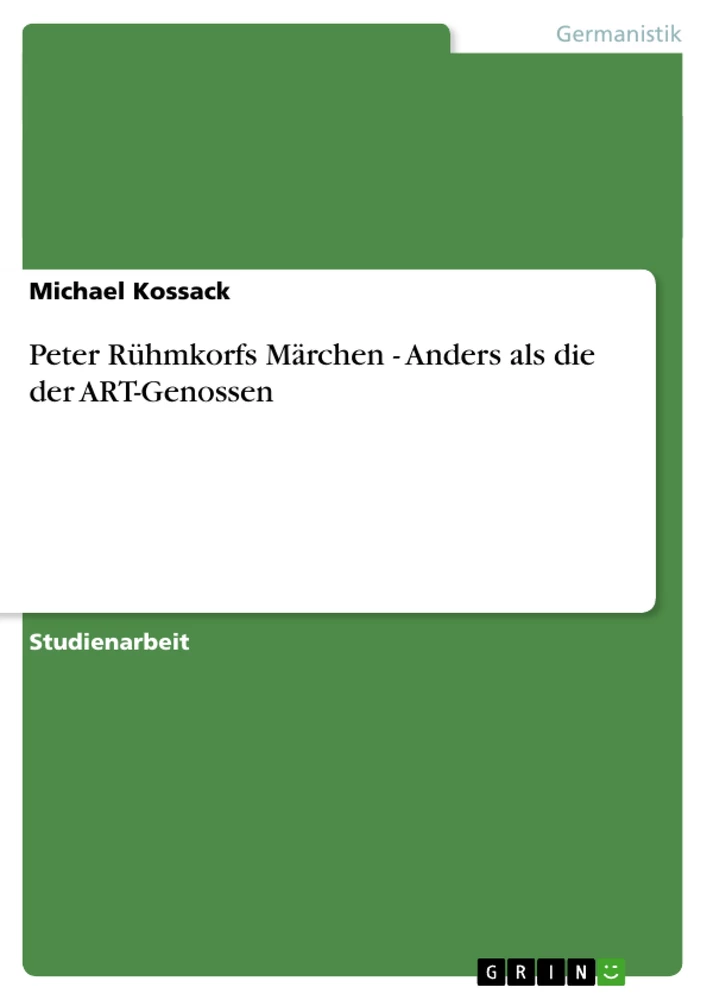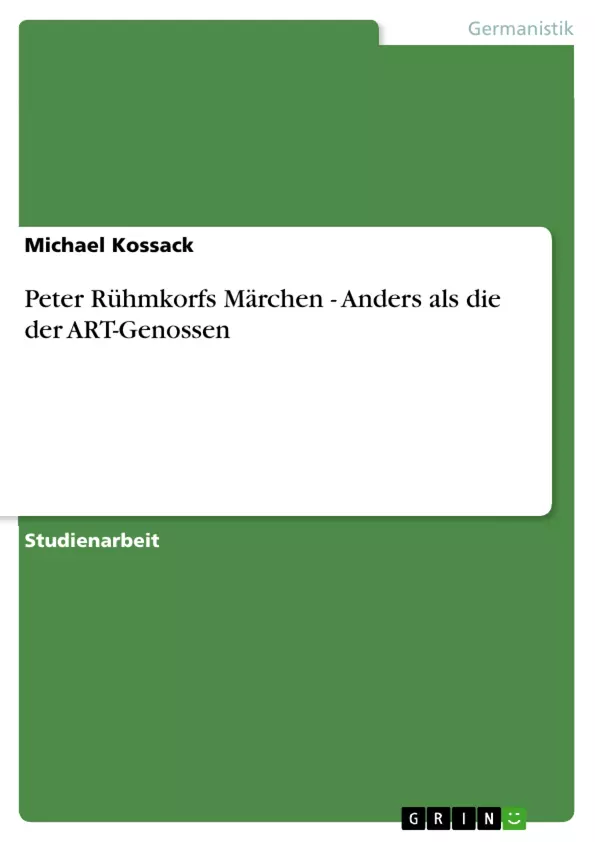Anfang der 80´er Jahre veröffentlichte Peter Rühmkorf mit „Auf Wiedersehen in Kenilworth“
und der Sammlung „Der Hüter des Misthaufens - Aufgeklärte Märchen“ zahlreiche Märchen.
Damit wagt er den Sprung in ein neues Terrain, denn zuvor war noch keine fiktive Prosa von
ihm erschienen. Was ihn dazu veranlaßte, was den Dichter zu den Märchen brachte, soll hier
aber nicht untersucht werden, weil die Beschäftigung mit den Märchen keine Besonderheit
darstellt, sondern eher ein Trend der Zeit war.
In den 70’er Jahren zog das Märchen wieder in die Literatur ein. Es wurden viele
Neufassungen bekannter Volksmärchen geschrieben, die meist in Sammlungen von Märchen
mehrer Autoren, wie „Das Große Deutsche Märchenbuch“ oder „Märchen, Sagen und
Abenteuergeschichten auf alten Bilderbogen, neu erzählt von Autoren unserer Zeit“
erschienen. Daneben stehen Sammlungen eines einzigen Autors wie „Wer hat Dornröschen
wachgeküsst? Das Märchen-Verwirrbuch“ von Iring Fetscher oder „JANOSCH erzählt
Grimm´s Märchen“ von Horst Eckert (Janosch). Die Gattung Märchen zog aber auch in den
Roman ein, hier wurden sie als Erzählung auf der Ebene der Erzählung integriert, erscheinen
also als Binnenmärchen.
Außerdem wurde auf theoretischer Ebene über das Erziehungsziel der Märchen diskutiert. In
dieser kontroversen Diskussion wurde dem Märchen einerseits ein repressiver Charakter
unterstellt, andererseits wurde im Märchen „etwas durchaus Subversives“ ausgemacht. Von
dem repressiven Geist sollte das Märchen wohl durch die neuen Versionen befreit werden.
Beschäftigt man sich mit Märchen, führt dies unumgänglich zur Diskussion über den
Gattungsbegriff und dessen Definition, dieser soll hier aus dem Weg gegangen werden.
Märchen deren Autor nicht bekannt ist, wie die aus der Sammlung der Gebrüder Grimm,
sollen als Volksmärchen, solche von namentlich bekannten Autoren als Kunstmärchen oder,
wenn es sich um Neufassungen von Volksmärchen handelt, als Neufassung bezeichnet
werden.
In dieser Arbeit soll gezeigt werden, wie Rühmkorf durch seine Märchen an der Diskussion
über das Erziehungsziel teilnahm. Ob sich seine Märchen in eine Reihe mit Märchen anderer Autoren stellen lassen, oder ob sie sich von ihnen unterscheiden. Am Ende gilt es schließlich
die Frage zu beantworten, ob Rühmkorfs Märchen in sein Parodiekonzept passen, oder ob er
mit ihnen eher in der Tradition des Antimärchen steht. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Märchen in Peter Rühmkorfs Werk
- 1.1 Auf Wiedersehen in Kenilworth
- 1.2 Der Hüter des Misthaufens
- 1.3 Märchenfragmente in „TaBu“
- 2. Märchen von Zeitgenossen
- 2.1 Märchensammlungen
- 2.1.1 Märchen, Sagen und Abenteuergeschichten auf alten Bilderbogen, neu erzählt von Autoren unserer Zeit.
- 2.1.2 Iring Fetscher: Wer hat Dornröschen wachgeküsst? Das Märchen-Verwirrbuch.
- 2.2 Binnenmärchen in Günter Grass' „Der Butt“ und Ingeborg Bachmanns „Malina“
- 2.1 Märchensammlungen
- 3. Vergleich von zwei Märchen aus „Der Hüter des Misthaufens“ mit Märchen anderer Autoren
- 3.1 Peter Rühmkorf „Rotkäppchen und der Wolfspelz“ und Iring Fetscher „Rotschöpfchen und der Wolf“
- 3.2 Peter Rühmkorf „Blaubarts letzte Reise“ und Heinz von Cramer „Ritter Blaubart“
- 4. Eine Gattung für die Märchen Rühmkorfs
- 4.1 Peter Rühmkorfs Parodie Konzept
- 4.2 Peter Rühmkorfs Märchen: Antimärchen oder Parodie?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Peter Rühmkorfs Märchen im Kontext der Märchenliteratur der 1970er und 1980er Jahre. Sie analysiert Rühmkorfs Beitrag zur zeitgenössischen Märchen-Diskussion, insbesondere im Hinblick auf deren Erziehungsziel. Ein weiterer Schwerpunkt liegt im Vergleich seiner Märchen mit Werken anderer Autoren und der Einordnung seiner Werke in das eigene Parodiekonzept.
- Rühmkorfs Beitrag zur zeitgenössischen Märchenliteratur
- Vergleich von Rühmkorfs Märchen mit Neufassungen bekannter Volksmärchen
- Analyse von Rühmkorfs Parodiekonzept und dessen Anwendung in seinen Märchen
- Die Frage nach der Gattung: Antimärchen oder Parodie?
- Einordnung von Rühmkorfs Märchen in den literarischen Kontext der Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den literarischen Kontext von Peter Rühmkorfs Märchen, eingebettet in den Trend der 1970er Jahre, der sich durch Neufassungen bekannter Volksmärchen und die Integration von Märchenelementen in Romane auszeichnete. Sie skizziert die Forschungsfrage nach Rühmkorfs Beitrag zu dieser Debatte und kündigt die methodische Vorgehensweise der Arbeit an, die den Vergleich seiner Märchen mit Werken anderer Autoren und die Analyse seines Parodiekonzepts beinhaltet.
1. Märchen in Peter Rühmkorfs Werk: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über Rühmkorfs Märchenveröffentlichungen, konzentriert sich aber vor allem auf die beiden Neufassungen, die in den folgenden Kapiteln genauer untersucht werden. Die Wahl der Neufassungen wird damit begründet, dass die Diskussion um Märchen in dieser Zeit vor allem die alten Volksmärchen betraf und die vielen anderen Neufassungen Vergleichsmöglichkeiten bieten.
1.1 Auf Wiedersehen in Kenilworth: Dieses Kapitel beschreibt Rühmkorfs erstes Märchen, „Auf Wiedersehen in Kenilworth“, eine Einzelveröffentlichung mit ungewöhnlicher Länge für ein Märchen. Die Handlung, die die wundersame Verwandlung eines Aufsehers in eine Katze und einer Katze in ein Mädchen beinhaltet, wird kurz zusammengefasst. Der Fokus liegt auf der märchenhaften Struktur des Textes, insbesondere der wundersamen Verwandlung und dem räumlichen Wechsel zwischen Kenilworth, Rom und Indien. Die fehlende Rückverwandlung wird angemerkt.
1.2 Der Hüter des Misthaufens: Dieses Kapitel behandelt Rühmkorfs Märchenband „Der Hüter des Misthaufens – Aufgeklärte Märchen“, der neben eigenen Märchen auch zwei Neufassungen bekannter Volksmärchen enthält. Der Fokus liegt auf der Diskussion der beiden Neufassungen: "Rotkäppchen und der Wolfspelz" und "Blaubarts letzte Reise". Die Einordnung in den Kontext der vielen anderen Neufassungen von Volksmärchen wird hervorgehoben. Es wird angedeutet, dass Rühmkorfs Märchen sich von anderen Neufassungen abgrenzen.
Schlüsselwörter
Peter Rühmkorf, Märchen, Volksmärchen, Neufassung, Parodie, Antimärchen, Zeitgenössische Literatur, Erziehungsziel, Gattungsbegriff, Intertextualität, Vergleichende Literaturwissenschaft
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse von Peter Rühmkorfs Märchen
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Märchen von Peter Rühmkorf im Kontext der Märchenliteratur der 1970er und 1980er Jahre. Der Fokus liegt auf Rühmkorfs Beitrag zur zeitgenössischen Märchen-Diskussion, insbesondere hinsichtlich deren Erziehungsziel, einem Vergleich seiner Märchen mit Werken anderer Autoren und der Einordnung seiner Werke in sein eigenes Parodiekonzept. Die Arbeit untersucht Neufassungen bekannter Volksmärchen und die Integration von Märchenelementen in Romane.
Welche Märchen von Peter Rühmkorf werden untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich hauptsächlich auf zwei Werke: „Auf Wiedersehen in Kenilworth“ (Einzelveröffentlichung) und die Märchen aus dem Band „Der Hüter des Misthaufens – Aufgeklärte Märchen“, insbesondere die Neufassungen von „Rotkäppchen und der Wolfspelz“ und „Blaubarts letzte Reise“. Weitere Märchenfragmente in „TaBu“ werden ebenfalls erwähnt.
Welche anderen Autoren werden im Vergleich herangezogen?
Die Arbeit vergleicht Rühmkorfs Märchen mit Werken anderer Autoren, darunter Iring Fetscher (z.B. „Wer hat Dornröschen wachgeküsst? Das Märchen-Verwirrbuch“ und „Rotschöpfchen und der Wolf“) und Heinz von Cramer („Ritter Blaubart“). Die Arbeit bezieht sich auch auf die Märchensammlungen der Zeit und Märchen in Werken von Günter Grass („Der Butt“) und Ingeborg Bachmann („Malina“).
Wie wird die Methode der Analyse beschrieben?
Die Arbeit nutzt eine vergleichende Literaturwissenschaftliche Methode. Sie analysiert die Struktur, die Handlung und die Thematik von Rühmkorfs Märchen im Vergleich zu anderen Werken und untersucht Rühmkorfs Parodiekonzept. Die Einordnung von Rühmkorfs Märchen in den literarischen Kontext der Zeit spielt eine wichtige Rolle.
Welche zentralen Themen werden behandelt?
Zentrale Themen sind Rühmkorfs Beitrag zur zeitgenössischen Märchenliteratur, der Vergleich seiner Märchen mit Neufassungen bekannter Volksmärchen, die Analyse seines Parodiekonzepts und dessen Anwendung in seinen Märchen, die Frage nach der Gattung (Antimärchen oder Parodie?), und die Einordnung seiner Märchen im literarischen Kontext der Zeit. Die Arbeit untersucht auch die Frage nach dem Erziehungsziel von Märchen.
Welche Kapitel beinhaltet die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Märchen in Peter Rühmkorfs Werk (inkl. Unterkapitel zu „Auf Wiedersehen in Kenilworth“ und „Der Hüter des Misthaufens“), Märchen von Zeitgenossen, Vergleich von zwei Märchen aus „Der Hüter des Misthaufens“ mit Märchen anderer Autoren, und Eine Gattung für die Märchen Rühmkorfs (inkl. Unterkapitel zu Rühmkorfs Parodiekonzept und der Frage nach Antimärchen oder Parodie).
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Peter Rühmkorf, Märchen, Volksmärchen, Neufassung, Parodie, Antimärchen, Zeitgenössische Literatur, Erziehungsziel, Gattungsbegriff, Intertextualität, Vergleichende Literaturwissenschaft.
- Citar trabajo
- Michael Kossack (Autor), 2001, Peter Rühmkorfs Märchen - Anders als die der ART-Genossen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/6851