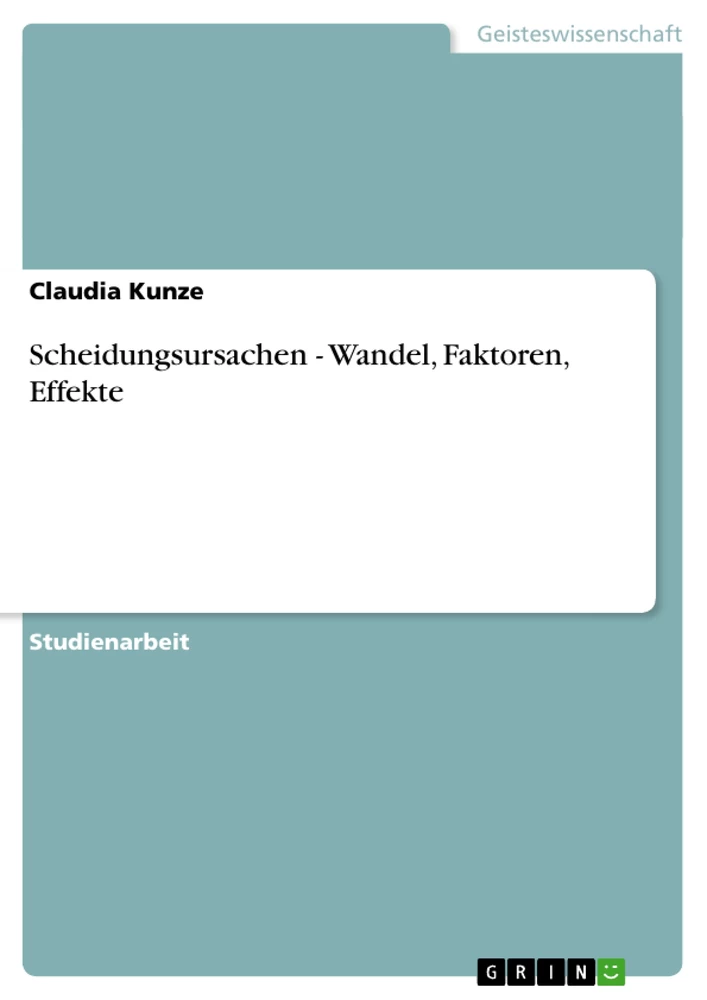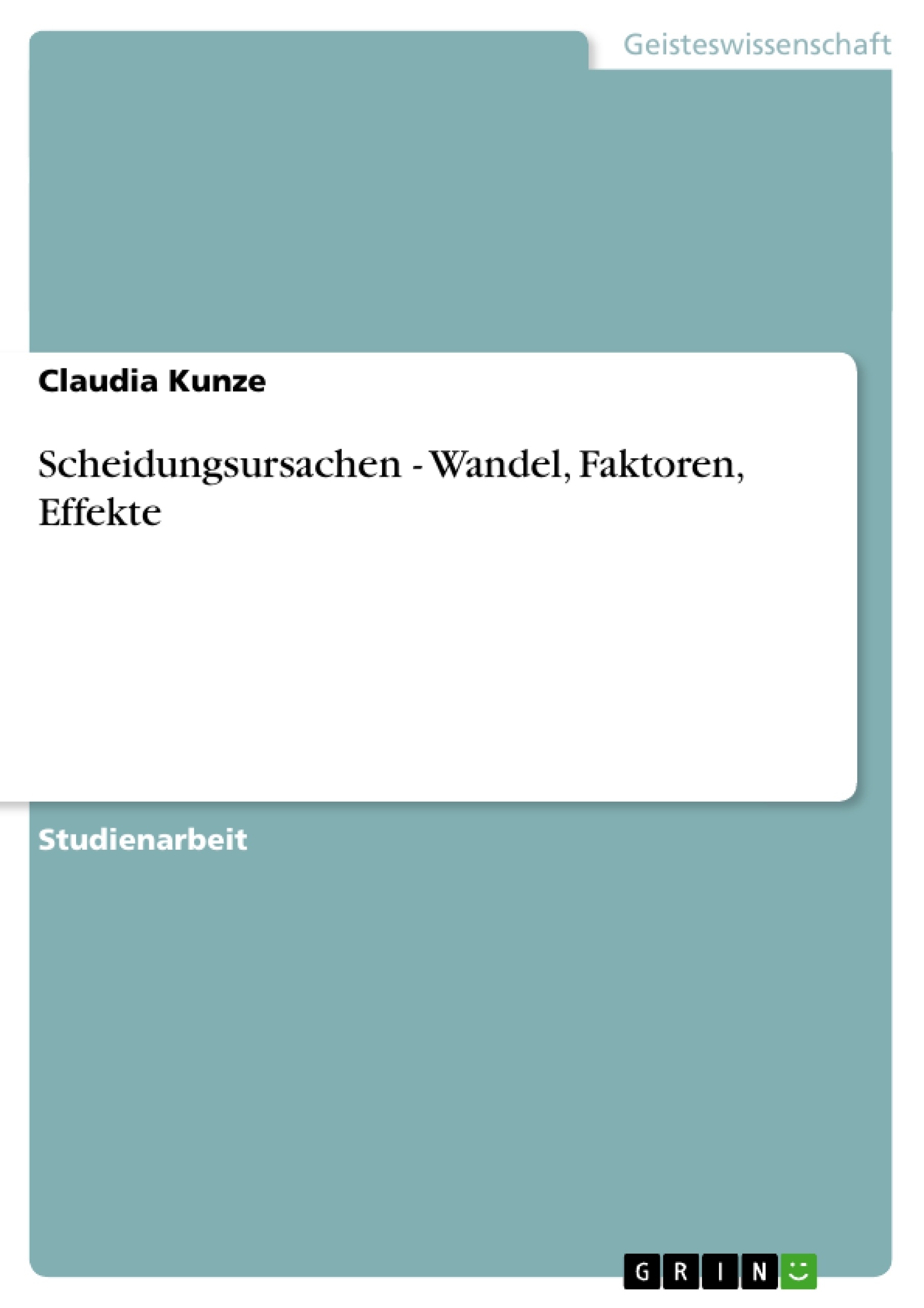In dieser Hausarbeit werde ich zunächst auf die Entwicklung der Scheidungszahlen in Deutschland eingehen und einen Vergleich mit Scheidungsraten aus dem restlichen Europa ziehen. Dann soll es um die Aussagefähigkeit von Scheidungsraten gehen, welche Angaben sie beinhalten und welche nicht.
Um allgemeine gesellschaftliche Trends und Entwicklungen in der Bevölkerung, die Auswirkungen auf die Scheidungsraten haben, soll es in dem dritten Abschnitt gehen. Dabei werde ich besonders auf die Unterschiede der Entwicklungen in der ehemaligen DDR und der frühen Bundesrepublik eingehen.
Der vierte Abschnitt ist den soziodemographischen Faktoren gewidmet. Hier wird eine Auswahl der das Scheidungsrisiko beeinflussenden soziodemographischen Faktoren auf ihre Effekte geprüft und nach eventuell unterschiedlichen Auswirkungen und Relevanz in der ehemaligen DDR und der frühen Bundesrepublik dargestellt.
Subjektive Scheidungsursachen aus Sicht der Geschiedenen sind Gegenstand des fünften Abschnittes. Den Abschluss bildet der Ausblick auf eine mögliche zukünftige Entwicklung der Scheidungszahlen im sechsten Kapitel.
Alle Angaben und Aussagen beziehen sich nur auf das Scheidungsrisiko von Erst-Ehen. Zweit-Ehen bleiben aufgrund des Umfanges der Thematik weitestgehend unberücksichtigt. Generell ist jedoch festzuhalten, dass bei Zweit-Ehen aufgrund der schlechteren Ausgangsbedingungen das Scheidungsrisiko grundsätzlich höher als bei Erst-Ehen ist.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Entwicklung der Scheidungszahlen
- 3 Allgemeine Trends und gesellschaftliche Entwicklung
- 4 Soziodemographische Faktoren
- 4.1 Heiratsalter
- 4.2 Ehedauer
- 4.3 Konfession
- 4.4 Wohnortgröße
- 4.5 Kinderzahl
- 4.6 Soziale Schicht
- 4.7 Einkommen
- 4.8 Bildungsniveau
- 4.9 Berufsposition
- 4.10 Intergenerationale Transmission
- 4.11 Kalendarischer Zeitablauf
- 4.12 Lebensführung und Persönlichkeit
- 5 Subjektive Scheidungsgründe
- 6 Schluss und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Ursachen von Scheidungen in Deutschland und die Faktoren, die die Ehestabilität beeinflussen. Das Ziel ist es, das Scheidungsrisiko zu verstehen und mögliche Strategien zur Stärkung von Ehen aufzuzeigen.
- Entwicklung der Scheidungszahlen in Deutschland im historischen Kontext
- Einfluss soziodemografischer Faktoren auf die Scheidungsrate
- Gesellschaftliche Trends und ihre Auswirkungen auf Ehen
- Subjektive Scheidungsgründe aus Sicht der Betroffenen
- Vergleich der Entwicklungen in der ehemaligen DDR und der Bundesrepublik
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Scheidungen ein und beschreibt die persönliche Motivation der Autorin, die Ursachen von Scheidungen zu erforschen. Sie hebt die weitreichenden Folgen von Scheidungen für Kinder hervor und betont die Bedeutung der Untersuchung von Faktoren, die die Ehestabilität beeinflussen. Die Arbeit konzentriert sich auf Erst-Ehen und skizziert den Aufbau der folgenden Kapitel.
2 Entwicklung der Scheidungszahlen: Dieses Kapitel analysiert den Verlauf der Scheidungszahlen in Deutschland von 1888 bis 1986. Es zeigt einen deutlichen Anstieg der Scheidungsrate, der durch verschiedene historische Ereignisse und gesellschaftliche Veränderungen erklärt wird, wie beispielsweise die Industrialisierung, die Weltkriege und die Scheidungsreform von 1977. Die Autorin diskutiert die Auswirkungen von Gesetzesänderungen auf die Scheidungsraten und vergleicht die Situation mit anderen europäischen Ländern, wobei sie auf die unterschiedlichen Einflüsse von wirtschaftlichen und sozialen Faktoren eingeht.
3 Allgemeine Trends und gesellschaftliche Entwicklung: Dieses Kapitel beleuchtet allgemeine gesellschaftliche Trends und Entwicklungen, die die Scheidungsraten beeinflussen. Es wird ein besonderer Fokus auf die Unterschiede in der Entwicklung der Scheidungsraten in der ehemaligen DDR und der Bundesrepublik gelegt, unter Berücksichtigung von Faktoren wie unterschiedliche gesellschaftliche Normen und wirtschaftliche Bedingungen. Die Analyse wird durch den Vergleich von historischen Daten unterstützt, um die Entwicklung im Laufe der Zeit zu zeigen.
4 Soziodemographische Faktoren: In diesem Kapitel werden verschiedene soziodemografische Faktoren untersucht, die das Scheidungsrisiko beeinflussen. Hierzu zählen u.a. Heiratsalter, Ehedauer, Konfession, Wohnortgröße, Kinderzahl, soziale Schicht, Einkommen, Bildungsniveau und Berufsposition. Die Autorin analysiert den Einfluss jedes Faktors auf die Scheidungsrate und betrachtet mögliche Unterschiede zwischen der ehemaligen DDR und der Bundesrepublik. Der Kapitel untersucht auch intergenerationale Transmission und den Einfluss des kalendarischen Zeitablaufs und der Persönlichkeitsmerkmale der Ehepartner.
5 Subjektive Scheidungsgründe: Dieses Kapitel befasst sich mit den subjektiven Scheidungsgründen aus Sicht der Geschiedenen. Es werden die individuellen Perspektiven und Erfahrungen berücksichtigt, um ein umfassenderes Verständnis der Ursachen von Scheidungen zu gewinnen. Die Analyse berücksichtigt die Komplexität der Gründe und ermöglicht Einblicke in die emotionalen und sozialen Aspekte, die zu einer Trennung führen. Die Erkenntnisse werden in den Kontext der vorherigen Kapitel eingeordnet.
Schlüsselwörter
Scheidungsrate, Ehestabilität, Soziodemografische Faktoren, Gesellschaftliche Entwicklung, Subjektive Scheidungsgründe, Deutschland, DDR, Bundesrepublik, Heiratsalter, Ehedauer, Kinderzahl, Einkommen, Bildung, Scheidungsreform.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Ursachen von Scheidungen in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Ursachen von Scheidungen in Deutschland und die Faktoren, die die Ehestabilität beeinflussen. Sie analysiert die Entwicklung der Scheidungszahlen im historischen Kontext, den Einfluss soziodemografischer Faktoren, gesellschaftliche Trends und subjektive Scheidungsgründe.
Welche Zeiträume und Regionen werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet die Entwicklung der Scheidungszahlen in Deutschland von 1888 bis 1986 und vergleicht die Entwicklungen in der ehemaligen DDR und der Bundesrepublik Deutschland.
Welche soziodemografischen Faktoren werden untersucht?
Die Hausarbeit analysiert den Einfluss folgender soziodemografischer Faktoren auf die Scheidungsrate: Heiratsalter, Ehedauer, Konfession, Wohnortgröße, Kinderzahl, soziale Schicht, Einkommen, Bildungsniveau, Berufsposition, intergenerationale Transmission und den Einfluss des kalendarischen Zeitablaufs und der Persönlichkeitsmerkmale der Ehepartner.
Wie werden subjektive Scheidungsgründe berücksichtigt?
Die Arbeit bezieht die subjektiven Scheidungsgründe aus der Perspektive der Betroffenen mit ein, um ein umfassenderes Verständnis der Ursachen zu ermöglichen. Es werden die individuellen Erfahrungen und die emotionalen sowie sozialen Aspekte beleuchtet, die zu einer Trennung führen.
Welche gesellschaftlichen Trends werden behandelt?
Die Hausarbeit beleuchtet allgemeine gesellschaftliche Trends und Entwicklungen, die die Scheidungsraten beeinflussen. Ein besonderer Fokus liegt auf den Unterschieden in der Entwicklung der Scheidungsraten zwischen der ehemaligen DDR und der Bundesrepublik, unter Berücksichtigung von Faktoren wie unterschiedliche gesellschaftliche Normen und wirtschaftliche Bedingungen.
Welche Ziele verfolgt die Autorin?
Das Ziel der Arbeit ist es, das Scheidungsrisiko zu verstehen und mögliche Strategien zur Stärkung von Ehen aufzuzeigen. Die Autorin möchte die Ursachen von Scheidungen erforschen und die weitreichenden Folgen von Scheidungen für Kinder hervorheben.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Hausarbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Entwicklung der Scheidungszahlen, Allgemeine Trends und gesellschaftliche Entwicklung, Soziodemografische Faktoren, Subjektive Scheidungsgründe und Schluss und Ausblick. Jedes Kapitel enthält eine Zusammenfassung im Text.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Thematik der Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Scheidungsrate, Ehestabilität, Soziodemografische Faktoren, Gesellschaftliche Entwicklung, Subjektive Scheidungsgründe, Deutschland, DDR, Bundesrepublik, Heiratsalter, Ehedauer, Kinderzahl, Einkommen, Bildung, Scheidungsreform.
- Quote paper
- Magistra Artium Claudia Kunze (Author), 2003, Scheidungsursachen - Wandel, Faktoren, Effekte, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/68849