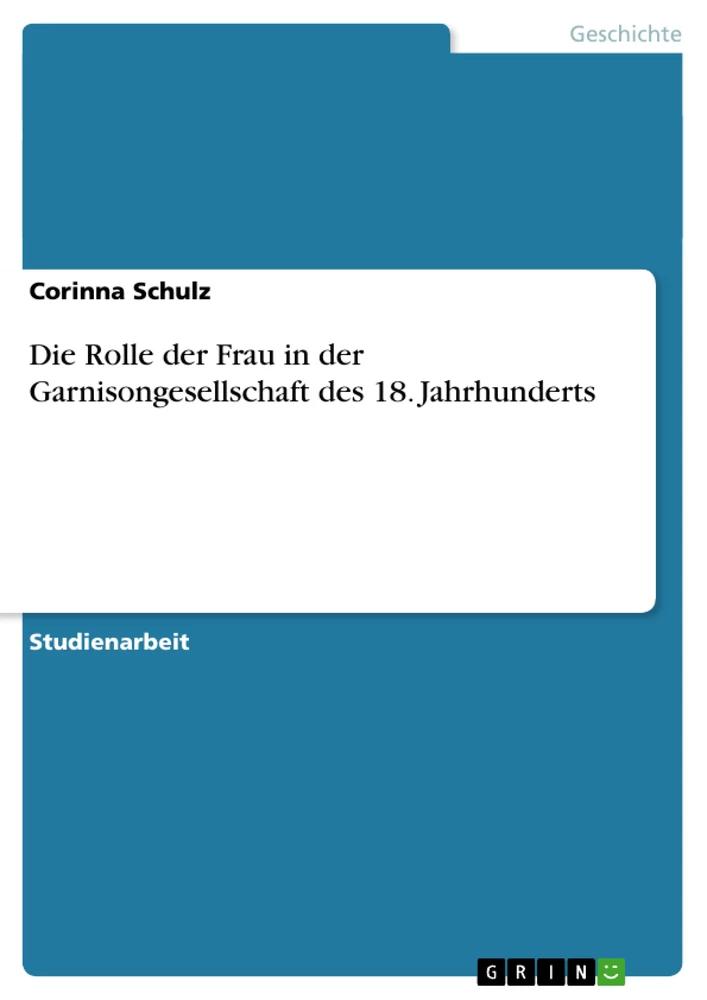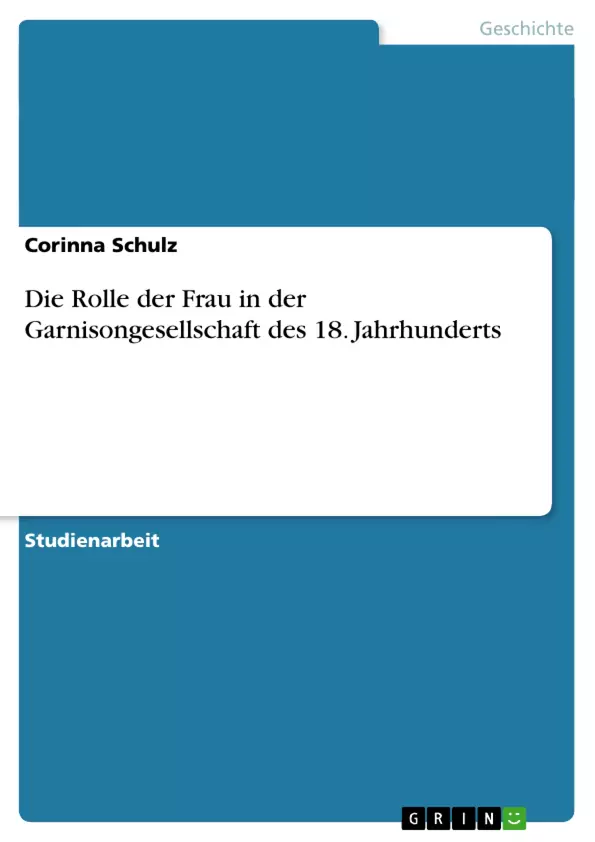Lange Zeit ging die Militärgeschichtsschreibung von einer prinzipiellen Unterscheidung zwischen der männlichen Militär- und weiblichen Zivilbevölkerung aus. Diese Differenzierung korrespondierte mit dem bürgerlichen Bild der friedfertigen und passiven Frau gegenüber dem aktiven, aggressiven Mann. Dass diese Vorstellung sich auch noch in heutiger Zeit hält, zeigt eine Veröffentlichung Crevelds, der sich zu der Aussage hinreißen lässt, dass „Krieg und Kampf nicht zu der Rolle der Frau“ gehören und dass es Aufgabe des Mannes sei, „die Frau zu beschützen, weil sie schwächer ist, und nötigenfalls für sie zu kämpfen.“ 1 Dabei verkennt diese Haltung vollkommen, dass der fast vollständige Ausschluss der Frauen aus dem Militärwesen erst zu Beginn des 19. Jahr-hunderts nach einem mehr als 150 Jahre andauernden Prozess erfolgte. Bis zu diesem Zeitpunkt war die Frau integraler Bestandteil des Trosses und auch später praktisch und rechtlich der frühneuzeitlichen Militärbevölkerung zugehörig. Das postulierte Bild des Soldaten als „zwangszölibatäre Person“ 2 muss zurückgewiesen werden. Zwar wurde dem Soldaten in der Frühen Neuzeit die Eheschließung erschwert, aber er musste nicht auf eine Partnerin an seiner Seite verzichten. Die Erforschung der Lebensumstände von Frauen im Umkreis der Armee erlaubte erst das Aufkommen der „New Military History“, die die Militärgeschichte für Fragestellungen der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte seit Ende der 1970er Jahre zumindest in der angelsächsischen Forschung, später auch im deutschsprachigen Raum, öffnete. Anstatt weiterhin Kriege, Schlachten und Taktiken in den Mittelpunkt zu stellen, rückten die wechselseitigen Beziehungen zwischen Militär und ziviler Gesellschaft in den Vor-dergrund der Untersuchungen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Soldatenfamilien
- Eheschließungen - Hindernisse und Gründe
- Broterwerb der Soldatenfrauen zu Friedens- und Kriegszeiten
- Arbeitsfelder der Frauen im Friedensalltag
- Soldatenfrauen im Krieg - „Geschleppe im Felde“?
- Das Leben ehemaliger Soldatenfrauen – Frauen von Invaliden und Abgedankten sowie Witwen
- Garnisonsgesellschaft versus Zivilbevölkerung?
- Die Unterbringung der Soldatenfamilien
- Einquartierung in Bürgerhäuser - Konfliktpotential oder Integration?
- Das Leben in der Kaserne
- Wahrnehmung der Soldatenfrau in der bürgerlichen Öffentlichkeit
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert das Alltagsleben der Soldatenfrau im 18. Jahrhundert. Sie befasst sich mit der Rolle der Soldatenfrau in der Gesellschaft, ihren Lebensbedingungen und dem Verhältnis der bürgerlichen Öffentlichkeit zum weiblichen Teil des Militärs. Die Arbeit möchte die Lebensumstände der Soldatenfrauen im Kontext der Garnisonsgesellschaft näher beleuchten und die spezifischen Herausforderungen und Möglichkeiten dieser Gruppe untersuchen.
- Die rechtlichen Rahmenbedingungen der Eheschließung von Soldatenfrauen
- Die Erwerbsmöglichkeiten von Soldatenfrauen in Kriegs- und Friedenszeiten
- Das Integrationspotential der Unterbringung von Soldatenfamilien in Bürgerhäusern
- Die Gründe für die ablehnende Haltung des Bürgertums gegenüber den Soldatenfrauen
- Die Beziehung zwischen Militärgesellschaft und bürgerlichem Umfeld
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit vor und beleuchtet die Entwicklung der Militärgeschichtsschreibung im Hinblick auf die Rolle der Frau. Sie betont die Bedeutung der „New Military History“ für die Untersuchung sozialer und wirtschaftlicher Aspekte der Militärgeschichte und thematisiert die Forschungslücke bezüglich der Lebensumstände von Frauen im frühneuzeitlichen Militärwesen.
- Die Soldatenfamilien: Dieses Kapitel befasst sich mit den Lebensbedingungen von Soldatenfamilien. Es untersucht die rechtlichen Hindernisse und Gründe für Eheschließungen von Soldaten, analysiert die Erwerbsmöglichkeiten von Soldatenfrauen in Friedens- und Kriegszeiten und beleuchtet die Lebensumstände ehemaliger Soldatenfrauen, wie beispielsweise Frauen von Invaliden und Witwen.
- Garnisonsgesellschaft versus Zivilbevölkerung?: Dieses Kapitel untersucht das Verhältnis zwischen Militärgesellschaft und bürgerlicher Bevölkerung. Es analysiert die Unterbringung der Soldatenfamilien in Bürgerhäusern und die damit verbundenen Konflikte und Integrationspotentiale. Zudem wird die Wahrnehmung der Soldatenfrau in der bürgerlichen Öffentlichkeit untersucht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Themen Soldatenfrauen, Garnisonsgesellschaft, Militärgeschichte, Frühe Neuzeit, Geschlechterverhältnisse, Sozialgeschichte, Lebensumstände, Erwerbsmöglichkeiten, Integration, bürgerliche Öffentlichkeit.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielten Frauen im Militär des 18. Jahrhunderts?
Frauen waren integraler Bestandteil des Trosses und der Garnisonsgesellschaft. Sie waren oft Ehefrauen von Soldaten und leisteten wichtige wirtschaftliche Beiträge durch Dienstleistungen wie Waschen, Nähen oder Handel.
War Soldaten die Eheschließung erlaubt?
Die Eheschließung war rechtlich erschwert und oft an die Erlaubnis der Vorgesetzten gebunden, dennoch lebten viele Soldaten in festen Partnerschaften oder Familien innerhalb der Armee.
Wie verdienten Soldatenfrauen ihren Lebensunterhalt?
In Friedenszeiten arbeiteten sie oft als Wäscherinnen, Näherinnen oder Kleinhändlerinnen. Im Krieg begleiteten sie den Tross und sorgten für die Verpflegung oder Pflege der Soldaten.
Wie war das Verhältnis zwischen Soldatenfamilien und der Zivilbevölkerung?
Das Verhältnis war oft gespannt, insbesondere bei der Einquartierung in Bürgerhäuser. Die bürgerliche Öffentlichkeit nahm Soldatenfrauen oft mit Vorurteilen wahr und sah sie als Bedrohung für die soziale Ordnung.
Was änderte sich für Frauen im Militär zu Beginn des 19. Jahrhunderts?
Mit der Professionalisierung und Kasernierung der Armeen wurden Frauen zunehmend aus dem Militärwesen ausgeschlossen, was zur Trennung von (männlicher) Militär- und (weiblicher) Zivilwelt führte.
- Arbeit zitieren
- Corinna Schulz (Autor:in), 2006, Die Rolle der Frau in der Garnisongesellschaft des 18. Jahrhunderts, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/69162