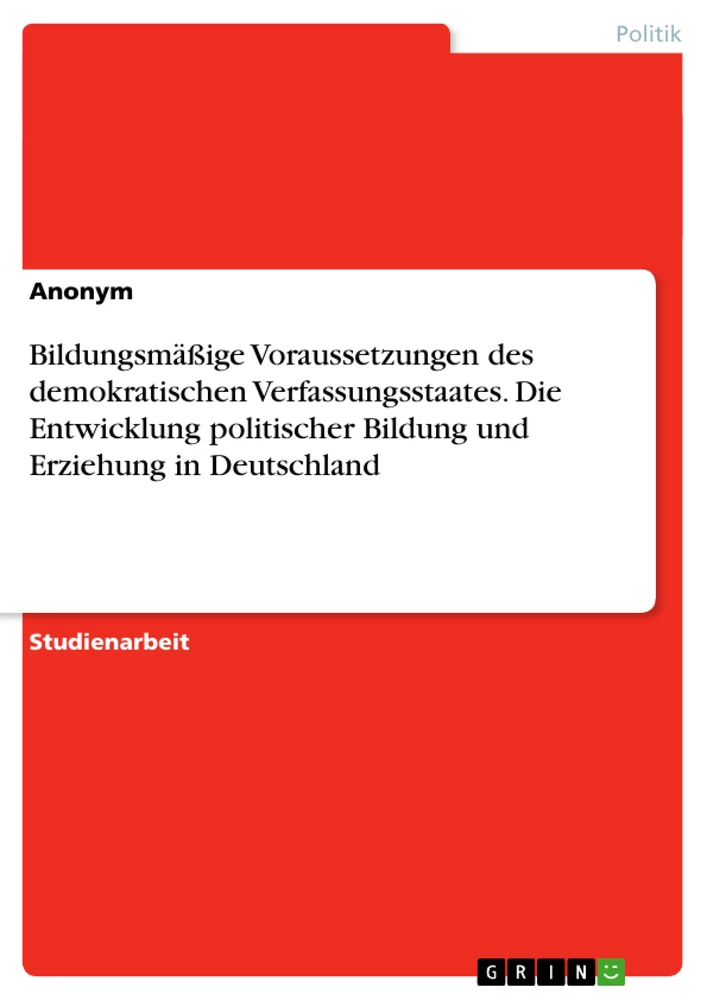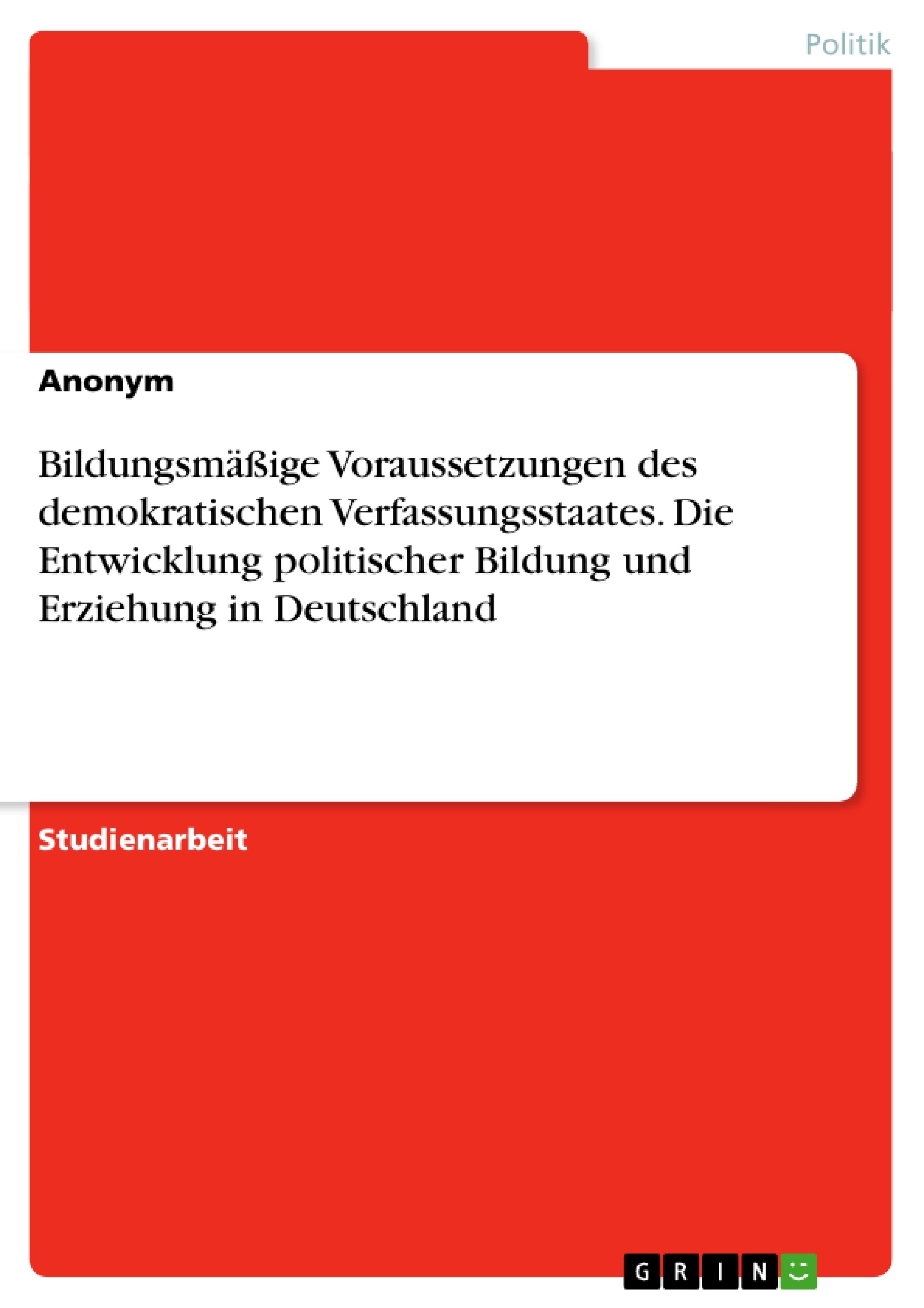Wie gebildet müssen die Bürger sein, damit man ihnen Volksabstimmungen zumuten kann? Wie ungebildet müssen Beherrschte bleiben, damit sie nicht aufbegehren? Wie hoch ist der Zusammenhang von Alphabetisierung und Demokratisierung in Entwicklungs- bzw. Trans-formationsstaaten? Wie sind das dreigliedrige Schulsystem oder Elitenförderung mit den demokratischen Idealen der Gleichheit und Freiheit zu vereinbaren?
Es lassen sich eine Vielzahl von Fragen denken, die alle unter dem Titel ‚Die bildungsmäßigen Voraussetzungen des demokratischen Verfassungsstaates’ ihren Platz fänden. In dieser Arbeit soll jedoch noch eine andere Fragestellung untersucht werden:
Wenn Ernst Wolfgang Böckenförde den Zerfall des Wertekonsens in der Gesellschaft durch die Säkularisation statuiert, eine ‚Einigkeit über das Unabstimmbare’ aber als Voraussetzung für den freiheitlich säkularisierten (demokratischen) Verfassungsstaat ansieht, dann stellt sich die Frage, wodurch diese Einigkeit noch hergestellt werden kann. Angesichts der aktuellen Debatte um den Berliner Werteunterricht - aufgrund von ‚Defiziten in der Wertevermittlung’ soll ein für alle Schüler verbindlicher, nicht religiös oder konfessionell gebundener Unterricht geschaffen werden, in dem ‚Grundwerte wie Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Solidarität und Toleranz vermittelt werden’ sollen - liegt die These nahe, dass der Staat nun versucht, den früher durch die Religion vermittelten und nun durch die Säkularisation des freiheitlich demokratischen Staates aufgelösten Konsens selber herzustellen und gleichsam den Gegenbeweis zu Böckenförde anzutreten, der sagt, der Staat könne die Voraussetzungen, von denen er lebt, nicht selber garantieren. Um diese These angemessen überprüfen zu können, soll in dieser Arbeit bei der antiken Philosophie angeknüpft werden, der der Gedanke einer Erziehung durch den Staat zum Zwecke der Erhaltung des Staates durchaus nicht fremd war. Dass die (antike) politische Philosophie Maßstäbe zur Analyse von aktuellen politischen Problemen bieten kann, denken auch andere, da „[...] es für die politische Philosophie so etwas gibt wie die heuristische Relevanz ‚ewiger Fragen’ aufgrund der ‚inneren’ Kontinuität der Herausforderungen auch unter wechselhaften Zeitumständen.“
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Funktion und Gestaltung der Erziehung in der antiken Staatsphilosophie
- Platon
- Aristoteles
- Platon und Aristoteles im Vergleich
- Die Entwicklung der politischen Bildung und Erziehung in Deutschland
- Zur Unterscheidung von Bildung und Erziehung
- Der Bildungsauftrag des Grundgesetzes
- Die Geschichte der politischen Bildung anhand von Bürgerleitbildern
- Neue Bereiche der politischen Erziehung
- Demokratieerziehung
- Werteunterricht in Berlin
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert die bildungsmäßigen Voraussetzungen des demokratischen Verfassungsstaates und untersucht, wie die Entwicklung der politischen Bildung und Erziehung in Deutschland zum Aufbau eines demokratischen Staatswesens beigetragen hat. Insbesondere wird die These geprüft, ob der Staat durch die Vermittlung von Werten den durch Säkularisation verlorenen Konsens wiederherstellen kann.
- Die Rolle der politischen Bildung und Erziehung in der Stabilität des Staates
- Der Einfluss der antiken Staatsphilosophie auf die politische Bildung
- Die Entwicklung der politischen Bildung in Deutschland im Kontext von Bürgerleitbildern
- Die Bedeutung des Bildungsauftrags des Grundgesetzes
- Die aktuelle Debatte um den Werteunterricht in Berlin
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Die Einleitung stellt die zentrale Fragestellung der Hausarbeit vor: Wie können die bildungsmäßigen Voraussetzungen des demokratischen Verfassungsstaates im Kontext von Säkularisation und dem Verlust des Wertekonsenses gewährleistet werden? Der Autor greift die aktuelle Debatte um den Berliner Werteunterricht auf und argumentiert, dass der Staat durch die Vermittlung von Werten versuchen könnte, den verlorenen Konsens wiederherzustellen.Die Funktion und Gestaltung der Erziehung in der antiken Staatsphilosophie
Dieses Kapitel analysiert die Ansichten von Platon und Aristoteles bezüglich der Funktion und Gestaltung der Erziehung im Idealstaat. Es wird deutlich, dass beide Philosophen die Bedeutung einer staatlich gelenkten Erziehung zur Stabilisierung des Staates betonten, jedoch unterschiedliche Modelle entwickelten.Platon
Platons Idealstaat ist ein von Philosophen geleiteter Wächterstaat, der auf der Grundlage von Gerechtigkeit und einer strikten Hierarchie aufgebaut ist. Platon argumentierte, dass die Menschen durch einen staatlichen Erziehungsplan zu tugendhaften und weisen Herrschern ausgebildet werden können, die sich nur auf das Wohl des Staates konzentrieren.Aristoteles
Aristoteles hingegen betonte die Bedeutung der Entwicklung des Einzelnen und die Notwendigkeit einer Erziehung, die den Bürgern die Fähigkeit verleiht, selbständig zu denken und zu handeln. Er plädierte für ein politisches System, das die Teilhabe der Bürger am öffentlichen Leben fördert.Platon und Aristoteles im Vergleich
Der Vergleich der beiden Philosophen zeigt, dass es zwei grundlegende Ansätze für die Gestaltung der politischen Bildung gibt: Der eine fokussiert auf die Stabilität des Staates, während der andere die Entwicklung des Einzelnen und die Förderung der Bürgerbeteiligung in den Vordergrund stellt.Schlüsselwörter
Politische Bildung, Demokratie, Verfassungsstaat, Bildungsauftrag, Säkularisation, Wertekonsens, Platon, Aristoteles, Bürgerleitbilder, Werteunterricht, Systemstabilisierung.Häufig gestellte Fragen
Was sind die bildungsmäßigen Voraussetzungen für eine stabile Demokratie?
Eine stabile Demokratie benötigt Bürger, die über politische Bildung verfügen und einen gewissen Wertekonsens (wie Freiheit und Gleichheit) teilen, um das System zu tragen.
Was besagt das Böckenförde-Diktum im Kontext dieser Arbeit?
Böckenförde argumentiert, dass der freiheitliche Staat von Voraussetzungen lebt, die er selbst nicht garantieren kann (z.B. moralische Werte). Die Arbeit prüft, ob der Staat durch politische Bildung diesen Konsens heute selbst herstellen kann.
Wie unterschieden sich Platon und Aristoteles in ihrer Erziehungsphilosophie?
Platon plädierte für eine strikt staatlich gelenkte Erziehung zur Systemstabilisierung, während Aristoteles die individuelle Entwicklung und die Befähigung zur aktiven politischen Teilhabe betonte.
Was ist das Ziel des Werteunterrichts in Berlin?
Der konfessionell ungebundene Unterricht soll Defizite in der Wertevermittlung ausgleichen und Grundwerte wie Toleranz, Solidarität und Gerechtigkeit für alle Schüler verbindlich vermitteln.
Welche Rolle spielen Bürgerleitbilder in der Geschichte der politischen Bildung?
Bürgerleitbilder spiegeln den Wandel der Erziehungsziele wider – vom loyalen Untertanen hin zum kritischen, partizipationsfähigen Bürger im demokratischen Verfassungsstaat.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2005, Bildungsmäßige Voraussetzungen des demokratischen Verfassungsstaates. Die Entwicklung politischer Bildung und Erziehung in Deutschland, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/69717