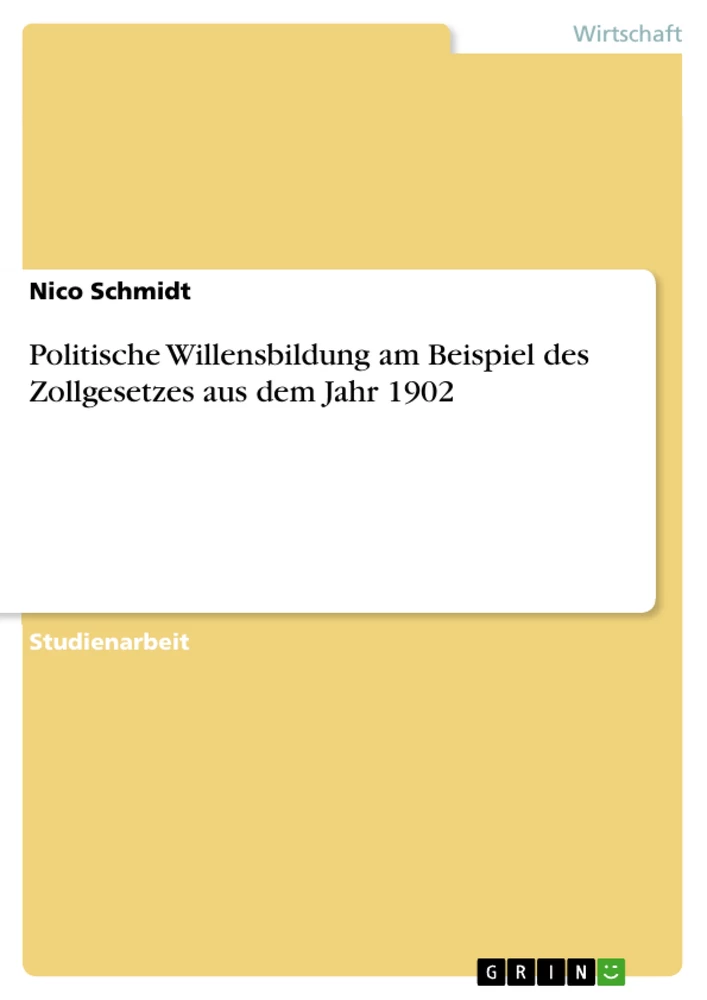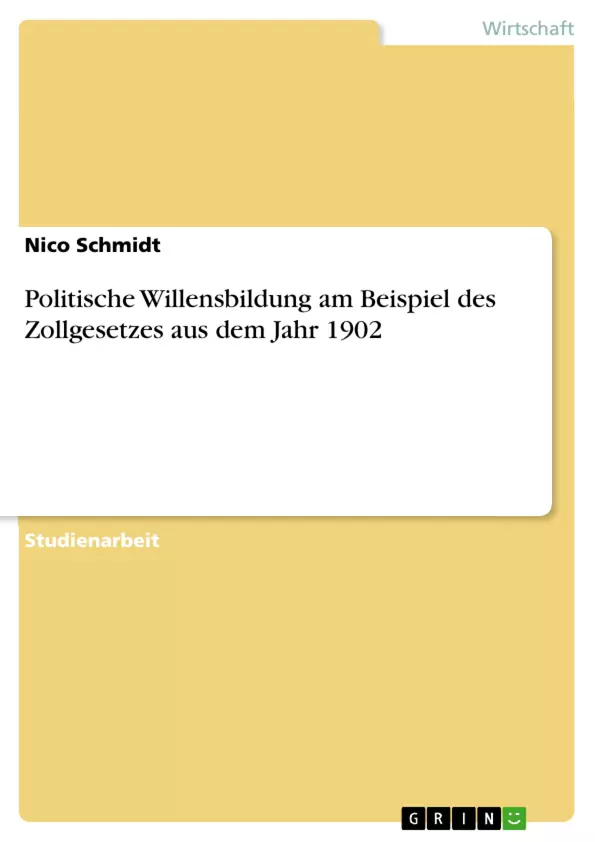Der Zollgesetzgebung kam im Deutschen Reich aus verschiedenen Gründen eine große Bedeutung zu. Zum einen stellten Zolleinnahmen zu dieser Zeit die größte Einnahmequelle des Staates dar. Zum anderen wurden sie aber auch zu einem wichtigen Finanzinstrument, da sie im Vergleich zu Steuern einfacher zu erheben waren. Da es dem Staat durch Zolleinnahmen möglich wurde staatliche Dienstleistungen für die Bürger zu finanzieren, wurden Zölle im gesamtwirtschaftlichen Interesse erhoben. Die Zollpolitik war aber auch aufgrund der Unzulänglichkeiten von Geld- und Fiskalpolitik, sowohl theoretisch, als auch institutionell, die einzige potentielle Möglichkeit des Staates zur Konjunkturbeeinflussung und Wiedererlangung von Wachstumsstabilität, und wurde aus diesem Grund systematisch eingesetzt: Mit Hilfe von Importzöllen wurden ausländische Anbieter diskriminiert und die heimische Ökonomie so gegen Einflüsse von außen abgeschottet. Auf Grund ihrer Bedeutung, wurden zollpolitische Fragestellungen im Kaiserreich zu Fragen der wirtschaftlichen, sozialen und politischen Gestaltung der Zukunft hochstilisiert. Verbunden war mit ihnen die Frage nach dem Wandel Deutschlands von Agrar- zum Industriestaat, gegen den sich insbesondere die Landwirtschaft werte und ihre politische Tätigkeit ausweitete, um den Verlust ihrer dominierenden Stellung zu kompensieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Überblick über historische Epochen der Zollgesetzgebung im Deutschen Reich
- Das politische System im Deutschen Reich
- Die vier Säulen des politischen Herrschaftssystems
- Die Parteien und Interessenverbände
- Das Zollgesetz von 1902
- Der Gesetzgebungsprozess
- Konsequenzen des Bülow-Tarifes
- Schlussfolgerungen und Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit analysiert die politische Willensbildung und Interessenpolitik im Deutschen Kaiserreich am Beispiel des Zollgesetzes von 1902. Sie beleuchtet den Gesetzgebungsprozess und die damit verbundenen Interessenkonflikte sowie die Auswirkungen des Zollgesetzes auf die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung des Landes.
- Entwicklung der Zollgesetzgebung im Deutschen Reich
- Politisches System und Interessengruppen
- Der Gesetzgebungsprozess des Zollgesetzes von 1902
- Konsequenzen des Zollgesetzes für Wirtschaft und Gesellschaft
- Die Rolle des Staates in der Wirtschaftspolitik
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung und Überblick über historische Epochen der Zollgesetzgebung im Deutschen Reich: Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung der Zollgesetzgebung im Deutschen Reich und stellt die verschiedenen Phasen der Zollpolitik von der Epoche des Liberalismus bis zur Einführung des Zollgesetzes von 1879 dar. Es geht auf die Herausforderungen des Übergangs von einer Agrar- zu einer Industriegesellschaft ein und zeigt die wachsende Bedeutung des Schutzzolls für die deutsche Wirtschaft.
- Das politische System im Deutschen Reich: Dieses Kapitel analysiert das politische System im Deutschen Reich und die Rolle der verschiedenen Interessengruppen, insbesondere der Parteien und Interessenverbände, im Gesetzgebungsprozess.
- Das Zollgesetz von 1902: Dieses Kapitel konzentriert sich auf den Gesetzgebungsprozess des Zollgesetzes von 1902, die verschiedenen Interessen, die daran beteiligt waren, und die Hintergründe der Entscheidung für einen Protektionismus.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe der Seminararbeit sind: Zollgesetzgebung, Protektionismus, Freihandel, politische Willensbildung, Interessenpolitik, Wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung, Deutsches Kaiserreich, Gesetzgebungsprozess, Agrar- und Industriestaat.
Häufig gestellte Fragen
Warum war das Zollgesetz von 1902 im Deutschen Reich so wichtig?
Zolleinnahmen waren die größte Einnahmequelle des Staates und dienten als Instrument zur Konjunkturbeeinflussung und zum Schutz der heimischen Wirtschaft.
Welchen Konflikt gab es zwischen Agrar- und Industriestaat?
Die Landwirtschaft wehrte sich gegen den Wandel zum Industriestaat und forderte Schutzzölle, um ihre dominierende Stellung zu sichern.
Was versteht man unter dem „Bülow-Tarif“?
Es handelt sich um das nach Reichskanzler von Bülow benannte Zollgesetz, das protektionistische Maßnahmen zur Förderung der deutschen Ökonomie festschrieb.
Welche Rolle spielten Interessenverbände im Kaiserreich?
Interessenverbände und Parteien waren zentrale Akteure in der politischen Willensbildung und beeinflussten den Gesetzgebungsprozess massiv.
Wie wirkten sich Importzölle auf ausländische Anbieter aus?
Importzölle diskriminierten ausländische Anbieter systematisch, um die heimische Wirtschaft gegen äußere Einflüsse abzuschotten.
- Citation du texte
- Nico Schmidt (Auteur), 2006, Politische Willensbildung am Beispiel des Zollgesetzes aus dem Jahr 1902, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/69798