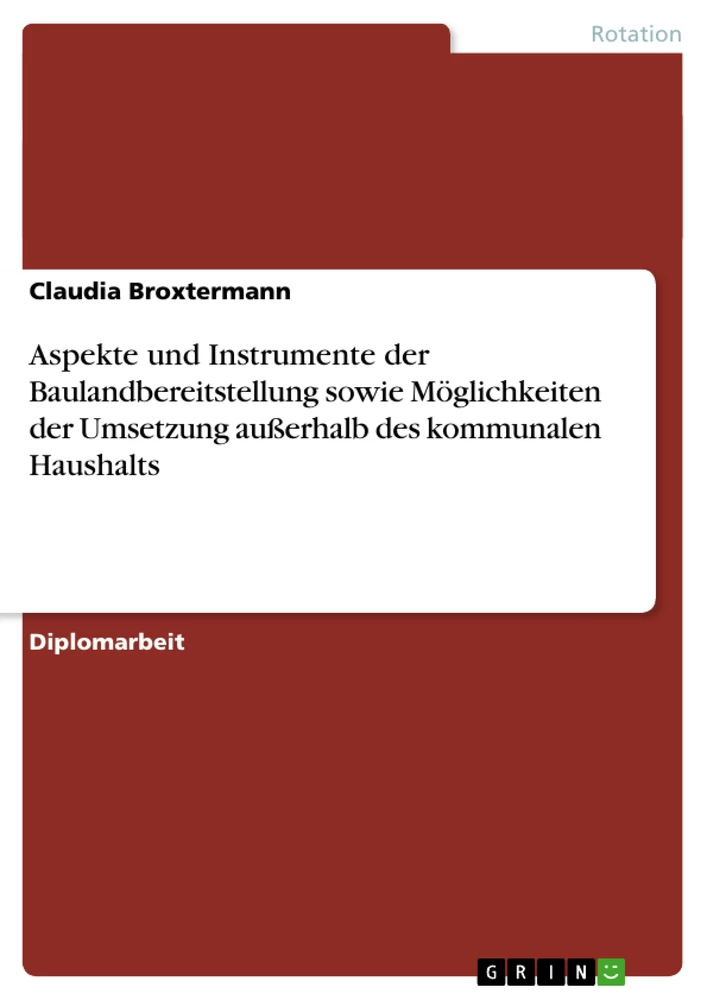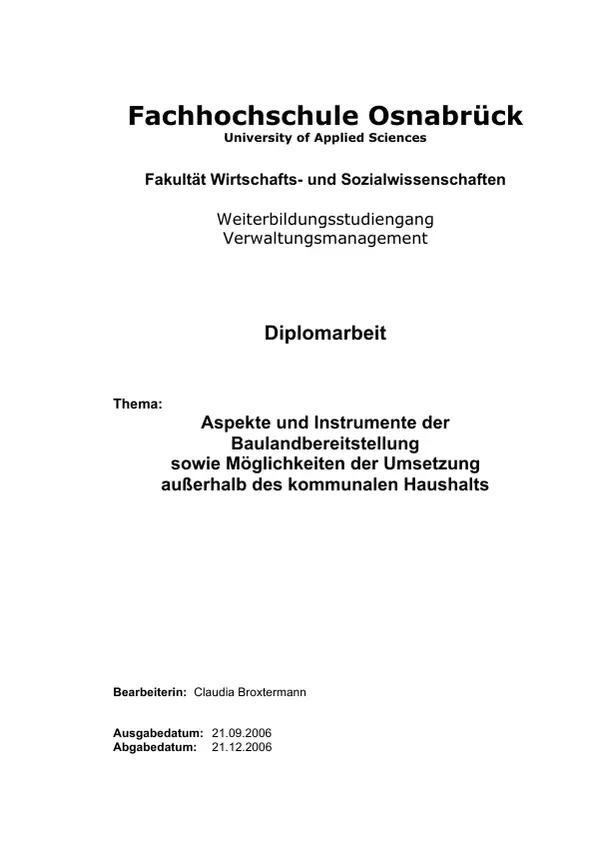Kommunale Baulandbereitstellung ist trotz in einigen Regionen zu beobachtender Bevölkerungsrückgänge weiter notwendig. Baulandbereitstellung bedeutet angesichts veränderter Rahmenbedingungen nicht mehr nur rein quantitative Bereitstellung von Flächen. Qualitative Aspekte gewinnen zunehmend an Bedeutung.
Für die kommunalen Haushalte ist in Zukunft keine nachhaltige Entspannung zu erwarten. Baulandbereitstellung darf nicht zum „Zuschussgeschäft“ werden; sie müssen sich rechnen. Auch vor diesem Hintergrund treten Finanzierungsgesichtspunkte in den Mittelpunkt der Betrachtung. Vor diesem Hintergrund schlagen viele Kommunen neue Wege bei der Baulandbereitstellung ein. Durch Gründung von Eigenbetriebe, Eigen- oder Beteiligungsgesellschaften können Aufgaben der Baulandbereitstellung aus der Verwaltung und dem städtischen Haushalt ausgegliedert werden.
Diese Arbeit stellt zunächst die aktuellen Rahmenbedingungen dar, mit denen sich die Kommunen bei der Bereitstellung von Bauland auseinanderzusetzen haben. In einem weiteren Abschnitt werden mögliche Instrumente der Baulandbereitstellung vorgestellt. Dazu werden Finanzierungsgesichtspunkte erläutert und die Notwendigkeit von städtebaulichen Kalkulationen aufgezeigt. Im Rahmen der Finanzierungsaspekte werden Formen kommunaler Unternehmen vorgestellt und untereinander verglichen. Am Ende der Arbeit werden Handlungsempfehlungen aufgezeigt, die zum einen einer wirtschaftlichen Baulandbereitstellung Rechnung trägt und zum anderen Anregungen zur Realisierung von Bauland geben, die den kommunalen Haushalt entlasten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ziel der Arbeit
- Aufbau der Arbeit
- Aspekte und Rahmenbedingungen der Baulandbereitstellung
- Kommunale Innen- und Außenentwicklung
- Bevölkerungsentwicklung und Wandel der privaten Haushalte
- Baulandbereitstellung und Siedlungsentwicklung
- Instrumente der Baulandbereitstellung nach dem allgemeinen und besonderen Städtebaurecht
- Die klassische Angebotsplanung
- Der kommunale Zwischenerwerb
- Das Umlegungsverfahren
- Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- Baulandbereitstellung durch Dritte
- Private und Landgesellschaften
- Kommunale Unternehmen
- Der Eigenbetrieb
- Die GmbH
- Die GmbH & Co KG
- Die Aktiengesellschaft
- Die Anstalt öffentlichen Rechts
- Finanzierung der Baulandbereitstellung innerhalb und außerhalb des kommunalen Haushalts
- Umsetzung der Baulandbereitstellung im kommunalen Haushalt
- Finanzierung durch Dritte außerhalb des kommunalen Haushalts
- Unterstützende Instrumente der Baulandbereitstellung
- Vertragliche Instrumente
- Der städtebauliche Vertrag
- Der Durchführungsvertrag
- Der Erschließungsvertrag
- Finanzierungsmodalitäten
- Das Zahlungs- und Verfügungsmodell
- Das Vollmachtsmodell
- Das Optionsmodell
- Steuerliche Modellformen
- Entscheidungshilfen zur Umsetzung der unterschiedlichen Möglichkeiten der Baulandbereitstellung
- Entscheidungskriterien für Ämterverwaltung oder Unternehmensgründung
- Entscheidungshilfen für eine kommunale Unternehmensform
- Die Wirtschaftlichkeitsberechnung als Entscheidungshilfe für unterschiedliche Entwicklungsalternativen
- Die städtebaulichen Kalkulation
- Typen der städtebaulichen Kalkulation
- Ausgabe- und Eingabeposten der Kalkulation
- Handlungsempfehlungen für eine nachhaltige Baulandbereitstellung
- Strategische Handlungsempfehlungen
- Operative Handlungsempfehlungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit der Baulandbereitstellung als essentieller Faktor für die Stadtentwicklung. Ziel ist es, die Aspekte und Instrumente der Baulandbereitstellung zu analysieren, wobei ein besonderes Augenmerk auf Möglichkeiten der Umsetzung außerhalb des kommunalen Haushalts gelegt wird.
- Herausforderungen der Baulandbereitstellung im Kontext von demografischem Wandel und innerstädtischer Entwicklung
- Analyse der rechtlichen Rahmenbedingungen und Instrumente der Baulandbereitstellung
- Bewertung der verschiedenen Finanzierungsmodelle innerhalb und außerhalb des kommunalen Haushalts
- Relevanz von städtebaulichen Verträgen und anderen unterstützenden Instrumenten
- Entwicklung von Handlungsempfehlungen für eine nachhaltige und effiziente Baulandbereitstellung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema Baulandbereitstellung, wobei die Zielsetzung der Arbeit und der Aufbau der einzelnen Kapitel erläutert werden. Im zweiten Kapitel werden die Aspekte und Rahmenbedingungen der Baulandbereitstellung im Kontext der kommunalen Innen- und Außenentwicklung beleuchtet. Dabei werden insbesondere die Bevölkerungsentwicklung und der Wandel der privaten Haushalte sowie die Auswirkungen auf die Siedlungsentwicklung betrachtet.
Im dritten Kapitel stehen die Instrumente der Baulandbereitstellung im Mittelpunkt. Die klassische Angebotsplanung, der kommunale Zwischenerwerb, das Umlegungsverfahren und städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen werden detailliert beschrieben. Besonderes Augenmerk liegt auf der Baulandbereitstellung durch Dritte, die im weiteren Verlauf des Kapitels näher beleuchtet wird.
Kapitel vier befasst sich mit den verschiedenen Möglichkeiten der Baulandbereitstellung durch kommunale Unternehmen. Dabei werden der Eigenbetrieb, die GmbH, die GmbH & Co KG, die Aktiengesellschaft und die Anstalt öffentlichen Rechts als relevante Unternehmensformen vorgestellt und miteinander verglichen.
Kapitel fünf widmet sich der Finanzierung der Baulandbereitstellung. Die Finanzierungsmöglichkeiten innerhalb und außerhalb des kommunalen Haushalts werden diskutiert. Dabei werden verschiedene unterstützende Instrumente wie städtebauliche Verträge, Durchführungsverträge und Erschließungsverträge sowie Finanzierungsmodalitäten wie das Zahlungs- und Verfügungsmodell, das Vollmachtsmodell und das Optionsmodell näher beleuchtet.
Im sechsten Kapitel werden die steuerlichen Modellformen im Kontext der Baulandbereitstellung analysiert. Des Weiteren werden Entscheidungshilfen für die Auswahl der geeigneten Umsetzungsform vorgestellt. Dabei werden Entscheidungskriterien für Ämterverwaltung oder Unternehmensgründung sowie für die Auswahl einer geeigneten kommunalen Unternehmensform dargestellt.
Schlussendlich wird die Wirtschaftlichkeitsberechnung als Entscheidungshilfe für verschiedene Entwicklungsalternativen in den Fokus gerückt. Die städtebaulichen Kalkulationen, ihre Typen und die relevanten Ausgabe- und Eingabeposten werden erläutert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen der Baulandbereitstellung, städtebauliche Entwicklung, kommunale Finanzwirtschaft, Finanzierungsmöglichkeiten, städtebauliche Instrumente, Rechtliche Rahmenbedingungen, Unternehmensformen und Entscheidungshilfen.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Baulandbereitstellung trotz Bevölkerungsrückgangs notwendig?
Auch bei sinkenden Bevölkerungszahlen ändern sich Haushaltsstrukturen und qualitative Ansprüche an Wohnflächen, was eine kontinuierliche, bedarfsgerechte Bereitstellung von Flächen erfordert.
Welche Instrumente der Baulandbereitstellung werden unterschieden?
Es wird zwischen klassischer Angebotsplanung, kommunalem Zwischenerwerb, Umlegungsverfahren und städtebaulichen Entwicklungsmaßnahmen unterschieden.
Welche Rechtsformen eignen sich für kommunale Unternehmen zur Baulandentwicklung?
Mögliche Formen sind Eigenbetriebe, GmbHs, GmbH & Co KGs, Aktiengesellschaften oder Anstalten öffentlichen Rechts (AöR).
Was ist ein städtebaulicher Vertrag?
Ein städtebaulicher Vertrag ist ein Instrument, mit dem die Kommune Aufgaben oder Kosten der Baulanderschließung auf private Dritte übertragen kann, um den kommunalen Haushalt zu entlasten.
Was versteht man unter kommunalem Zwischenerwerb?
Die Kommune erwirbt Rohbauland, erschließt dieses und veräußert es anschließend als baureifes Land an Investoren oder Privatpersonen weiter.
Wie hilft eine Wirtschaftlichkeitsberechnung der Kommune?
Sie dient als Entscheidungshilfe für verschiedene Entwicklungsalternativen und stellt sicher, dass die Baulandbereitstellung nicht zum „Zuschussgeschäft“ wird.
- Citation du texte
- Dipl-Ing, Dipl Kauffrau Claudia Broxtermann (Auteur), 2006, Aspekte und Instrumente der Baulandbereitstellung sowie Möglichkeiten der Umsetzung außerhalb des kommunalen Haushalts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/70267