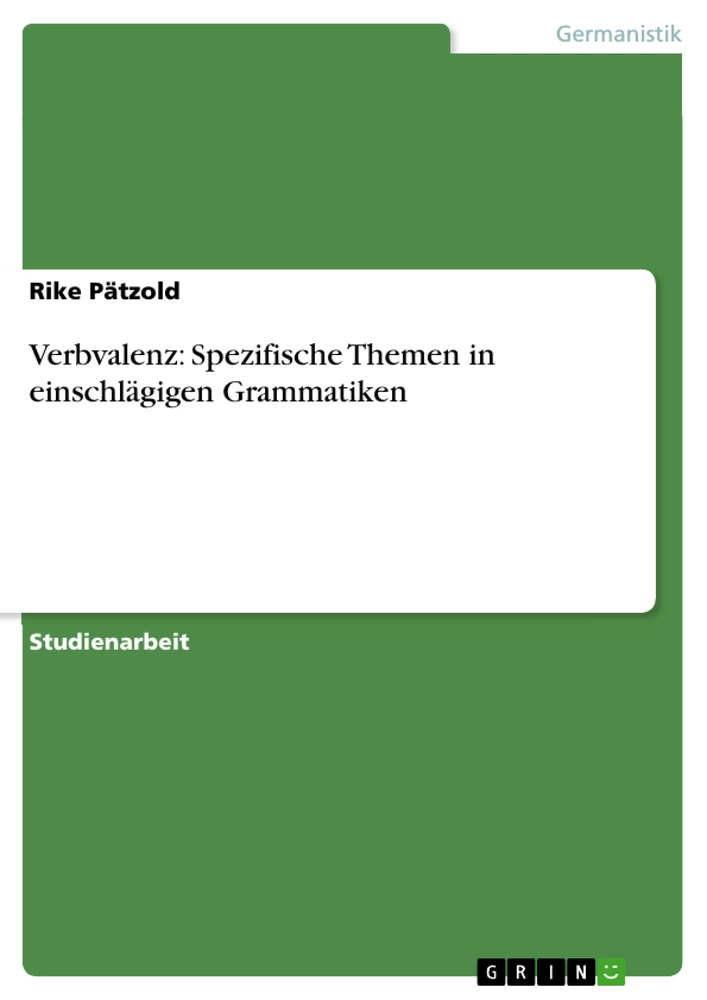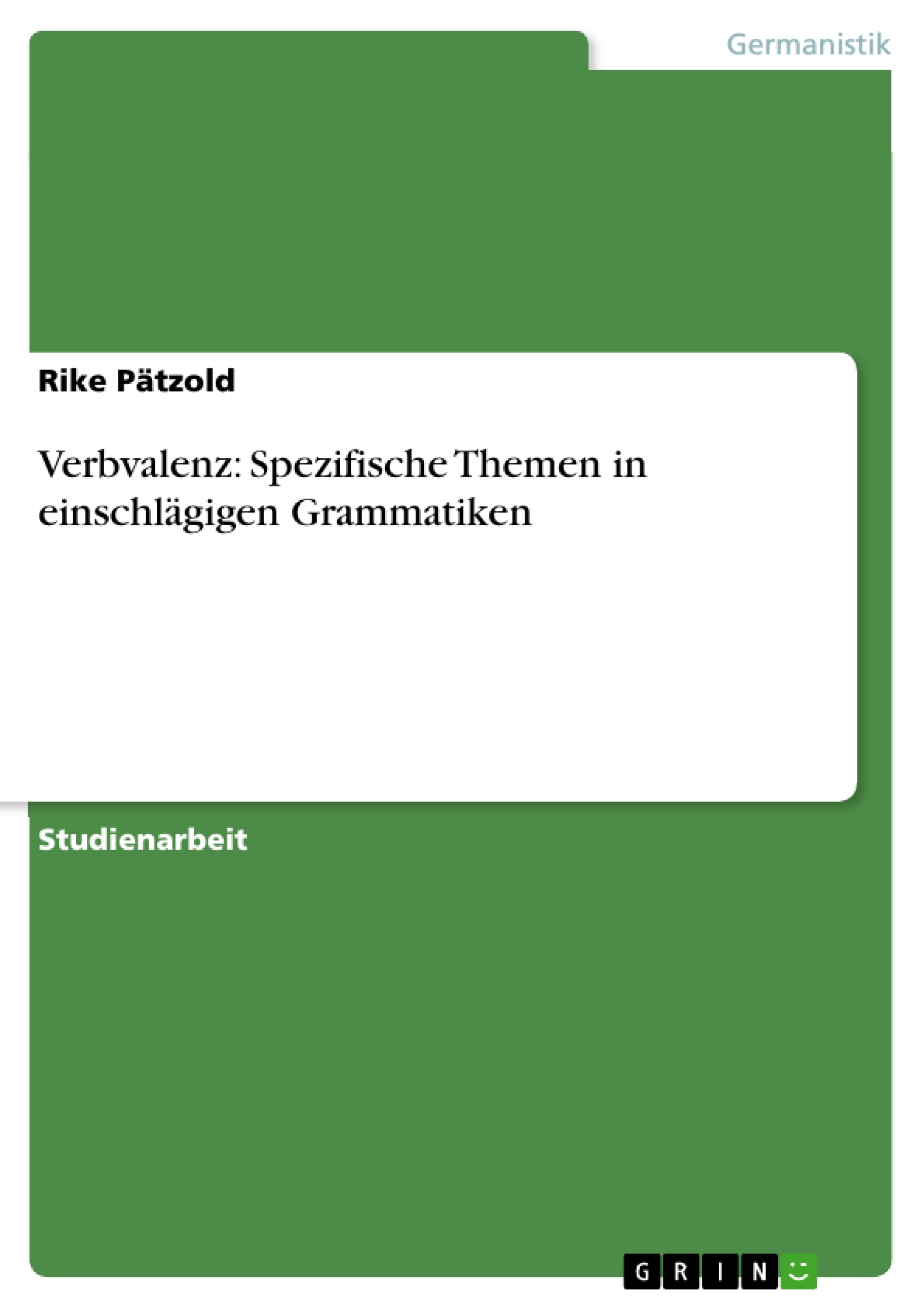Bei der syntaktischen Beschreibung eines Satzes kommt man nicht umhin, sich näher mit der Kategorie Verbund seinem direkten Umfeld auseinanderzusetzen. Dabei stößt man auf die Tatsache, dass Verben, manche mehr, manche minder, von diesem Umfeld zehren. Mit dieser Beobachtung beschäftigt sich die Valenzgrammatik, deren Namen man aus der Chemie entlehnt hat: wie auch Atome andere Atome brauchen, um vollwertig zu sein, bedürfen auch Verben Partner, um semantisch vollständig zu erscheinen. Lucien Tesnière, der als Vater des modernen Valenzbegriffs gilt, schlug als erster eine semantische umfassende Klassifikation von Verben vor. Seither beschäftigen sich die verschiedensten Grammatiken mit Begriffen wie Handlungsrolle, Aktant, Mitspieler des Verbs, Stelligkeit etc. Mit unterschiedlichen Ansätzen will man die Regelmäßigkeiten und Besonderheiten der reziproken Relation zwischen Verb und seinem sprachlichen bzw. textuellen Umfeld untersuchen und erklären. Auf zwei dieser Ansätze soll hier näher eingegangen werden. Es soll auch auf die Schwierigkeiten einer Kategorisierung hingewiesen werden.
Im ersten Kapitel soll aufgezeigt werden, wie sich Harald Weinrich in seiner Textgrammatik der deutschen Sprache mit dem Thema Verbvalenz auseinandersetzt, insbesondere auf das Stichwort Handlungsrollen(1.1), anhand derer er die Verben kategorisiert. In 1.2. wird die Verbvalenz selbst besprochen werden - welche Arten von Valenz nach Weinrich auftreten können und, wie sie zu erklären sind. Im Gegensatz zu Weinrichs semantikbetonter Abhandlung über die Wertigkeit von Verben, geht Eisenberg in seinem Kapitel Das Verb, Argumente und Satzstruktur von einer syntaktischen Valenz aus (2.), was zu einigen Unterschieden bezüglich der Anzahl und Art der vom jeweiligen Verb bemühten Mitspieler führt, worauf noch einmal explizit in meinem letzten Kapitel hingewiesen wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Weinrich, Das Verb und sein Umfeld: Handlungsrollen
- 1.1. GESPRÄCHSROLLE - HANDLUNGSROLLE
- 1.2. VERBVALENZ
- 2. Eisenberg, Das Verb: Valenz, Argumente und Satzstruktur
- 2.1. STELLIGKEIT
- 2.2. ARGUMENTSTRUKTUR
- 3. Vergleich
- 3.1. PRÄPOSITIONALGRUPPEN ALS VALENZTRÄGER?
- 3.2. SEMANTISCHE MERKMALE DER HANDLUNGSROLLEN BEI WEINRICH
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Konzepte der Verbvalenz in der deutschen Grammatik, indem sie zwei unterschiedliche Ansätze vergleicht: den semantisch orientierten Ansatz von Weinrich und den syntaktisch orientierten Ansatz von Eisenberg. Ziel ist es, die Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Ansätze aufzuzeigen und die Schwierigkeiten bei der Kategorisierung von Verbvalenzen zu beleuchten.
- Vergleichende Analyse der Verbvalenztheorien von Weinrich und Eisenberg
- Untersuchung des Konzepts der Handlungsrollen nach Weinrich
- Analyse der syntaktischen Valenz und Argumentstruktur nach Eisenberg
- Diskussion der Schwierigkeiten bei der Kategorisierung von Verbvalenzen
- Bedeutung von Kasus und Wortfolge für die Bestimmung von Handlungsrollen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Verbvalenz ein und beschreibt den Stellenwert der Valenzgrammatik in der syntaktischen Beschreibung von Sätzen. Sie hebt die Bedeutung der reziproken Relation zwischen Verb und seinem Umfeld hervor und kündigt den Vergleich zweier unterschiedlicher Ansätze – Weinrich und Eisenberg – an. Die Einleitung betont die Herausforderungen bei der Kategorisierung von Verben und ihrer Valenz.
1. Weinrich, Das Verb und sein Umfeld: Handlungsrollen: Dieses Kapitel konzentriert sich auf Harald Weinrichs Ansatz zur Verbvalenz, insbesondere auf sein Konzept der Handlungsrollen. Weinrich unterscheidet zwischen Gesprächsrollen (Sprecher, Hörer, Referenzrolle) und Handlungsrollen (Subjekt, Objekt, Partner), wobei letztere das sprachliche Umfeld des Verbs beschreiben und durch Kasus und Wortfolge markiert werden. Das Kapitel analysiert die Kombinationen von Gesprächs- und Handlungsrollen und erklärt, wie Weinrich die Wertigkeit eines Verbs durch die Art und Anzahl der Handlungsrollen definiert (qualitative und quantitative Valenz). Es werden Beispiele angeführt, um die Interaktion zwischen Gesprächs- und Handlungsrollen zu veranschaulichen und die Bedeutung der Valenz für die semantische Vollständigkeit von Verben zu verdeutlichen. Die Unterscheidung zwischen ein-, zwei- und dreiwertigen Verben wird anhand von Beispielsätzen erläutert.
2. Eisenberg, Das Verb: Valenz, Argumente und Satzstruktur: Im Gegensatz zu Weinrichs semantisch ausgerichtetem Ansatz, präsentiert dieses Kapitel Eisenbergs syntaktisch fundierte Sichtweise auf die Verbvalenz. Es konzentriert sich auf die syntaktische Valenz und die Argumentstruktur von Verben, wobei die Unterschiede zu Weinrichs Ansatz im Hinblick auf die Anzahl und Art der vom Verb benötigten Mitspieler hervorgehoben werden. Das Kapitel untersucht die Stelligkeit von Verben und ihre Argumentstrukturen, wobei die syntaktischen Beziehungen zwischen dem Verb und seinen Argumenten im Mittelpunkt stehen. Die unterschiedlichen Ansätze von Weinrich und Eisenberg werden vorbereitet für einen detaillierten Vergleich im nächsten Kapitel.
Schlüsselwörter
Verbvalenz, Handlungsrollen, Gesprächsrollen, Aktanten, Mitspieler, qualitative Valenz, quantitative Valenz, syntaktische Valenz, semantische Valenz, Weinrich, Eisenberg, Kasus, Wortfolge, Stelligkeit, Argumentstruktur, deutsche Grammatik.
Häufig gestellte Fragen zum Text "Verbvalenztheorien im Vergleich: Weinrich und Eisenberg"
Was ist der Gegenstand dieses Textes?
Der Text vergleicht die Verbvalenztheorien von Harald Weinrich und Peter Eisenberg. Er analysiert Gemeinsamkeiten und Unterschiede ihrer Ansätze, beleuchtet die Schwierigkeiten bei der Kategorisierung von Verbvalenzen und untersucht die Bedeutung von Kasus und Wortfolge für die Bestimmung von Handlungsrollen.
Welche Ansätze zur Verbvalenz werden verglichen?
Der Text vergleicht den semantisch orientierten Ansatz von Weinrich mit dem syntaktisch orientierten Ansatz von Eisenberg. Weinrich konzentriert sich auf Handlungsrollen (Subjekt, Objekt, Partner) und Gesprächsrollen (Sprecher, Hörer, Referenzrolle), während Eisenberg die syntaktische Valenz und Argumentstruktur betont.
Was sind Handlungsrollen nach Weinrich?
Nach Weinrich beschreiben Handlungsrollen das sprachliche Umfeld des Verbs und werden durch Kasus und Wortfolge markiert. Er unterscheidet sie von Gesprächsrollen, die die kommunikative Situation betreffen. Die Handlungsrollen definieren die Wertigkeit eines Verbs (qualitative und quantitative Valenz).
Was versteht Eisenberg unter syntaktischer Valenz und Argumentstruktur?
Eisenberg betrachtet die Verbvalenz aus einer syntaktischen Perspektive. Er konzentriert sich auf die syntaktische Valenz und die Argumentstruktur, d.h. die syntaktischen Beziehungen zwischen dem Verb und seinen Argumenten (Mitspielern). Die Stelligkeit des Verbs spielt dabei eine zentrale Rolle.
Welche Schwierigkeiten bei der Kategorisierung von Verbvalenzen werden diskutiert?
Der Text beleuchtet die Herausforderungen, die sich bei der eindeutigen Zuordnung von Verben zu bestimmten Valenzklassen ergeben. Die unterschiedlichen Ansätze von Weinrich und Eisenberg verdeutlichen diese Schwierigkeiten.
Welche Rolle spielen Kasus und Wortfolge bei der Bestimmung von Handlungsrollen?
Kasus und Wortfolge sind wichtige Marker für die Bestimmung der Handlungsrollen nach Weinrich. Sie tragen wesentlich zur Identifizierung der semantischen Beziehungen zwischen dem Verb und seinen Argumenten bei.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text enthält eine Einleitung, Kapitel zu Weinrichs und Eisenbergs Ansätzen, ein Vergleichskapitel und einen Schluss. Jedes Kapitel wird im Text kurz zusammengefasst.
Welche Schlüsselbegriffe werden im Text behandelt?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Verbvalenz, Handlungsrollen, Gesprächsrollen, Aktanten, Mitspieler, qualitative Valenz, quantitative Valenz, syntaktische Valenz, semantische Valenz, Weinrich, Eisenberg, Kasus, Wortfolge, Stelligkeit, Argumentstruktur, deutsche Grammatik.
Wozu dient die Zusammenfassung der Kapitel?
Die Zusammenfassung der Kapitel bietet einen Überblick über den Inhalt des gesamten Textes und erleichtert das Verständnis der einzelnen Abschnitte und ihrer Beziehungen zueinander.
Was ist die Zielsetzung des Textes?
Die Zielsetzung des Textes ist ein vergleichender Analyse der Verbvalenztheorien von Weinrich und Eisenberg, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede aufzuzeigen und die Schwierigkeiten bei der Kategorisierung von Verbvalenzen zu beleuchten.
- Arbeit zitieren
- Rike Pätzold (Autor:in), 2004, Verbvalenz: Spezifische Themen in einschlägigen Grammatiken, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/70593