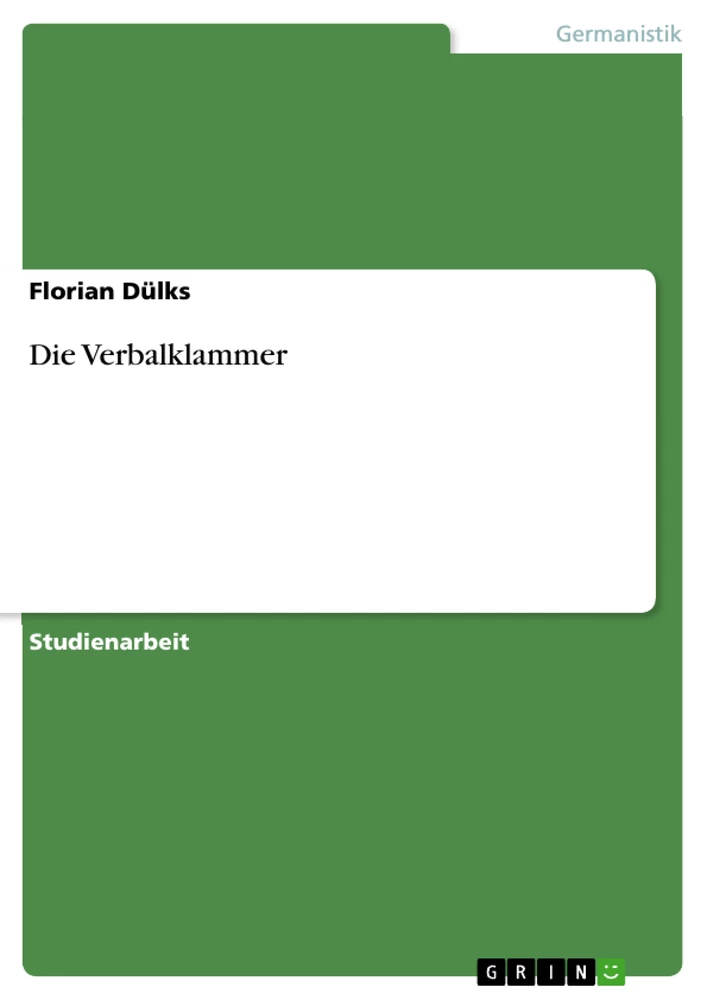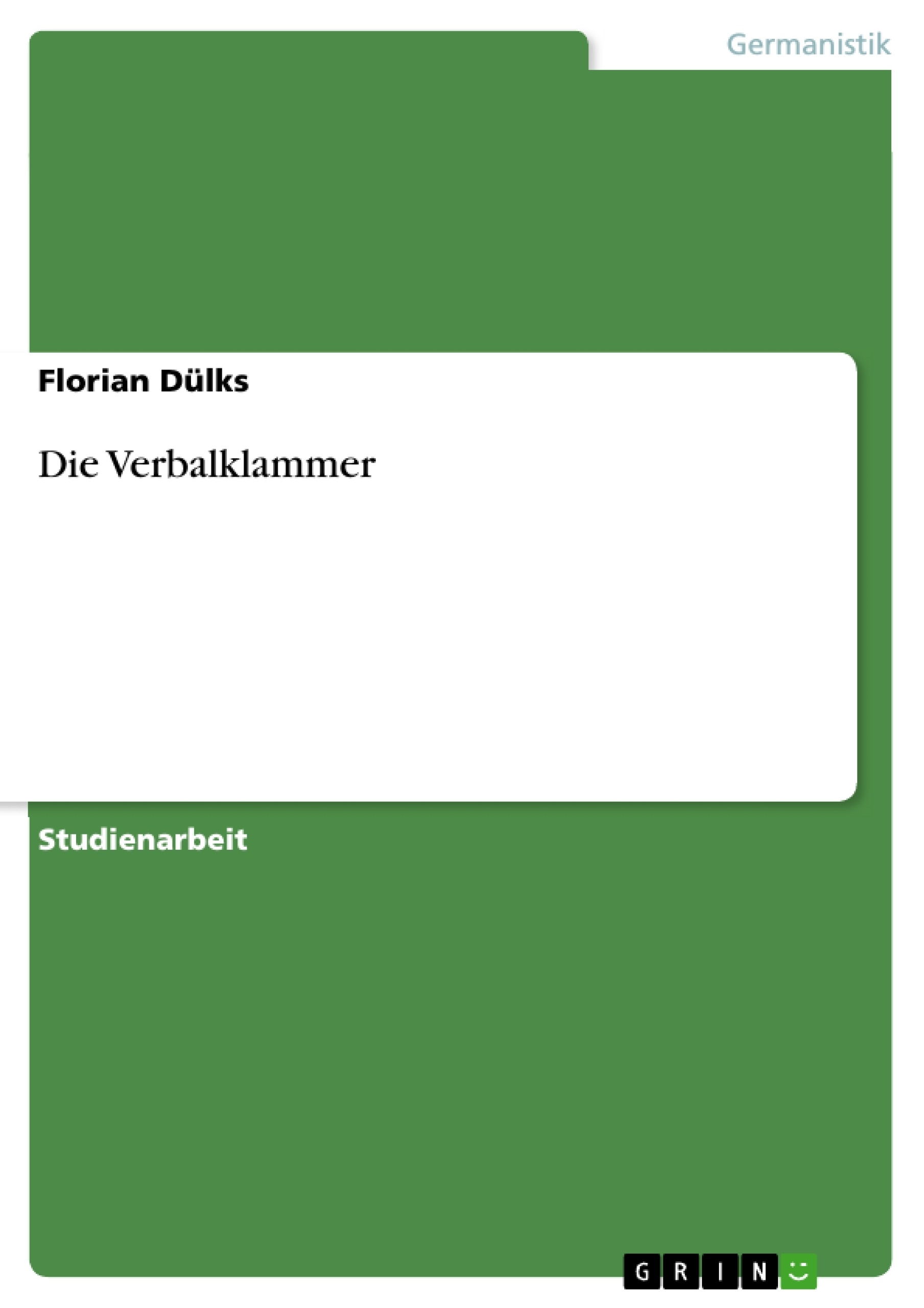In der folgenden Arbeit soll ein Vergleich angestellt werden, zwischen derdeutschen Grammatik1von Gerhard Helbig und Joachim Buscha und derTextgrammatik2von Harald Weinrich. Der Termini der Verbalklammer oder des verbalen Rahmens, wie er je nach Autor benannt wird, stellt hierbei den Fokus der Betrachtungen dar. Zunächst wird beschrieben, wie Helbig/ Buscha eine kategorische Dreiteilung der möglichen Verbstellungen im Satz vornehmen, auf dieser aufbauend dann das Konzept des verbalen Rahmens vorgestellt werden kann. Die Betrachtungen dieser Thematik fallen bei Helbig/ Buscha spärlicher aus, als in der Grammatik Weinrichs und verfolgen einen anderen Ansatz. Um diese Unterschiede herauszustellen folgt eine Darstellung der Verbalklammern bei Weinrich.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Verb im Satzmodell nach Helbig/Buscha
- Stellungstypen des deutschen Satzes
- Der verbale Rahmen
- Die Verbalklammer
- Klammerbildungen des Verbs bei Weinrich
- Adjunktklammern und kombinierte Klammern
- Klammerbildungen des Verbs bei Weinrich
- Vergleich der Grammatiken von Helbig/Buscha und Weinrich
- Methodischer Ansatz bei Helbig/Buscha
- Methodischer Ansatz bei Weinrich
- Vergleich der Einzelbetrachtungen zur Verb Stellung im Satz
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit vergleicht die Beschreibung der Verbalklammer bzw. des verbalen Rahmens in der „Deutschen Grammatik“ von Helbig/Buscha und der „Textgrammatik“ von Weinrich. Der Fokus liegt auf den unterschiedlichen methodischen Ansätzen und der konkreten Darstellung der Klammerbildung im deutschen Satz.
- Vergleich der methodischen Ansätze von Helbig/Buscha und Weinrich
- Analyse der verschiedenen Stellungstypen des Verbs im deutschen Satz nach Helbig/Buscha
- Beschreibung des Konzepts des verbalen Rahmens bei Helbig/Buscha
- Darstellung der Verbalklammern bei Weinrich
- Untersuchung der Unterschiede in der Darstellung der Verb Stellung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit vergleicht die Behandlung der Verbalklammer/des verbalen Rahmens in den Grammatiken von Helbig/Buscha und Weinrich. Sie beschreibt zunächst das Satzmodell von Helbig/Buscha mit seinen Stellungstypen und dem Konzept des verbalen Rahmens. Anschließend werden Weinrichs Verbalklammern vorgestellt. Der Vergleich der Grammatiken erfolgt durch einen Vergleich der methodischen Ansätze und der konkreten Beschreibungen der Klammerbildung. Die Arbeit konzentriert sich bewusst nur auf einen Teilaspekt der Verbstellung im Deutschen, um den Umfang zu begrenzen.
Das Verb im Satzmodell nach Helbig/Buscha: Dieses Kapitel erläutert zunächst die drei Stellungstypen des deutschen Satzes nach Helbig/Buscha, die die Position des finiten Verbs und der Prädikatsteile bestimmen. Stellungstyp 1 (Zweitstellung), Stellungstyp 2 (Erststellung) und Stellungstyp 3 (Endstellung) werden jeweils mit Beispielen illustriert. Aufbauend darauf wird das Konzept des „verbalen Rahmens“ vorgestellt, der durch die getrennte Stellung von finitem Verb und anderen Prädikatsteilen entsteht. Die Schwierigkeiten bei der Abgrenzung des Rahmens und die verschiedenen rahmenbildenden Konstruktionen werden ebenfalls diskutiert.
Die Verbalklammer: Dieses Kapitel befasst sich mit der Darstellung der Verbalklammern bei Weinrich. Es geht detailliert auf die verschiedenen Klammerbildungen ein, einschließlich Adjunktklammern und kombinierter Klammern. Die Beschreibung beinhaltet eine eingehende Analyse der grammatischen Strukturen und ihrer Funktionen im Satzbau. Es wird ein Vergleich mit der Darstellung bei Helbig/Buscha angestrebt, obwohl dieser nicht im Detail in diesem Abschnitt behandelt wird.
Schlüsselwörter
Verbalklammer, verbaler Rahmen, Verbstellung, Satzmodell, Helbig/Buscha, Weinrich, deutsche Grammatik, Textgrammatik, Satzstellungstypen, methodischer Ansatz, Vergleichende Grammatik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Vergleich der Grammatiken von Helbig/Buscha und Weinrich zur Verbstellung
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht die Beschreibung der Verbalklammer bzw. des verbalen Rahmens in der „Deutschen Grammatik“ von Helbig/Buscha und der „Textgrammatik“ von Weinrich. Der Fokus liegt auf den unterschiedlichen methodischen Ansätzen und der konkreten Darstellung der Klammerbildung im deutschen Satz.
Welche Grammatiken werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die „Deutsche Grammatik“ von Helbig/Buscha und die „Textgrammatik“ von Weinrich, wobei der Schwerpunkt auf der Darstellung der Verbstellung und der Verbalklammer/des verbalen Rahmens liegt.
Welche Aspekte der Verbstellung werden untersucht?
Die Analyse umfasst die Stellungstypen des Verbs im deutschen Satz nach Helbig/Buscha (Stellungstyp 1, 2 und 3), das Konzept des verbalen Rahmens bei Helbig/Buscha und die verschiedenen Verbalklammerbildungen nach Weinrich (inkl. Adjunktklammern und kombinierter Klammern).
Wie unterscheiden sich die methodischen Ansätze von Helbig/Buscha und Weinrich?
Die Arbeit untersucht und vergleicht die unterschiedlichen methodischen Ansätze beider Grammatiken bei der Beschreibung der Verbstellung und der Verbalklammer/des verbalen Rahmens. Ein detaillierter Vergleich der Methoden wird durchgeführt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zum Verb im Satzmodell nach Helbig/Buscha (inkl. Stellungstypen und verbalem Rahmen), ein Kapitel zur Verbalklammer nach Weinrich, ein Kapitel zum Vergleich der Grammatiken und einen Schluss. Jedes Kapitel enthält eine Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse.
Was ist der „verbale Rahmen“ nach Helbig/Buscha?
Der „verbale Rahmen“ beschreibt die getrennte Stellung des finiten Verbs und anderer Prädikatsteile im Satz nach Helbig/Buscha. Die Arbeit diskutiert die Schwierigkeiten bei der Abgrenzung und die verschiedenen rahmenbildenden Konstruktionen.
Was sind Verbalklammern nach Weinrich?
Die Arbeit beschreibt die verschiedenen Verbalklammerbildungen nach Weinrich, inklusive Adjunktklammern und kombinierter Klammern, und analysiert deren grammatische Strukturen und Funktionen im Satzbau.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Verbalklammer, verbaler Rahmen, Verbstellung, Satzmodell, Helbig/Buscha, Weinrich, deutsche Grammatik, Textgrammatik, Satzstellungstypen, methodischer Ansatz, Vergleichende Grammatik.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für akademische Zwecke bestimmt und richtet sich an Leser, die sich mit deutscher Grammatik, insbesondere der Verbstellung, im Detail auseinandersetzen möchten.
Wo finde ich weitere Informationen?
Weitere Informationen finden Sie im vollständigen Text der Arbeit (siehe Inhaltsverzeichnis oben).
- Citar trabajo
- Florian Dülks (Autor), 2006, Die Verbalklammer, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/71063