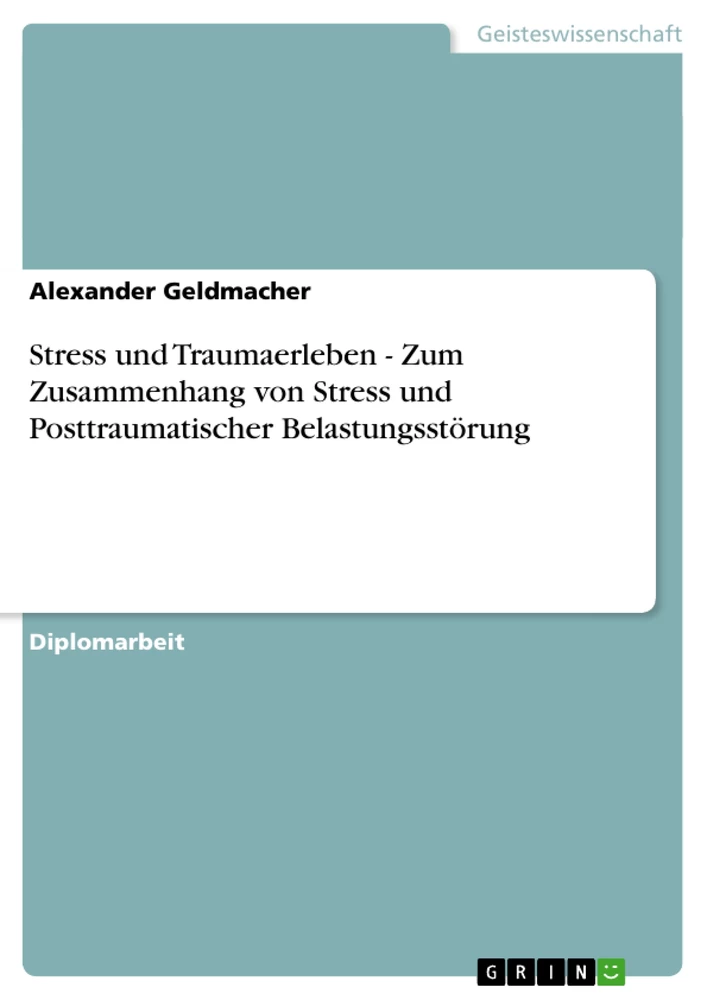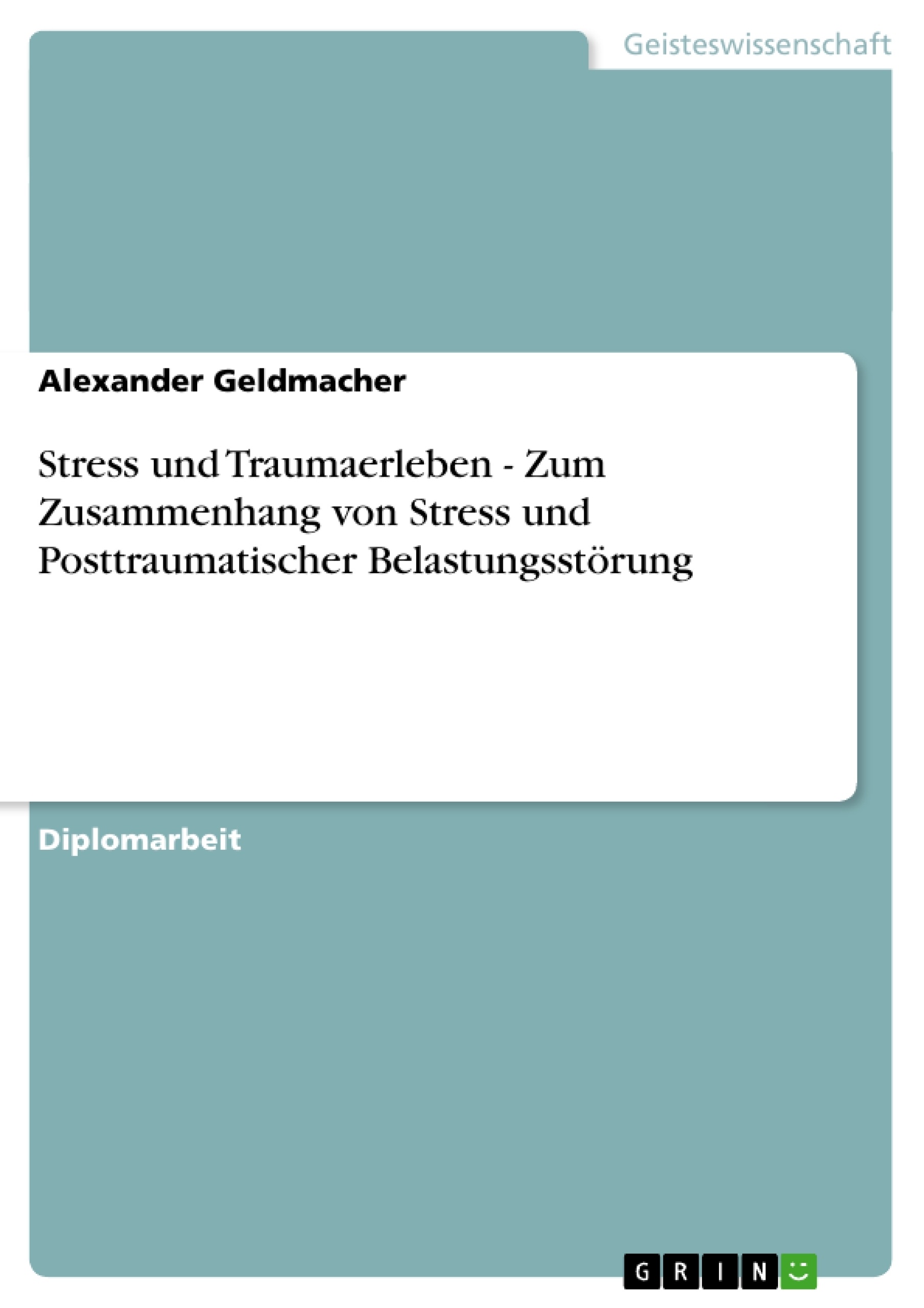In der heutigen Industriegesellschaft, in der Termindruck, Just-in-time-Produktion, Globalisierung, Veränderungsdruck und Flexibilität uns täglich begegnen, sowie die steigende Anzahl an terroristischen Anschlägen, Krisengebieten und dem vermehrten Auftreten von Naturkatastrophen, sind die Begriffe >>Stress<< und >>Trauma<< ein alltäglicher Begleiter der Menschen. Nicht ohne Grund hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) Stress zu einer der großen Gesundheitsgefahren des 21 Jahrhunderts erklärt (vgl. SCHUH/LITZCKE (2005: 2)). Die Stressfolgekosten summieren sich für Deutschland auf die unglaubliche Zahl von dreißig Milliarden Euro, mit steigender Tendenz (vgl. ebd.).
Stress und traumatische Erlebnisse sind keine Phänomene, die nur vereinzelte Personen oder Personenkreise betreffen, sie sind allgegenwärtig und wirken auf alle Lebewesen, durch alle Altersstufen und soziale Schichten. Stress ist z.B. keine Managerkrankheit, als die sie manchmal bezeichnet wird.
Das Stress und traumatische Ereignisse negative Folgen haben können, ist eine Tatsache. Allerdings sind die genauen Einflüsse, die Personen anfällig gegenüber Stress und Traumata machen sehr unterschiedlich und auch in der Wissenschaft herrscht teilweise Uneinigkeit über die unterschiedlichen Faktoren, die bei der Ätiologie eine Rolle spielen.
In dieser Arbeit werde ich die wesentlichen Stress- und PTBS-Theorien und Konzepte inklusive möglicher Behandlungs- und Bewältigungsstrategien herausstellen und ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede betonen sowie kritisch betrachten. Dabei habe ich mich auf weitestgehend Fachliteratur zu den einzelnen Themengebieten gestützt, sowie einige Dissertationen und exemplarische Studien zur empirischen Fundierung herangezogen. Als Metaanalyse ist diese Arbeit aber keinesfalls anzusehen.
Inhaltsverzeichnis
- Hinführung zum Thema
- Stress in der historischen Entwicklung – Eine Begriffsbestimmung
- Grundkonzepte der Stressforschung
- Der Reaktionsansatz
- Der Stimulusansatz
- Das transaktionale Konzept
- Ursachen
- Die Umwelt
- Das Ich
- Soziodemographische Personenmerkmale und soziökonomischer Status
- Personale Ressourcen und Vulnerabilitätsfaktoren
- Negative Affektivität
- Typ-A Verhalten
- Positive Affektivität
- Selbstwerterhaltung und Selbstwirksamkeit
- Erscheinungsformen
- Psychologische Stressreaktionen
- Physiologische Stressreaktionen
- Stresscoping
- Problemorientierte Bewältigung
- Emotionsorientierte Bewältigung
- Soziale Unterstützung
- Die Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS)
- Epidemiologie
- Die Klassifikation der PTBS in den aktuellen Diagnosesystemen
- Intrusive Symptome
- Vermeidungssymptome
- Arousal-Symptome
- Nosologie und Verlauf
- Komorbidität
- Vom Stress zum Trauma – Was macht Stress traumatisch?
- Ausgewählte Konzepte der Traumabewältigung
- Konfrontationsverfahren
- EMDR
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit von Alexander Geldmacher zielt darauf ab, den Zusammenhang zwischen Stress und Posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS) zu untersuchen. Der Autor beleuchtet die historischen Entwicklungen des Begriffs "Stress" und präsentiert verschiedene Stresskonzepte sowie deren Kritikpunkte.
- Stresskonzepte und deren Kritik
- Ursachen von Stress: Umweltfaktoren und Persönlichkeitsmerkmale
- Stressreaktionen: Physiologische und psychologische Symptome
- Stressbewältigungsstrategien: Problemorientiertes und emotionsorientiertes Coping sowie die Bedeutung sozialer Unterstützung
- Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS): Definition, Epidemiologie, Klassifikation und Komorbidität
- Faktoren, die Stress traumatisch machen: Ereignisfaktoren, Risikofaktoren und Schutzfaktoren
- Ausgewählte Konzepte der Traumabewältigung: Konfrontationstherapie und EMDR
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in das Thema Stress und Traumatisierung. Der Autor beleuchtet die historische Entwicklung des Begriffs "Stress" und präsentiert verschiedene Stresskonzepte, darunter den Reaktionsansatz, den Stimulusansatz und das transaktionale Konzept. Anschließend untersucht er die Ursachen von Stress, sowohl aus der Perspektive der Umweltfaktoren als auch der Persönlichkeitsmerkmale.
Im zweiten Teil der Arbeit widmet sich Geldmacher den Erscheinungsformen von Stress und untersucht die physiologischen und psychologischen Reaktionen auf Stress. Er geht außerdem auf verschiedene Stressbewältigungsstrategien ein, darunter problemorientiertes Coping, emotionsorientiertes Coping und die Rolle sozialer Unterstützung.
Der dritte Teil der Arbeit befasst sich mit der Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS). Geldmacher beschreibt die Definition, Epidemiologie und Klassifikation der PTBS sowie die Komorbidität mit anderen psychischen Störungen. Er untersucht die Faktoren, die Stress traumatisch machen, und analysiert die Bedeutung von Ereignisfaktoren, Risikofaktoren und Schutzfaktoren.
Abschließend stellt Geldmacher zwei Konzepte der Traumabewältigung vor: die Konfrontationstherapie und das EMDR-Verfahren.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Schlüsselbegriffen Stress, Trauma, Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS), Stressbewältigung, Coping, Soziale Unterstützung, Ereignisfaktoren, Risikofaktoren, Schutzfaktoren, Konfrontationstherapie und EMDR.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Zusammenhang zwischen Stress und PTBS?
Eine Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) kann entstehen, wenn Stress durch ein traumatisches Ereignis so extrem wird, dass die normalen Bewältigungsmechanismen versagen.
Welche Stresskonzepte gibt es in der Forschung?
Die Forschung unterscheidet primär zwischen dem Reaktionsansatz, dem Stimulusansatz und dem transaktionalen Konzept (Stress als Wechselwirkung zwischen Person und Umwelt).
Was sind typische Symptome einer PTBS?
Dazu gehören intrusive Symptome (Flashbacks, Alpträume), Vermeidung von Reizen, die an das Trauma erinnern, und ein erhöhtes Erregungsniveau (Arousal).
Was versteht man unter Stresscoping?
Coping bezeichnet Bewältigungsstrategien, die entweder problemorientiert (Änderung der Situation) oder emotionsorientiert (Umgang mit den Gefühlen) sein können.
Was ist die EMDR-Methode?
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) ist ein anerkanntes Verfahren zur Traumabearbeitung, bei dem durch gezielte Augenbewegungen die Verarbeitung belastender Erinnerungen im Gehirn angestoßen wird.
- Quote paper
- Dipl.-Päd. Alexander Geldmacher (Author), 2006, Stress und Traumaerleben - Zum Zusammenhang von Stress und Posttraumatischer Belastungsstörung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/72352