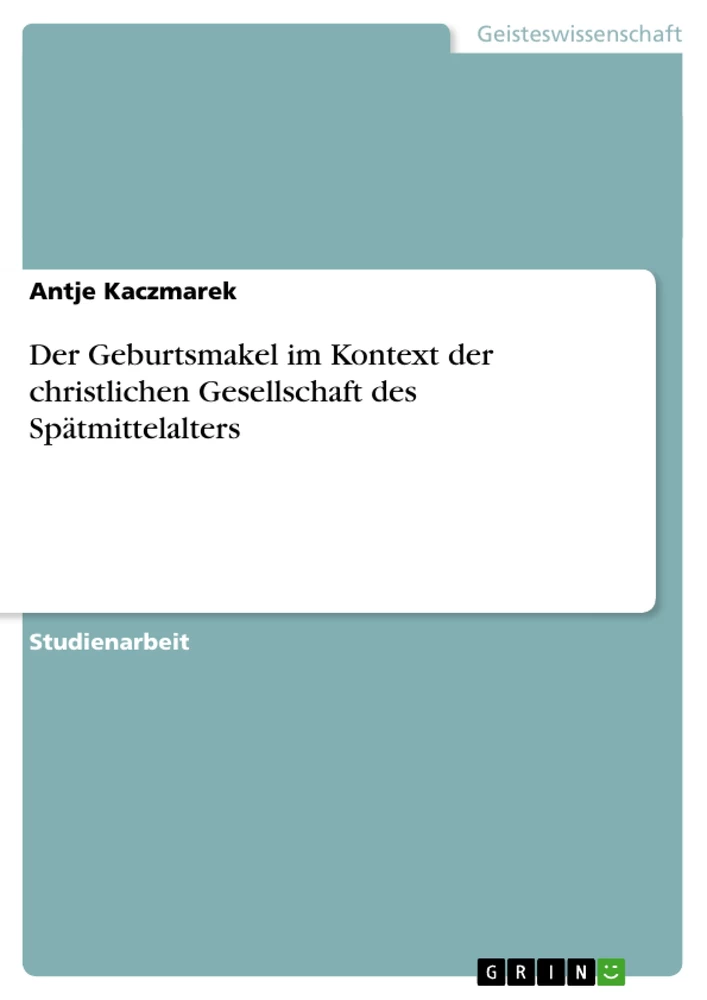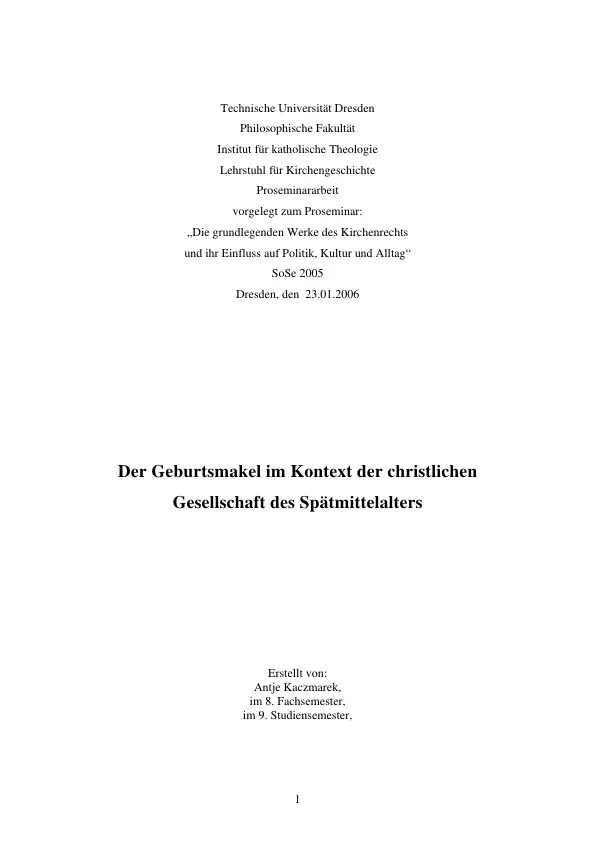Mit der vorliegenden Arbeit tauchen wir ein in eine Zeit, in der ständische Schranken und soziale Gefüge nur schwer zu durchbrechen waren. Die ständischen Schranken bestanden im Unterschied von adelig, nicht adelig und frei bzw. unfrei, ein Entkommen im Sinne des sozialen Aufstiegs war nur in den seltensten Fällen erfolgreich. Der größte Teil der Bevölkerung, so lehrt uns Eike Michl mit den folgenden Fakten , konnte weder lesen noch schreiben, weshalb Klöster und Stifte wahre geistige Machtzentren darstellten. Hier wurde nicht nur die pure Religion betrieben, sondern hier wurde Bildung vermittelt und Forschung betrieben. Der Klerikerstand war hoch angesehen, so hoch sogar, dass einige Geistliche auch für hohe weltliche Ämter besetzt wurden und so nicht nur innerkirchlichen sondern auch weltlichen Einfluss beanspruchten. Dennoch oder deshalb geriet der Adel, der meist den lokalen Herrscher stellte, oft mit Würdenträgern der Kirche in Konflikt. Der Adel hatte die Aufgabe, sein Volk vor den Gefahren des Mittelalters zu beschützen und Frieden zu gewährleisten. Außerdem verwalteten und vermehrten sie ihren Besitz, unter anderem auch als Grundherren. Unter ihnen standen Bauern und Arbeiter, die den größten Teil der Bevölkerung ausmachten. Ihre Arbeit erhielten sie von und durch ihre Grundherren, deren Land ihnen zugewiesen und durch sie bearbeitet werden musste. Zusätzlich zu einer Art Pacht waren sie verpflichtet, weitere Abgaben an ihre Lehnsherren zu entrichten. Die Abhängigkeit von Adel und Natur, die geringe Lebenserwartung, das harte Arbeitsleben und die unausgereifte medizinische Versorgung forderten ihren Tribut. Doch es gibt auch eine Gruppe von Menschen, die noch unter der gemeinen Bevölkerung standen, so z.B. Bettler, Spielleute, Zigeuner, Prostituierte, Aussätzige und Angehörige anderer Religionen, wie zum Beispiel Juden. Aber auch unehelich geborene Kinder gehörten dazu, ihre Zeugung hatte in jedem Fall mit einem Rechts- oder moralischen Bruch zu tun. Denn wir befinden uns auch in einer Zeit, in der man die Gebote der Kirche befolgte und das kirchliche Rechtssystem akzeptierte und auch respektierte.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Weihehindernis durch illegitime Geburt - ein geschichtlicher Abriss
- Kategorisierung
- Das Dispenswesen - Aufteilung und Kompetenzen
- Die Legitimation - Aufteilung und Kompetenzen
- Vor- und Nachteile im Leben eines Bastards
- Sozialgeschichtliche Auswirkungen der Marginalisierung
- Findelkinder
- Findelhäuser
- Der Geburtsmakel in Judentum und Islam
- Der Geburtsmakel im Judentum
- Der Geburtsmakel im Islam
- Conclusio
- Quellennachweise
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Marginalisierung unehelicher Kinder im Spätmittelalter. Der Fokus liegt dabei auf der Entstehung und Entwicklung des Weihehindernisses durch illegitime Geburt im kanonischen Recht und seinen Auswirkungen auf das soziale Leben der Betroffenen.
- Entwicklung des Weihehindernisses durch illegitime Geburt im kanonischen Recht
- Dispenswesen und Legitimation im Kontext der unehelichen Geburt
- Sozialgeschichtliche Auswirkungen der Marginalisierung unehelicher Kinder
- Vergleich des Geburtsmakels im Judentum und Islam
- Vor- und Nachteile des Lebens als Bastard im Spätmittelalter
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die ständischen und sozialen Verhältnisse des Spätmittelalters ein und erläutert die Bedeutung des kirchlichen Rechts für die Gesellschaft.
Kapitel 2 befasst sich mit der Entwicklung des Weihehindernisses durch illegitime Geburt, beginnend mit den frühen biblischen Quellen bis hin zum kanonischen Recht. Es werden die wichtigsten Bestimmungen und die Rolle von Konzilsbeschlüssen und Dispensen betrachtet.
Kapitel 3 analysiert die Kategorisierung unehelicher Kinder im Spätmittelalter und betrachtet das Dispenswesen, die Legitimation und die Vor- und Nachteile im Leben eines Bastards.
Kapitel 4 beleuchtet die sozialgeschichtlichen Auswirkungen der Marginalisierung unehelicher Kinder, insbesondere im Zusammenhang mit Findelkindern und Findelhäusern.
Kapitel 5 setzt sich mit der Bedeutung des Geburtsmakels im Judentum und Islam auseinander und untersucht die jeweiligen rechtlichen und kulturellen Perspektiven.
Schlüsselwörter
Illegitimität, uneheliche Geburt, Weihehindernis, Dispenswesen, kanonisches Recht, Spätmittelalter, Marginalisierung, Sozialgeschichte, Findelkinder, Judentum, Islam, Geburtsmakel
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutete das Weihehindernis durch illegitime Geburt?
Im kanonischen Recht des Mittelalters durften unehelich geborene Kinder keine höheren geistlichen Weihen empfangen, da ihre Geburt als moralischer Makel galt, der sie für den Klerikerstand disqualifizierte.
Wie konnte man eine uneheliche Geburt „legalisieren“?
Es gab Möglichkeiten der Legitimation durch spätere Eheschließung der Eltern oder durch päpstliche bzw. kaiserliche Gnadenakte (Dispenswesen), um rechtliche Nachteile auszugleichen.
Welche sozialen Folgen hatten uneheliche Kinder zu tragen?
Sie standen oft am Rande der Gesellschaft, hatten eingeschränkte Erbrechte und waren von vielen Berufen oder Ämtern ausgeschlossen. Viele landeten als Findelkinder in speziellen Häusern.
Gab es den Geburtsmakel auch in anderen Religionen?
Ja, auch im Judentum und im Islam gab es rechtliche und soziale Kategorisierungen für Kinder, die außerhalb einer gültigen Ehe gezeugt wurden, wobei die rechtlichen Konsequenzen variierten.
Welche Rolle spielten Klöster für die Bildung im Mittelalter?
Klöster und Stifte waren die geistigen Machtzentren, in denen Bildung vermittelt und Forschung betrieben wurde, da der Großteil der Bevölkerung weder lesen noch schreiben konnte.
- Quote paper
- Antje Kaczmarek (Author), 2007, Der Geburtsmakel im Kontext der christlichen Gesellschaft des Spätmittelalters, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/72915