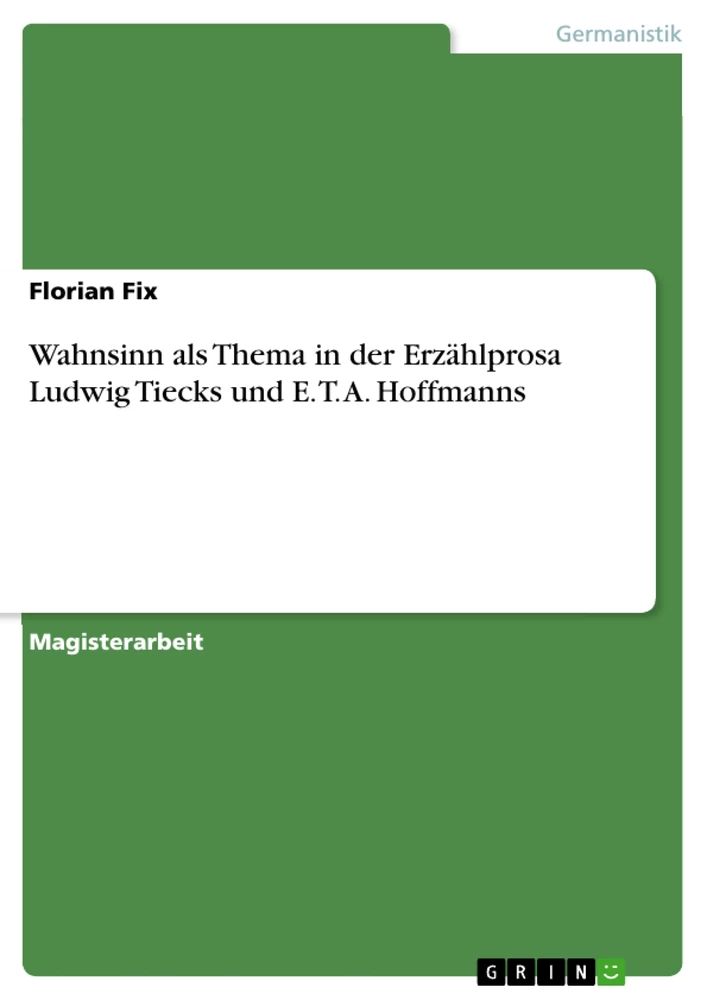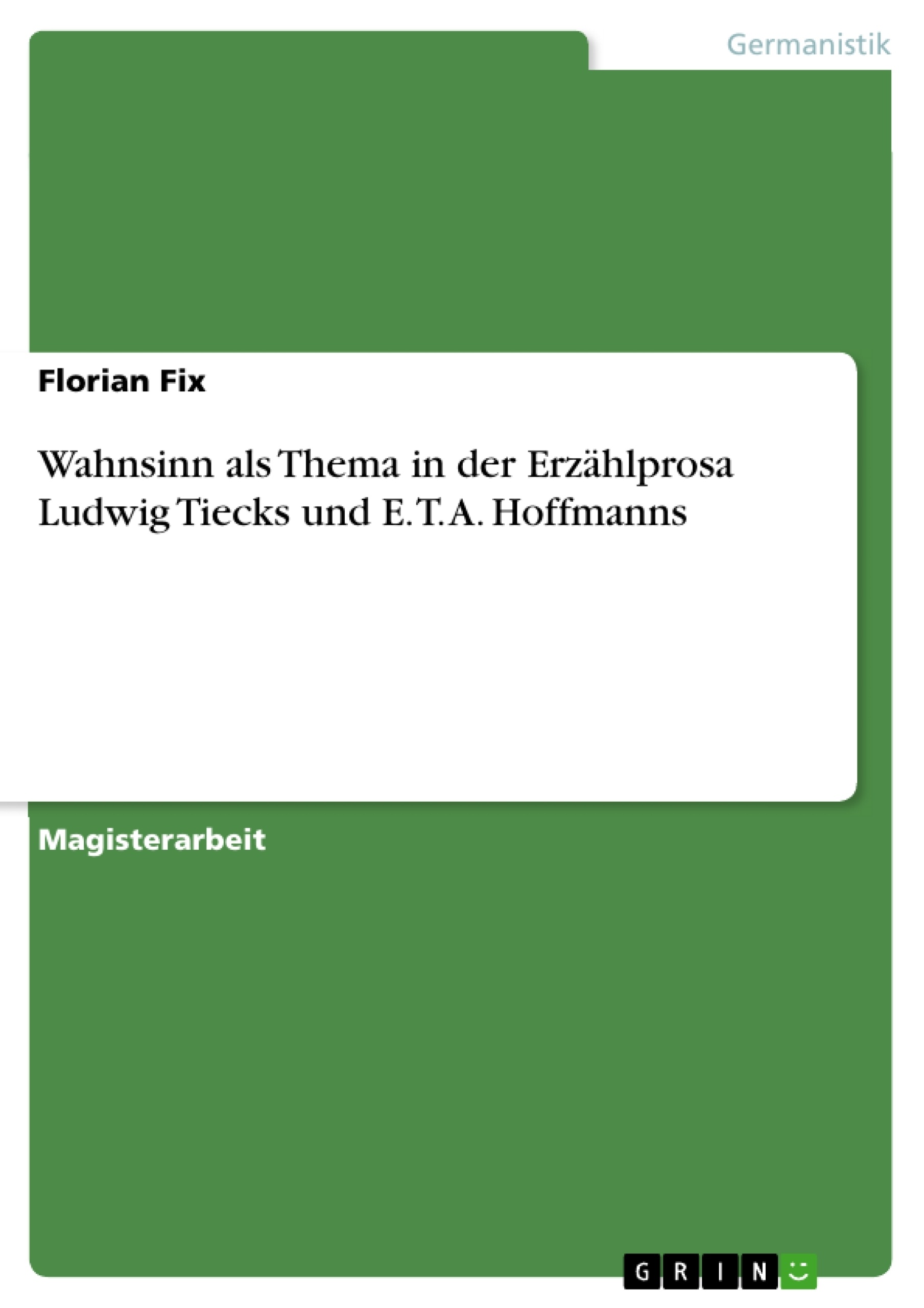Sowohl im Werk Ludwig Tiecks als auch E. T. A. Hoffmanns wird der Wahnsinn in beträchtlichem Umfang thematisiert. Im Rahmen dieser Arbeit setze ich mich damit auseinander, mit welcher Motivation und auf welche Weise dies geschieht, welchen Stellenwert der Wahnsinn in den Darstellungen einnimmt und was die Darstellung des Wahnsinns als Kehrseite des Verstandes schließlich auch über diesen auszusagen vermag.
Da eine Berücksichtigung des historisch-medizinischen Kontextes unabdingbar ist, wird anhand einer historischen Dimensionierung der Wissensstand der Gesellschaft des beginnenden 19. Jahrhunderts aufgezeigt. In einem zweiten Abschnitt wird beschrieben, auf welche Weise und mit welchen ideengeschichtlichen Einflüssen die Künstler der Romantik das Thema aufgriffen und produktiv verarbeiteten.
Obgleich von einer zu engen biografischen Deutung abgesehen wird, verdeutlicht ein kurzer biografischer Abschnitt jeweils zu beiden Autoren, welche Beweggründe zu einer Beschäftigung mit dem Wahnsinn führten.
Zur Analyse werden die in den verschiedenen Erzählungen beschriebenen Krankheitsverläufe kurz umrissen, um diese anschließend aus bestimmten Perspektiven bewertet zu werden. Die Betrachtung der medizinischen Phänomene erfolgt hierbei vornehmlich im Kontext des Wissenstandes der romantischen Epoche und spart somit rein psychoanalytische Deutungen aus.
Anknüpfend wird ergründet, mit welchen sprachlichen Mitteln der Wahnsinn dargestellt bzw. verbal simuliert wird. Dazu werden jene Passagen, in welchen die Symptome des lauernden oder ausbrechenden Wahnsinns geschildert werden, nach Aspekten der Wortwahl und wiederkehrenden Motiven geprüft.
Darüber hinaus wird aufgezeigt, wie sich die Darstellung des Wahns zum zeitgenössischen medizinischen Diskurs verhält. Ein weiteres Anliegen der Arbeit ist die Erfassung des Stellenwerts des Wahnsinnigen in der ihn umgebenden Gesellschaft. So wird betrachtet, auf welche Weise der Wahnsinn von den gesunden Figuren aufgefasst und behandelt wird, um dementsprechend Rückschlüsse sowohl auf den Verstandesverlust als auch die ihn bergende Gesellschaft zu ziehen.
In einer abschließenden Schlussbetrachtung werden die gewonnenen Erkenntnisse über die Verarbeitung des Themas im Werk der beiden Autoren gegenübergestellt und zusammengeführt. Besonderem Interesse wird hierbei der Frage beigemessen, inwiefern sich die Autoren als Vertreter verschiedener Abschnitte der Romantik dem Gegenstand auf unterschiedliche Weise nähern.
Inhaltsverzeichnis
- A) Einleitung
- B) Hauptteil
- 1. Historischer Kontext
- 1.1. Das Thema Wahnsinn im öffentlichen Diskurs der Gesellschaft des ausgehenden 18. Jahrhunderts
- 2.2. Die produktive Rezeption des Themas in der romantischen Literatur
- 2. Ludwig Tieck
- 2.1. Motivation und Beschaffenheit von Tiecks psychopathologischen Studien
- 2.2. Ausbruch des Wahnsinns bei Ryno
- 2.2.1. Symptomatik
- 2.2.2. Innerer Konflikt
- 2.3. Konfusion des Lesers und Wahnsinn als Nemesis in Der blonde Eckbert
- 2.3.1. Die Konzeption der Protagonisten
- 2.3.2. Berthas Verfehlung und deren Folgen
- 2.3.3. Poetischer Wahnsinn
- 2.3.4. Die Funktion des Wahnsinnmotivs
- 2.4. Melancholie und Irrwege der Seele Balders – Schwärmerkritik im William Lovell
- 2.4.1. Ursache und Symptomatik von Balders Melancholie
- 2.4.2. Die Darstellung des Wahnsinns
- 2.4.3. Verklärung oder Verurteilung? Die Wertung des Wahnsinns
- 2.4.4. Die Behandlung Balders
- 2.5. Verdrängtes Begehren in Der Runenberg
- 2.5.1. Orientierungskrise und Entfremdung
- 2.5.2. Initiationserlebnis, Konfrontation mit der unterbewussten Begierde
- 2.5.3. Verdrängung, Versuch der Integration in die bestehende Ordnung
- 2.5.4. Wiederkehr des Verdrängten, Abkehr vom Alltäglichen, Wahnsinn
- 2.6. Gesellschaftskritik in Die Reisenden
- 2.6.1. Schwärmerkritik
- 2.6.2. Behandlung und Kur
- 2.6.3. Die Narrengesellschaft
- 2.6.4. Wesen, Krankheit und Genesung Raimunds
- 3. E. T. A. Hoffmann
- 3.1. Motivation und Beschaffenheit Hoffmanns psychopathologischer Studien
- 3.2. Künstlertum und Wahnsinn in Der goldene Topf
- 3.2.1. Initiation oder Halluzination? Zum Wesen des Wunderbaren
- 3.2.2. Zunehmende Poetisierung als Intensivierung der Erkrankung
- 3.2.3. Anselmus' Verwirrung aus nüchterner Perspektive
- 3.2.4. Heilbehandlung
- 3.2.5. Die Beschaffenheit schwärmerischer und nüchterner Wahrnehmung
- 3.2.6. Entrückung nach Atlantis als Wahnsinn und Suizid
- 3.3. Kindheitstrauma und Kommunikationsunfähigkeit in Der Sandmann
- 3.3.1. Traumatische Kindheit
- 3.3.2. Kommunikationsstörungen
- 3.3.3. Selbstisolation und Weltentfremdung durch Liebe zu sich selbst in Olimpia
- 3.3.4. Divergenz von innerer und äußerer Welt - Wahnsinn
- 3.4. Der Umgang mit Kranken und Künstlerthematik beim Einsiedler Serapion
- 3.4.1. Darstellung des Wahnsinns
- 3.4.2. Das serapiontische Prinzip – Serapion als der ideale Künstler?
- 3.4.3. Behandlung
- 3.4.4. Die Angst vor dem Wahnsinn
- 3.5. Radikale Weltabkehr und Subjektivismus in Die Bergwerke zu Falun
- 3.5.1. Existenzkrise, Wendung ins Innere
- 3.5.2. Entscheidungsunfähigkeit, innere Zerrissenheit
- 3.5.3. Unvermittelbarkeit von innerer und äußerer Welt
- 3.6. Obsession und pränatales Trauma in Das Fräulein von Scuderi
- 3.7. Entwurf einer idealen Therapie? Zur Heilung in Die Genesung
- C) Schlussbetrachtung
- Historischer Kontext des Wahnsinns im ausgehenden 18. Jahrhundert
- Darstellung des Wahnsinns bei Tieck und Hoffmann
- Sprachliche Mittel der Wahnsinnsdarstellung
- Kritik an medizinischen Methoden und gesellschaftlichen Tendenzen
- Glorifizierung oder Verurteilung des Wahnsinns in der Romantik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung von Wahnsinn in der Erzählprosa Ludwig Tiecks und E.T.A. Hoffmanns. Ziel ist es, die Motivation und die Art und Weise der Darstellung des Wahnsinns zu analysieren, seinen Stellenwert in den Erzählungen zu bestimmen und die Aussagekraft der Wahnsinnsdarstellung im Kontext der Aufklärung und der Romantik zu beleuchten.
Zusammenfassung der Kapitel
A) Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt die Zielsetzung der Arbeit. Sie betont die Bedeutung des historischen Kontextes für das Verständnis der Werke Tiecks und Hoffmanns und kündigt die methodischen Ansätze der Analyse an, wobei eine zu enge biografische Interpretation vermieden werden soll. Die Vielschichtigkeit der Werke wird hervorgehoben, und der Anspruch auf Vollständigkeit wird zurückhaltend formuliert.
B) Hauptteil: Der Hauptteil umfasst die detaillierte Analyse der ausgewählten Werke beider Autoren. Hier werden die individuellen Kapitel mit ihren unterschiedlichen Schwerpunkten und Fallbeispielen untersucht.
Schlüsselwörter
Wahnsinn, Romantik, Ludwig Tieck, E.T.A. Hoffmann, Erzählprosa, Psychopathologie, Gesellschaftskritik, Medizinischer Diskurs, Aufklärung, Phantasie, Vernunft.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse der Wahnsinnsdarstellung bei Tieck und Hoffmann
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Darstellung von Wahnsinn in der Erzählprosa von Ludwig Tieck und E.T.A. Hoffmann. Sie untersucht die Motivation und die Art und Weise, wie Wahnsinn dargestellt wird, seinen Stellenwert in den Erzählungen und seine Aussagekraft im Kontext der Aufklärung und der Romantik.
Welche Werke werden untersucht?
Die Analyse umfasst ausgewählte Werke von Ludwig Tieck (Der blonde Eckbert, William Lovell, Der Runenberg, Die Reisenden) und E.T.A. Hoffmann (Der goldene Topf, Der Sandmann, Die Bergwerke zu Falun, Das Fräulein von Scuderi, Die Genesung). Die Auswahl der Werke ist begründet und dient der umfassenden Untersuchung der Thematik.
Welche Aspekte des Wahnsinns werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet verschiedene Aspekte des Wahnsinns, darunter die Symptomatik, den inneren Konflikt der Figuren, die gesellschaftliche und medizinische Sichtweise auf Wahnsinn, die sprachlichen Mittel der Darstellung, sowie die Glorifizierung oder Verurteilung des Wahnsinns in den romantischen Erzählungen. Die Analyse untersucht auch die Kritik an medizinischen Methoden und gesellschaftlichen Tendenzen der Zeit.
Welche methodischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit vermeidet eine zu enge biografische Interpretation. Stattdessen konzentriert sie sich auf eine detaillierte Analyse der ausgewählten Texte, wobei der historische Kontext des ausgehenden 18. Jahrhunderts berücksichtigt wird. Die Vielschichtigkeit der Werke wird hervorgehoben, und der Anspruch auf Vollständigkeit wird zurückhaltend formuliert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in drei Hauptteile gegliedert: Einleitung, Hauptteil und Schlussbetrachtung. Der Hauptteil beinhaltet eine detaillierte Analyse der ausgewählten Werke von Tieck und Hoffmann, unterteilt in Kapitel mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Fallbeispielen. Die Einleitung führt in die Thematik ein und beschreibt die Zielsetzung, während die Schlussbetrachtung die Ergebnisse zusammenfasst.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Wahnsinn, Romantik, Ludwig Tieck, E.T.A. Hoffmann, Erzählprosa, Psychopathologie, Gesellschaftskritik, Medizinischer Diskurs, Aufklärung, Phantasie, Vernunft.
Welches ist das Hauptziel der Arbeit?
Das Hauptziel ist es, die Motivation und die Art und Weise der Darstellung des Wahnsinns bei Tieck und Hoffmann zu analysieren, seinen Stellenwert in den Erzählungen zu bestimmen und die Aussagekraft der Wahnsinnsdarstellung im Kontext der Aufklärung und der Romantik zu beleuchten.
- Quote paper
- M A. Florian Fix (Author), 2006, Wahnsinn als Thema in der Erzählprosa Ludwig Tiecks und E. T. A. Hoffmanns, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/72992