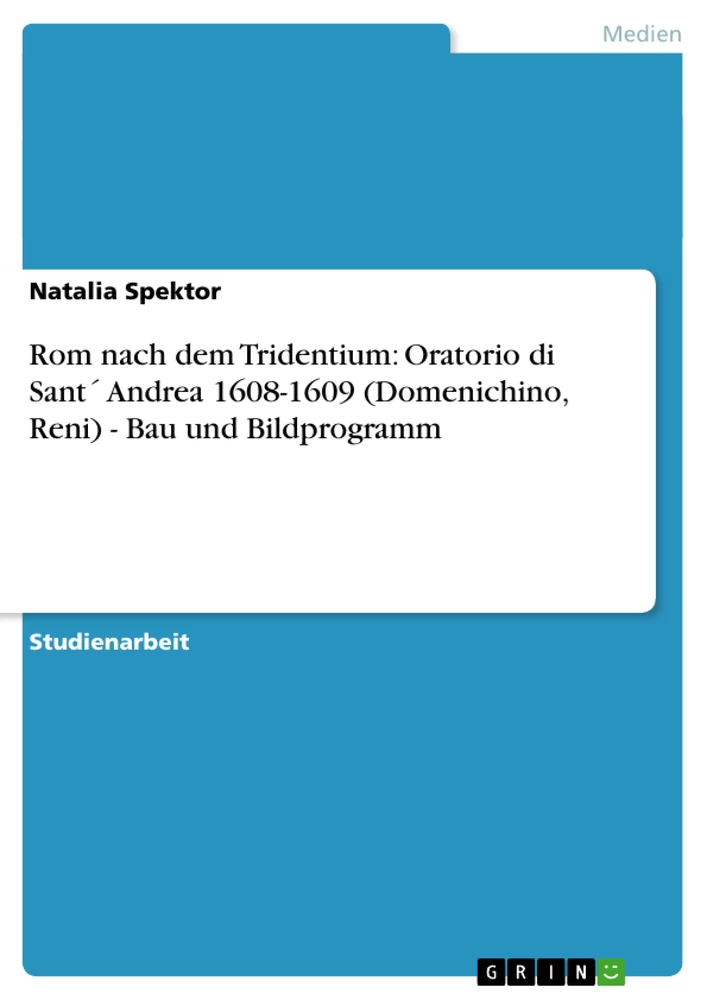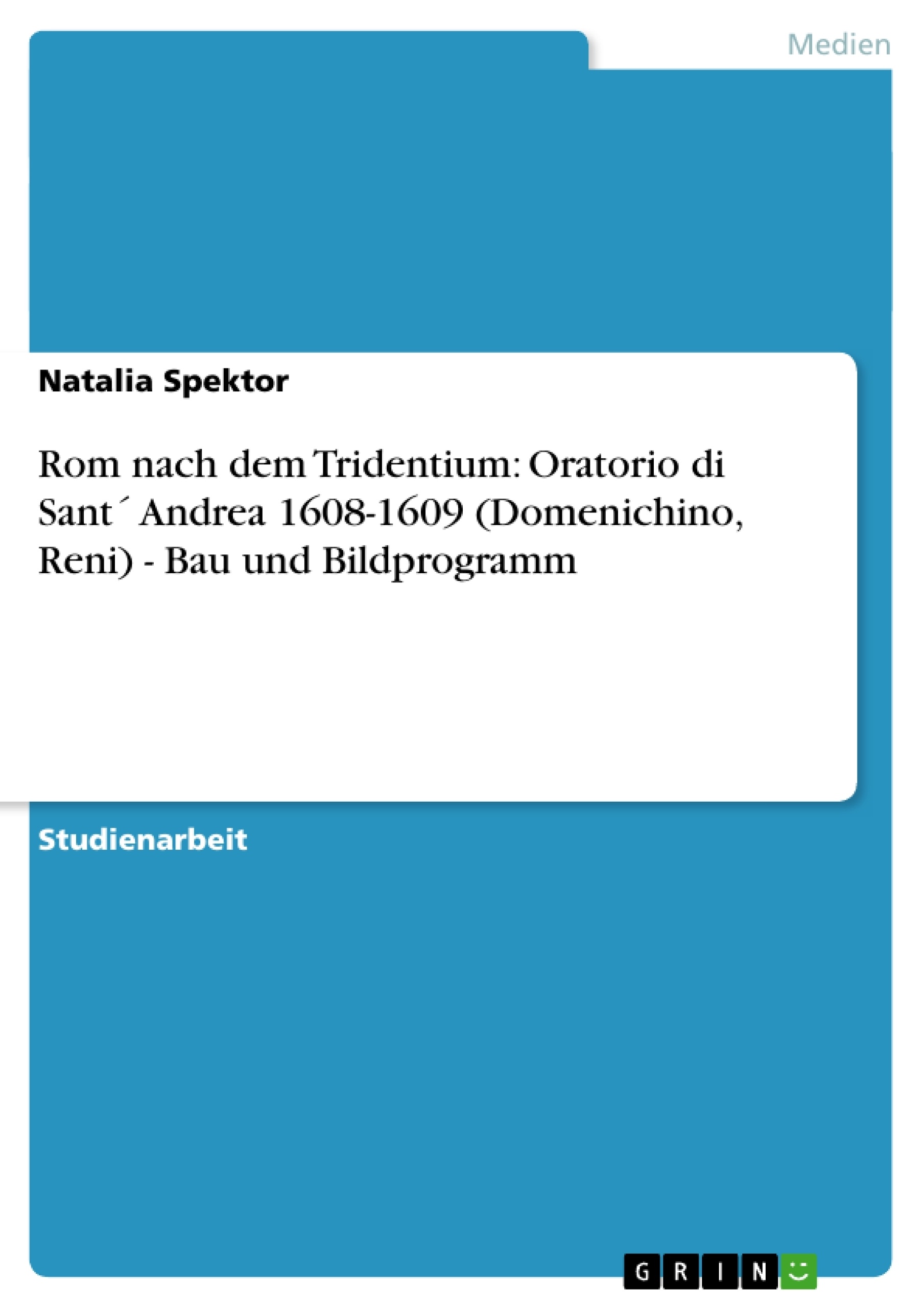In dem kleinen Oratorium S. Andrea bei der Kirche S. Gregorio Magno in Rom freskierten zwei berühmte Maler Guido Reni und Domenichino 1609 zwei sich gegenüberstehende, gleich große Wände mit einer Darstellung aus dem Leben des Heiligen Andreas. Domenichino stellte die Geißelung des Heiligen Andreas und Reni den Heiligen Andreas im Anblick des Kreuzes (auch gen. Der Heilige Andreas auf dem Weg zur Richtstätte) dar. In dieser Arbeit werden zwei ästhetische Konzeptionen der Historienmalerei Guido Renis und Domenichinos untersucht, und zwei verschiedene Rezeptionsbedingungen, die auf beiden Fresken ihre Widerspiegelung finden, werden verglichen und analysiert.
Zur Einführung gehen wir kurz auf die Geschichte des Oratoriums S. Andrea und seine innere Beschreibung ein. Zwei Fresken und ihr Bildaufbau ist der nächste Punkt der Untersuchung, wobei auch die Legende zum Andreas Martyrium kurz erwähnt wird. Der Vergleich und die Interpretation von diesen zwei Fresken ist die zentrale Frage, die die gesamte Arbeit umfasst. Hier werden wir analysieren, auf welche Art und Weise der Betrachter mit bildinternen Mitteln aufgefordert wird, an der Rekonstruktion der Darstellung teilzunehmen. Zum Schluß wird die berühmte Betrachteranekdote über den Vergleich von zwei Fresken erwähnt und interpretiert.
Das Oratorium Sant`Andrea mit zwei anderen Oratorien (S. Barbara und S. Silvia) befinden sich als freistehende Baugruppe links an der Kirche S.S. Andrea e Gregorio al Monte Celio (auch bekannt als S. Gregorio Magno) im alten Benediktiner-Friedhof. Sie erinnern an das Leben des heiligen Gregor und an seine Mutter, der heilige Sylvia2. In der Mitte steht die Kapelle des heiligen Andreas mit dem Portikus aus antiken Säulen, sie ist über dem Oratorium des heiligen Gregor errichtet.
Die baulich älteste der drei Kapellen ist die äußerste linke: S. Barbara. Das zweitälteste Oratorium ist S. Andrea. Wie S. Barbara wurde das Oratorium S. Andrea zum Teil auf den Mauerzügen der „Insula“ erbaut und im 12. oder 13. Jahrhundert restauriert bzw. weitgehend erneuert. Der jüngste Bau der Gruppe ist die Kappella S. Silvia, 1603, wie die ganze Vereinheitlichung der Kapellen, von Flaminio Ponzio erdacht und sichtlich, der Symmetrie halber, in dem selben Winkel zu S. Andrea gestellt, den dieser zu S. Barbara einnimmt. Oratorium S. Andrea hat folgende Maße: Länge: 16 m. Vordere Breite: 7,8 m, hintere Breite: 7m.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Oratorium Sant` Andrea
- Geschichte des Oratoriums S. Andrea
- Innere Beschreibung
- Zwei Fresken: Bildaufbau
- rechts: Domenichino, Geißelung des heiligen Andreas
- links: Guido Reni, Gang des heiligen Andreas zur Kreuzung
- Legende zum Andreas Martyrium
- Vergleich und Interpretation von zwei Fresken
- Domenichino
- Guido Reni
- Betrachterposition in beiden Fresken
- Das Mutter-Kind-Motiv in beiden Fresken
- ,,Vecchiarella\"-Anekdote
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht zwei ästhetische Konzeptionen der Historienmalerei Guido Renis und Domenichinos, die im Oratorium Sant' Andrea in Rom zu sehen sind. Die Arbeit analysiert die zwei unterschiedlichen Rezeptionsbedingungen, die sich in den beiden Fresken widerspiegeln.
- Analyse der beiden Fresken im Oratorium Sant' Andrea
- Vergleich der ästhetischen Konzeptionen von Guido Reni und Domenichino
- Untersuchung der Rezeptionsbedingungen der beiden Fresken
- Interpretation der "Vecchiarella"-Anekdote
- Bedeutung des Oratoriums Sant' Andrea im Kontext der römischen Kunst des 17. Jahrhunderts
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und beschreibt die beiden Fresken von Guido Reni und Domenichino im Oratorium Sant' Andrea. Sie stellt die zentralen Fragestellungen der Arbeit vor und gibt einen Überblick über den Aufbau.
- Oratorium Sant` Andrea: Dieses Kapitel gibt einen historischen Überblick über das Oratorium Sant' Andrea und beschreibt die Baugeschichte und die innere Gestaltung. Die Beschreibung der drei Kapellen (S. Barbara, S. Andrea, S. Silvia) gibt einen Einblick in die architektonische Anlage und die Funktion des Oratoriums.
- Zwei Fresken: Bildaufbau: Dieses Kapitel analysiert den Bildaufbau der beiden Fresken von Domenichino und Reni. Es beleuchtet die Darstellung der Geißelung des heiligen Andreas und den Gang des heiligen Andreas zur Kreuzung, wobei auch die Legende zum Andreas Martyrium kurz erwähnt wird.
- Vergleich und Interpretation von zwei Fresken: Dieses Kapitel vergleicht die beiden Fresken von Domenichino und Reni und untersucht die unterschiedlichen ästhetischen Konzeptionen. Dabei werden die spezifischen Bildmittel und die Gestaltungsprinzipien der beiden Künstler analysiert. Außerdem wird die Frage untersucht, wie der Betrachter durch die bildinternen Mittel aufgefordert wird, an der Rekonstruktion der Darstellung teilzunehmen.
- Das Mutter-Kind-Motiv in beiden Fresken: Dieses Kapitel beleuchtet die Darstellung des Mutter-Kind-Motivs in den beiden Fresken. Es untersucht die unterschiedlichen Ausprägungen und Bedeutungen dieses Motivs bei Domenichino und Reni. Es geht außerdem auf die Funktion des Motivs im Kontext der religiösen Kunst des 17. Jahrhunderts ein.
- ,,Vecchiarella\"-Anekdote: Dieses Kapitel stellt die berühmte Anekdote über die "Vecchiarella" vor und interpretiert sie im Kontext der beiden Fresken von Domenichino und Reni. Die Anekdote bietet einen interessanten Einblick in die Rezeption der beiden Werke und in die ästhetischen Präferenzen der Zeit.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den Fresken von Guido Reni und Domenichino im Oratorium Sant' Andrea in Rom. Die zentralen Themen sind die Analyse der beiden Fresken, der Vergleich der ästhetischen Konzeptionen der Künstler, die Untersuchung der Rezeptionsbedingungen und die Interpretation der "Vecchiarella"-Anekdote. Weitere wichtige Begriffe sind Historienmalerei, Bildaufbau, Betrachterposition, Mutter-Kind-Motiv, römische Kunst des 17. Jahrhunderts.
Häufig gestellte Fragen
Wer gestaltete die Fresken im Oratorio di Sant´ Andrea?
Die berühmten Barockmaler Guido Reni und Domenichino schufen 1609 gegenüberliegende Fresken zum Martyrium des Heiligen Andreas.
Was unterscheidet die Malstile von Reni und Domenichino in diesem Oratorium?
Domenichino setzte auf eine erzählerische, detailreiche Darstellung ("Geißelung"), während Reni eine eher lyrische, emotionale Komposition ("Gang zur Richtstätte") wählte.
Was ist die "Vecchiarella"-Anekdote?
Es handelt sich um eine berühmte Erzählung über eine alte Frau, deren Reaktion auf die Fresken als Beweis für die unterschiedliche emotionale Wirkung der Werke von Reni und Domenichino interpretiert wird.
Wo befindet sich das Oratorio di Sant´ Andrea?
Es gehört zu einer Gruppe von drei Oratorien bei der Kirche San Gregorio Magno (S.S. Andrea e Gregorio al Monte Celio) in Rom.
Welche Rolle spielt das Mutter-Kind-Motiv in den Fresken?
In beiden Werken dient das Motiv dazu, den Betrachter emotional in die Szenerie einzubinden und die Brutalität bzw. die spirituelle Bedeutung des Geschehens zu spiegeln.
- Quote paper
- Natalia Spektor (Author), 2004, Rom nach dem Tridentium: Oratorio di Sant´ Andrea 1608-1609 (Domenichino, Reni) - Bau und Bildprogramm, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/73450