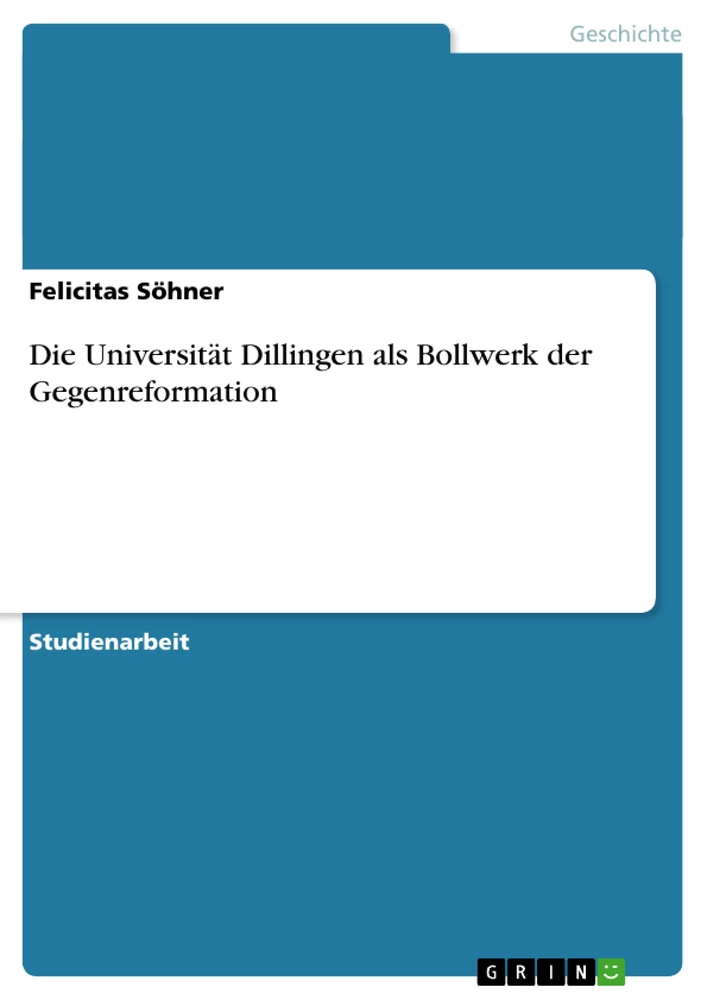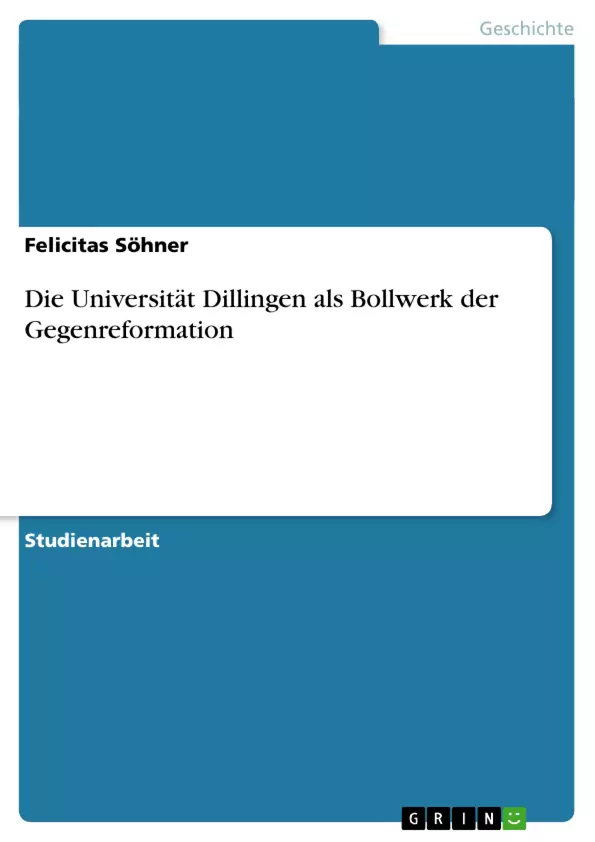Historischer Ausgangspunkt der Arbeit ist das Zeitalter von Reformation und der Gegenreformation, also das Jahrhundert von circa 1550 bis 1648. Diese Zeit war eine Ära der kompletten Neugestaltung der geistigen Welt des Katholizismus und der kirchlichen Frömmigkeit. Prägend war für sie der Versuch, alte kirchliche Positionen mit Waffengewalt wiederherzustellen.
Die Arbeit untersucht, ob Dillingen dem Ruf einer katholischen Eliteuniversität wirklich gerecht wurde und worin die damalige Stellung der Dillinger Universität begründet war. Ein Teil der Arbeit besteht zunächst in einer kritischen Bestandsaufnahme der gesellschaftlichen Hintergründe zur Entstehungszeit der Universität. Zunächst geht sie auf die historischen Rahmenbedingungen dieser Zeit ein, in der die Universität entstanden ist. Zudem widmet sie sich den Auswirkungen von Reformation und Gegenreformation vor allem in den katholischen Territorien, weiter der damit zusammenhängenden Bildungsreform, die sich mit dem Anstieg von Literalität, Buchmarkt und der damit verbundenen Bücherzensur auszeichnet.
Wie ist die Dillinger Universität in der Universitätslandschaft ihrer Zeit zu sehen? Um die Stellung der Dillinger Hochschule beurteilen zu können, ist es wichtig, die einzelnen Gründungsmotive des Stifters zu beleuchten, zu denen auf jeden Fall das Argument der Verstärkung der Hausmacht und die Sicherung konfessioneller Großräume gehören. Der zweite Teil der Studienarbeit skizziert die Entwicklung der Universität im Längsschnitt. Es beginnt mit der Gründungszeit um 1549, handelt kurz von der Rolle der Marianischen Kongregation und geht bis zur Schließung der Universität im Jahre 1803. Um dem Leser die Weiterentwicklung des Hauses nicht vorzuenthalten, wird der spätere Gang des Instituts bis in die heutige Zeit fortgeführt.
Inhaltsverzeichnis
- Historische Rahmenbedingungen
- Konfessionalisierung in den katholischen Territorien
- Die Bildungsreform und die Expansion der Schriftlichkeit
- Die deutsche Universitätslandschaft im konfessionellen Zeitalter
- Intention und Gründungsmotive des Stifters
- Die Universität als Prestigeobjekt
- Intention und geographische Lage
- Universität für die Hausmacht
- Reorganisation der Priesterausbildung, Propaganda und Indoktrination
- Entwicklung der Universität im Überblick
- Gründungsphase 1553 – 1610 (Kardinal von Waldburg)
- Neuorientierung 1610-1740 (Bischof Heinrich von Knöringen)
- Säkularisation 1740-1803 (Clemens Wenzeslaus, Johann Michael Sailer)
- Ausblick: Nachgeschichte 1803-1997
- Lyzeum mit akademischem Rang 1803-1923
- Philosophisch-Theologische Hochschule der Augsburger Bischöfe 1923-1970
- Eingliederung in die Universität Augsburg 1970/ Akademie für Lehrerfortbildung 1971/ Die ehemalige Universität heute: Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung 1997
- Dillingen das schwäbische Zentrum der Gegenreformation
- Ausbildungsstätte von Klerus und Adel
- Katholisches Bollwerk der Jesuiten
- pionierhafter Sondercharakter
- Die Universität Dillingen als Instrument der katholischen Konfessionalisierung
- Die Rolle der Jesuiten bei der Bildung von Klerus und Adel
- Die Bedeutung der Universität für die Stärkung des katholischen Glaubens
- Die Auswirkungen der Konfessionalisierung auf die deutsche Universitätslandschaft
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Gründung und Entwicklung der Universität Dillingen im Kontext der Konfessionalisierung des 16. Jahrhunderts. Sie beleuchtet die Intentionen des Stifters und die Rolle der Universität als Bollwerk der Gegenreformation.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die historischen Rahmenbedingungen der Konfessionalisierung im 16. Jahrhundert und beschreibt die Herausforderungen, denen die katholische Kirche gegenüberstand. Es geht auf die Bildungsreform und die Expansion der Schriftlichkeit ein, die in dieser Zeit stattfanden. Das zweite Kapitel untersucht die Intentionen und Gründungsmotive des Stifters der Universität Dillingen. Es analysiert die Rolle der Universität als Prestigeobjekt und als Instrument der Hausmacht.
Das dritte Kapitel zeichnet die Entwicklung der Universität von ihrer Gründung bis zur Säkularisation im Jahr 1803 nach. Es beleuchtet die verschiedenen Phasen ihrer Geschichte und die Bedeutung der Jesuiten bei der Ausgestaltung der Universität. Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit Dillinger Universität als Zentrum der Gegenreformation im schwäbischen Raum. Es untersucht die Ausbildungsstätte von Klerus und Adel und die Rolle der Universität als Bollwerk der Jesuiten.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit der Universität Dillingen als Institution der Gegenreformation. Sie analysiert die Rolle der Universität bei der Ausbildung von Klerus und Adel, die Bedeutung der Jesuiten bei der Gestaltung der Universität und die Auswirkungen der Konfessionalisierung auf die deutsche Universitätslandschaft. Zentrale Schlüsselbegriffe sind: Konfessionalisierung, Gegenreformation, Jesuiten, Universität Dillingen, Bildung, Klerus, Adel, schwäbisches Zentrum.
Häufig gestellte Fragen
Warum galt die Universität Dillingen als "Bollwerk der Gegenreformation"?
Sie wurde gegründet, um den katholischen Glauben zu festigen und eine geistige Elite auszubilden, die der Ausbreitung des Protestantismus entgegenwirken konnte.
Welche Rolle spielten die Jesuiten an der Universität Dillingen?
Die Jesuiten übernahmen die Leitung und Lehre, machten Dillingen zu einem Zentrum der Priesterausbildung und prägten den pionierhaften Charakter der Hochschule.
Wer war der Gründer der Universität?
Die Universität wurde im Jahr 1549 durch Kardinal Otto Truchseß von Waldburg gestiftet.
Was geschah mit der Universität während der Säkularisation?
Im Jahr 1803 wurde die Universität im Zuge der Säkularisation geschlossen und später in ein Lyzeum bzw. eine Philosophisch-Theologische Hochschule umgewandelt.
Was befindet sich heute in den Gebäuden der ehemaligen Universität?
Heute beherbergen die historischen Gebäude die Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung (ALP).
- Quote paper
- Felicitas Söhner (Author), 2007, Die Universität Dillingen als Bollwerk der Gegenreformation, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/74142