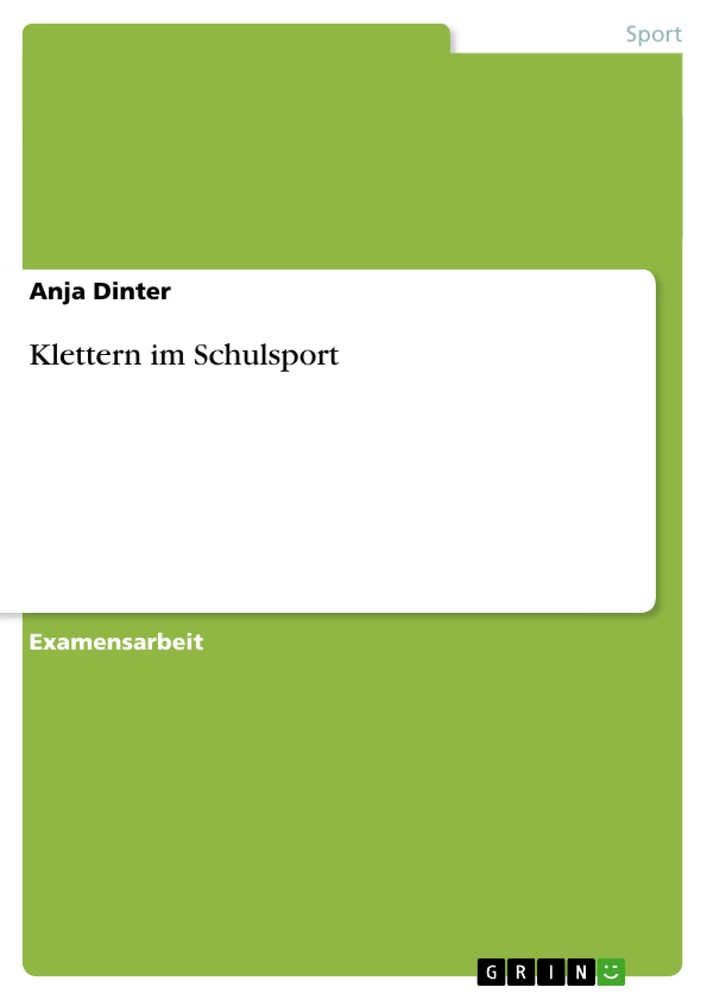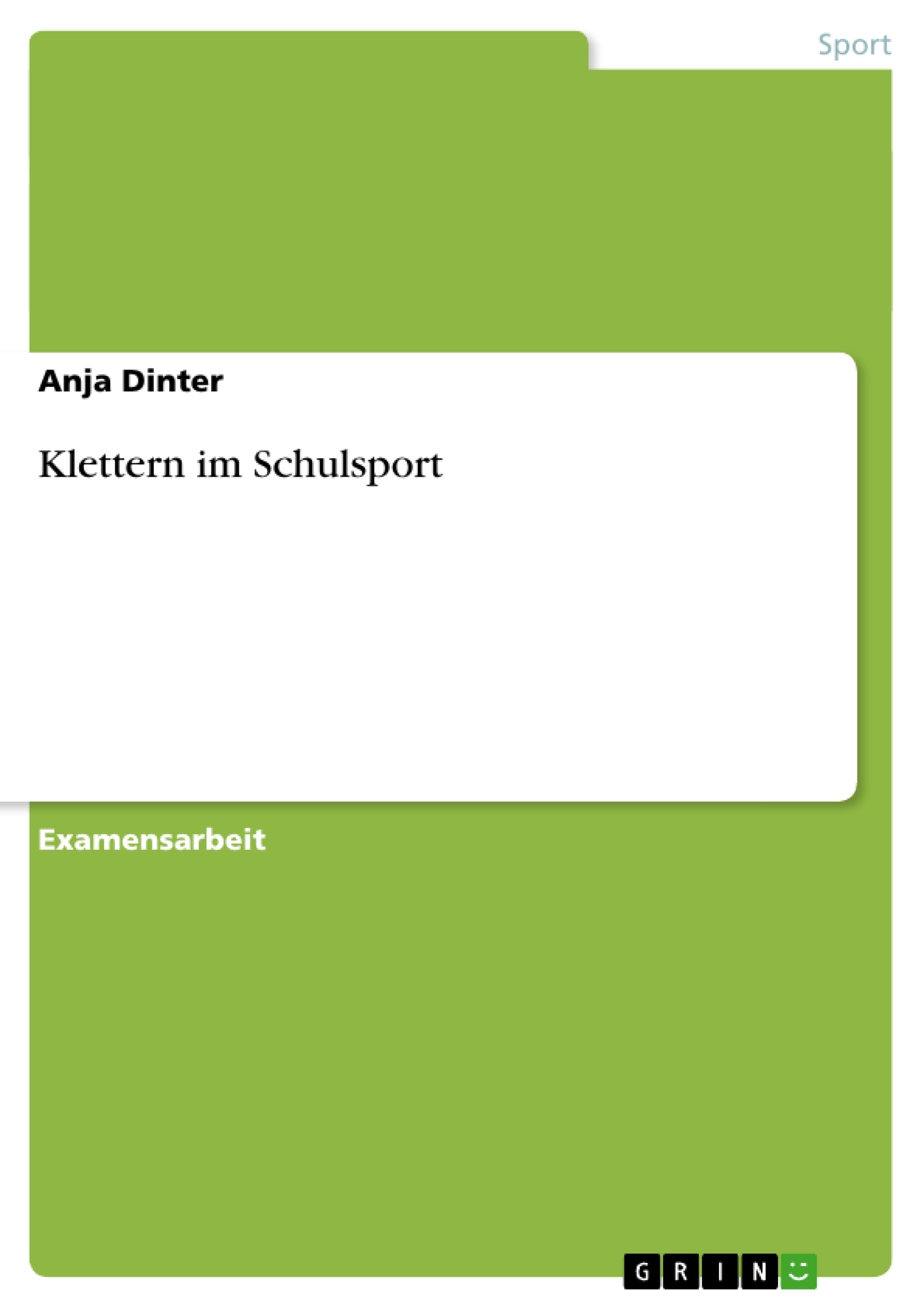Einleitung
Das Klettern gehört zu den grundlegenden Bewegungsformen des Menschen. Bereits vom Kleinstkindalter an sind Kletterbewegungen für die Exploration der Umwelt sowie das Sammeln von Körpererfahrungen – und folglich für die Bewältigung verschiedenster Entwicklungsaufgaben – von fundamentaler Bedeutung. Jedoch ist nicht nur dem Klettern als ursprüngliche Bewegungsform, sondern auch seiner sportlichen Ausübung ein hohes Bildungspotenzial zuzuschreiben. Dieses spricht für eine Umsetzung des Klettersports in der Schule.
Durch den Brandenburger Rahmenlehrplan wird denjenigen Sportarten eine schulische Bedeutung und folglich ein pädagogischer Wert bestätigt, die koordinative und konditionelle Fähigkeiten fördern, vielfältige motorische und soziale Erfahrungen sowie einen mehrperspektivischen Sportunterricht ermöglichen. Darüber hinaus sollen die entsprechenden Sportarten transferfähig sein und Zukunftsrelevanz besitzen. Ebenfalls wird eine regelmäßige Ausübung des Sportunterrichts im Freien gefordert, da die besonderen Erfahrungen bei Aktivitäten in offenen Räumen gleichzeitig einen bewussten Umgang mit der Umwelt fördern (vgl. Rahmenlehrplan Sport Sek. I, 23-24).
Wie im Verlauf der Arbeit zu zeigen ist, wird das Klettern in vielerlei Hinsicht den oben genannten Anforderungen des Rahmenlehrplans gerecht. Es bietet eine Vielzahl von Ausgangspunkten für fachspezifisches wie auch fächerübergreifendes Lernen in Theorie und Praxis. Darüber hinaus kann davon ausgegangen werden, dass es als „Trendsportart“, mit der Assoziation von Erlebnis und Abenteuer, für Schüler relativ unabhängig von ihrer allgemeinen Haltung gegenüber dem (Schul-) Sport einen herausfordernden und motivierenden Charakter besitzt. Das Interesse an der Sportart seitens der Schüler wiederum ist als Grundlage für die Verfolgung sportpädagogischer Intentionen in der Schule sowie als Anreiz für ein außerschulisches Sporttreiben zu sehen.
Um das Klettern als einen schulsportrelevanten Inhalt vorzustellen, ist es zunächst notwendig eine nähere Beschreibung der Sportart vorzunehmen. Neben einem historischen Überblick werden u.a. Klettertechniken genannt und die Leistungsstruktur analysiert. Im Zusammenhang mit der Darstellung der heute praktizierten Formen des Klettersports wird auf deren Bedeutung für den Schulsport eingegangen. Da die Umsetzung von Trendsportarten im Schulsport einer kontroversen Diskussion unterliegt, die Arbeit jedoch für eine Durchführung der Trendsportart Klettern argumentiert, schließt eine Darstellung der Bedeutung dieser Sportarten für die Schule an. Auf der Basis dessen ist es dann möglich das pädagogische Potenzial des Klettersports darzulegen.
Den Erläuterungen des pädagogischen Potenzials folgen abschließend Ausführungen zur schulsportlichen Kletterpraxis. Hier werden sowohl Umsetzungsvarianten im unterrichtlichen und außerunterrichtlichen Schulsport als auch Möglichkeiten einer mehrperspektivischen Aufbereitung vorgestellt.
Da diese Staatsexamensarbeit im Rahmen eines in Berlin und Potsdam absolvierten Studiums verfasst wird, gehen die Überlegungen von einer Umsetzung des Kletterns im Berliner und Brandenburger Schulsport aus
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Begründung der Themenwahl
- 2. Zielstellung der Arbeit
- 3. Methodologisches Vorgehen
- 4. Eine Betrachtung der Sportart Klettern
- 4.1 Historischer Überblick
- 4.2 Merkmalsbestimmung
- 4.3 Klettertechniken
- 4.4 Leistungsstruktur
- 4.5 Schwierigkeitsgrade
- 4.6 Kontemporäre Formen des Klettersports und ihre Relevanz für die Schule
- 4.6.1 Das Bouldern
- 4.6.2 Die Begehung von Routen in Klettergärten
- 4.6.3 Das Klettern in künstlichen Anlagen und das Wettkampfklettern
- 4.6.4 Das „Mehrseillängen-Klettern“
- 4.6.5 Das Alpinklettern
- 5. Klettern als Trendsportart
- 5.1 Eine Diskussion des Begriffs „Trendsport“ in Bezug auf das Klettern
- 5.2 Trendsportarten als Teil des Curriculums?
- 5.2.1 Schülerinteressen und Rahmenplananforderungen
- 5.2.2 Das didaktische Prinzip der Vielseitigkeit
- 5.2.3 Der Freizeitbezug
- 5.2.4 Der schulische Umgang mit Trends im Sport
- 5.2.5 Materielle und personelle Rahmenbedingungen
- 6. Das pädagogische Potenzial des Klettersports
- 6.1 Vorbetrachtung
- 6.1.1 Die Bedeutung von Bewegung für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
- 6.1.2 Eine Reflexion der gegenwärtigen Lebens- und Bewegungswelt
- 6.2 Darstellung des pädagogischen Potenzials des Kletterns
- 6.2.1 Die Bedeutung des Kletterns als grundlegende Bewegungsform
- 6.2.2 Die Förderung konditioneller und koordinativer Fähigkeiten
- 6.2.3 Soziales Lernen
- 6.2.4 Risiko und Wagnis – ein bedeutsames Erfahrungsfeld
- 6.1 Vorbetrachtung
- 7. Das Klettern in der schulischen Praxis
- 7.1 Curriculare und andere Voraussetzungen
- 7.2 Qualifikation der Lehrkräfte
- 7.3 Umsetzungsmöglichkeiten des Kletterns in der Schule
- 7.3.1 Sportunterricht
- 7.3.1.1 Klettern im verbindlichen Sportunterricht
- 7.3.1.2 Klettern im wahlobligatorischen Sportunterricht
- 7.3.2 Angebote außerhalb des Sportunterrichts
- 7.3.2.1 Projekte
- 7.3.2.2 Wandertage, Klassen- und Studienfahrten
- 7.3.2.3 Klettern als Arbeitsgemeinschaft
- 7.3.2.4 Die „Bewegte Schule“
- 7.3.1 Sportunterricht
- 7.4 Einführung in das Themenfeld
- 7.5 Kletterunterricht nach dem Konzept der Mehrperspektivität
- 7.5.1 Das Leisten erfahren und reflektieren
- 7.5.2 Sich körperlich ausdrücken und Bewegung gestalten
- 7.5.3 Etwas wagen und verantworten
- 7.5.4 Die Wahrnehmungsfähigkeit verbessern, Bewegungserfahrung erweitern
- 7.5.5 Die Fitness verbessern, Gesundheitsbewusstsein entwickeln
- 7.5.6 Gemeinsam handeln, spielen und sich verständigen
- 8. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Integration des Klettersports in den Schulsport. Ihr Ziel ist es, das Potenzial des Kletterns als pädagogisch wertvolle Sportart zu beleuchten und aufzuzeigen, wie es in die schulische Praxis integriert werden kann.
- Die Analyse des Kletterns als Trendsportart
- Die Darstellung der pädagogischen Potenziale des Kletterns für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen
- Die Erörterung der Möglichkeiten der schulischen Umsetzung des Kletterns im Sportunterricht und in außerschulischen Angeboten
- Die Diskussion der didaktischen und organisatorischen Herausforderungen bei der Integration des Kletterns in den Schulsport
- Die Berücksichtigung der aktuellen Rahmenbedingungen und Entwicklungen im deutschen Schulsport
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema „Klettern im Schulsport“ ein und beleuchtet die Relevanz der Sportart im Kontext des Brandenburger Rahmenlehrplans. Kapitel 4 bietet einen detaillierten Überblick über die Sportart Klettern, inklusive historischer Entwicklung, Merkmalen, Techniken, Leistungsstruktur und verschiedenen Kletterformen. In Kapitel 5 wird die Diskussion um Trendsportarten im Schulsport beleuchtet und das Klettern in diesem Kontext analysiert. Kapitel 6 widmet sich dem pädagogischen Potenzial des Kletterns und zeigt seine Bedeutung für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen auf. Schließlich beleuchtet Kapitel 7 die praktische Umsetzung des Kletterns in der Schule, inklusive curricularer Voraussetzungen, Qualifikationen der Lehrkräfte und verschiedenen Umsetzungsmöglichkeiten im Sportunterricht und in außerschulischen Angeboten.
Schlüsselwörter
Klettern, Schulsport, Trendsportart, pädagogisches Potenzial, Bewegungserfahrung, Soziales Lernen, Risiko und Wagnis, Rahmenlehrplan, Umsetzungsmöglichkeiten, Lehrerausbildung, mehrperspektivischer Sportunterricht.
Häufig gestellte Fragen
Welches pädagogische Potenzial bietet Klettern im Schulsport?
Es fördert koordinative und konditionelle Fähigkeiten, stärkt das soziale Lernen und bietet ein Erfahrungsfeld für Risiko und Wagnis.
Ist Klettern im Rahmenlehrplan vorgesehen?
Ja, der Brandenburger Rahmenlehrplan fordert Sportarten, die vielfältige motorische und soziale Erfahrungen sowie Zukunftsrelevanz bieten.
Was ist der Unterschied zwischen Bouldern und Seilklettern in der Schule?
Bouldern erfolgt in Absprunghöhe ohne Seil, während das Routenklettern in Klettergärten oder künstlichen Anlagen eine Sicherung erfordert.
Welche sozialen Kompetenzen werden beim Klettern geschult?
Besonders das gegenseitige Sichern fördert Vertrauen, Verantwortung und die Fähigkeit, gemeinsam zu handeln.
Was bedeutet das Konzept der Mehrperspektivität beim Klettern?
Es bedeutet, Klettern unter verschiedenen Aspekten zu erleben: Leistung, Körperausdruck, Wagnis, Wahrnehmung, Fitness und Miteinander.
- Quote paper
- Anja Dinter (Author), 2005, Klettern im Schulsport, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/75133