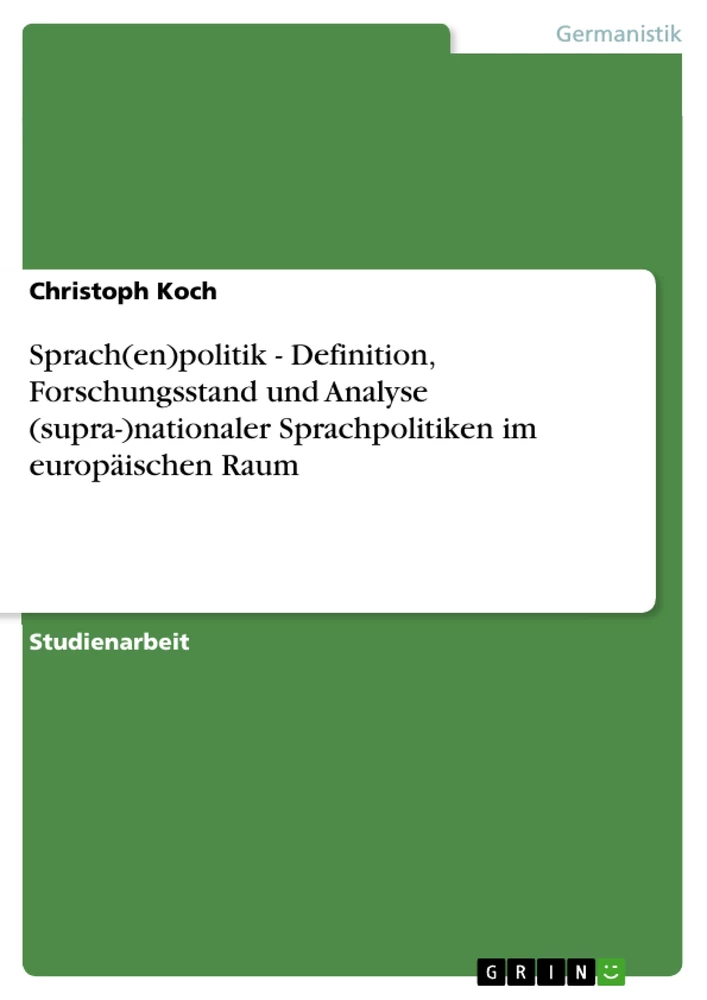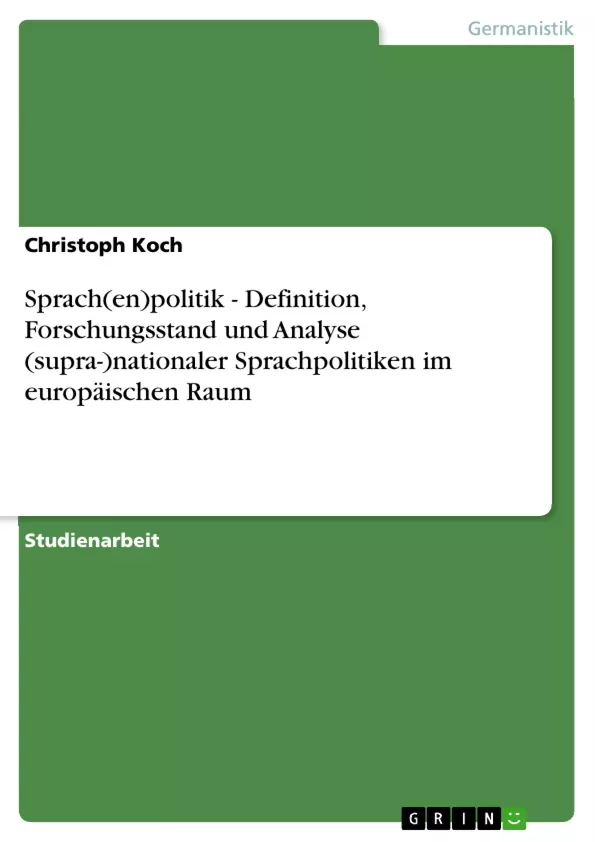„Was ist Sprachpolitik?“ „Wer beschäftigt sich wie mit ihr?“ und: „Wie sehen konkrete nationalstaatliche oder supranationale Sprachpolitiken aus?“
Vorliegende Arbeit hat sich zum Ziel gesetzt, das beinah undurchdringliche Dickicht im Bereich der Sprachpolitik(-forschung) etwas zu lichten und die eben aufgeworfenen Fragen zu beantworten. Dabei bleibt der Fokus der Arbeit auf Europa im Allgemeinen und der EU im Speziellen. Die Arbeit gliedert sich in zwei Teile. Während sich der erste Teil der Arbeit (I), mit den beiden ersten Fragen nach einer Definition von Sprachpolitik und dem aktuellen Forschungsstand/-diskurs beschäftigt, beleuchtet der zweite Teil (II) praxisnäher nationalstaatliche und europaweite Sprachpolitiken.
Die im ersten Kapitel (1.) vorgestellte „Sonderstellung Europas in der globalen Sprachenvielfalt“ (Ahrens 2003: 145) begründet schon erwähnten Fokus auf Europa. Das zweite Kapitel (2.) zeigt danach, wie die Teilelemente von Sprachpolitik – namentlich Sprache und Politik – untrennbar miteinander verwoben sind, bevor dann im dritten Kapitel (3.) eine theoretische Diskussion über Definition, Akteure, Ebenen (3.1.) und Ziele (3.2.) von Sprachpolitik eröffnet wird. Im selben Kapitel wird zudem ein Forschungsüberblick, der Aufschluss über Theorieschulen (3.3.) Methoden (3.4.) und Inhalte (3.6.) sprachpolitischer Forschung gibt, erarbeitet.
Der praktische Teil der Arbeit (II) beschäftigt sich zum einen mit einer Kategorisierung der nationalen Sprachpolitiken Europas (Kapitel 4) zum anderen mit der internen sowie externen Sprachpolitik der Europäischen Union (Kapitel 5).
Da der Fokus der Arbeit auf einer theoretischen Diskussion über „die Sprachpolitik(-forschung)“ liegt, will und wird sich die Arbeit – abgesehen der Fallbeispiele im zweiten Teil – nicht mit dem Diskussionsstand innerhalb einzelner vorgestellter Untersuchungsgebiete (wie z.B. Sprache und Identität) beschäftigen. Hier sei auf die ausführlichen Literaturangaben (v.a. in 3.6.) verwiesen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Sprachpolitikforschung
- 1. Ausgangssituation
- 2. Sprache als Politikum
- 3. Sprachpolitik
- 3.1. Definition, Akteure, Ebenen
- 3.2. Ziele von Sprachpolitik
- 3.3. Theorieschulen
- 3.3.1. Die Kritische Methode
- 3.3.2. Sprachpolitik und Postmoderne
- 3.3.3. Sprachpolitik und Ökonomie
- 3.3.4. Sprachpolitik und Politische Theorie
- 3.3.5. Sprachpolitik und Sprachkultur
- 3.4. Methodologie
- 3.4.1. Die historische Methode
- 3.4.2. Die ethnographische Methode
- 3.4.3. Die Sprach/Diskursanalyse
- 3.4.4. Die geolinguistische Methode
- 3.4.5. Die psycho-soziologische Methode
- 3.5. Zwischenfazit
- 3.6. Inhalte von sprachpolitischer Forschung
- II. (supra-)nationale Sprachpolitiken
- 4. Die nationalen Sprachpolitiken Europas - eine Kategorisierung
- 4.1. Einsprachigkeit
- 4.2. Schutz/Toleranz der sprachlichen Minderheiten
- 4.3. sprachliche Autonomie
- 4.4. sprachlicher Föderalismus
- 4.5. institutionalisierte Mehrsprachigkeit
- 4.6. weitere Gesetzgebung
- 5. Die Sprachpolitik der EU – eine Differenzierung
- 5.1. interne Sprachpolitik
- 5.1.1. Sprachregelungen
- 5.1.2. vertragliche Grundlagen
- 5.1.3. Amts-, Relais- und Arbeitssprache
- 5.1.4. Probleme und Kritik
- 5.1.6. de jure vs. de facto EU Sprachenregelungen
- 5.1.7. Fazit
- 5.2. externe Sprachpolitik
- 5.2.1. Grundlagen
- 5.2.2. Förderung von Sprachen(-lernen)
- 5.2.3. Minderheitensprachenprogramme
- 5.2.4. Kritik
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Sprachpolitik, ihre Definition, den aktuellen Forschungsstand und die Analyse (supra-)nationaler Sprachpolitiken im europäischen Raum. Der Fokus liegt auf Europa und der EU. Die Arbeit gliedert sich in einen theoretischen Teil, der sich mit der Definition und der Forschung beschäftigt, und einen praktischen Teil, der nationale und europäische Sprachpolitiken beleuchtet.
- Definition und Akteure der Sprachpolitik
- Theorien und Methoden der Sprachpolitikforschung
- Kategorisierung nationaler Sprachpolitiken in Europa
- Interne und externe Sprachpolitik der Europäischen Union
- Europa's Stellung in der globalen Sprachenvielfalt
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die zentralen Forschungsfragen der Arbeit vor: Was ist Sprachpolitik? Wer beschäftigt sich damit und wie? Wie sehen nationale und supranationale Sprachpolitiken aus? Die Arbeit konzentriert sich auf Europa und die EU und gliedert sich in zwei Teile: einen theoretischen Teil zur Definition und zum Forschungsstand der Sprachpolitik sowie einen praktischen Teil zu nationalen und europäischen Sprachpolitiken. Die "Sonderstellung Europas in der globalen Sprachenvielfalt" wird als Grundlage für den Fokus auf Europa genannt. Die Einleitung skizziert den Aufbau der Arbeit, der sich mit Sprache und Politik, Definition, Akteuren, Zielen und Methoden der Sprachpolitik befasst. Der praktische Teil analysiert nationale Sprachpolitiken Europas und die interne und externe Sprachpolitik der EU.
I. Sprachpolitikforschung: Dieser Teil der Arbeit befasst sich mit der theoretischen Fundierung der Sprachpolitikforschung. Er beginnt mit der Darstellung konträrer Positionen zur Sprachenlandschaft Europas: die These von der "Homogenität" und die Sichtweise der großen Sprachenvielfalt. Der Abschnitt beleuchtet die Definition von Sprachpolitik, die beteiligten Akteure, die verschiedenen Ebenen der Sprachpolitik und deren Ziele. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Methodologie der Sprachpolitikforschung, die verschiedene Ansätze wie historische, ethnographische, linguistische und soziologische Methoden umfasst. Der Teil bietet einen umfassenden Überblick über Theorieschulen und Forschungsansätze, ohne dabei auf einzelne Forschungsgebiete wie "Sprache und Identität" im Detail einzugehen.
II. (supra-)nationale Sprachpolitiken: Der zweite Teil der Arbeit analysiert die Sprachpolitiken auf nationaler und supranationaler Ebene. Er beginnt mit einer Kategorisierung der nationalen Sprachpolitiken Europas, die Einsprachigkeit, den Schutz sprachlicher Minderheiten, sprachliche Autonomie, sprachlichen Föderalismus und institutionalisierte Mehrsprachigkeit umfasst. Der Fokus liegt auf der differenzierten Betrachtung der internen und externen Sprachpolitik der Europäischen Union. Die interne Sprachpolitik wird unter den Aspekten Sprachregelungen, vertragliche Grundlagen, Amts-, Relais- und Arbeitssprachen sowie Kritikpunkte diskutiert. Die externe Sprachpolitik der EU, einschliesslich der Förderung des Sprachenlernens und von Minderheitensprachenprogrammen, wird ebenfalls analysiert.
Schlüsselwörter
Sprachpolitik, Europa, Europäische Union, Mehrsprachigkeit, Sprachforschung, Theorieschulen, Methodologie, nationale Sprachpolitiken, internationale Sprachpolitik, Minderheitensprachen, Sprachplanung, Sprachförderung.
Häufig gestellte Fragen zum Dokument: Sprachpolitik in Europa
Was ist der Gegenstand dieses Dokuments?
Das Dokument bietet einen umfassenden Überblick über die Sprachpolitik in Europa, sowohl auf nationaler als auch auf supranationaler (EU) Ebene. Es behandelt die Definition von Sprachpolitik, relevante Theorieschulen und Methoden der Forschung, sowie eine Analyse verschiedener nationaler Sprachpolitiken und der internen und externen Sprachpolitik der Europäischen Union.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument deckt ein breites Spektrum an Themen ab, darunter die Definition und Akteure der Sprachpolitik, verschiedene Theorieschulen und Methoden der Sprachpolitikforschung, eine Kategorisierung nationaler Sprachpolitiken in Europa (Einsprachigkeit, Minderheitenschutz, sprachlicher Föderalismus etc.), die interne Sprachpolitik der EU (Sprachregelungen, Amts- und Arbeitssprachen), die externe Sprachpolitik der EU (Sprachförderung, Minderheitensprachenprogramme) und die Stellung Europas in der globalen Sprachenvielfalt.
Wie ist das Dokument strukturiert?
Das Dokument gliedert sich in einen theoretischen Teil (Sprachpolitikforschung) und einen praktischen Teil ((supra-)nationale Sprachpolitiken). Der theoretische Teil befasst sich mit der Definition von Sprachpolitik, den beteiligten Akteuren, Zielen, verschiedenen Theorieschulen und Methoden der Forschung. Der praktische Teil analysiert verschiedene Kategorien nationaler Sprachpolitiken in Europa und die interne und externe Sprachpolitik der EU detailliert.
Welche Methoden der Sprachpolitikforschung werden beschrieben?
Das Dokument beschreibt verschiedene Methoden der Sprachpolitikforschung, darunter die historische Methode, die ethnographische Methode, die Sprach-/Diskursanalyse, die geolinguistische Methode und die psycho-soziologische Methode.
Welche Theorieschulen der Sprachpolitik werden behandelt?
Das Dokument erwähnt verschiedene Theorieschulen, darunter die kritische Methode, Sprachpolitik und Postmoderne, Sprachpolitik und Ökonomie, Sprachpolitik und Politische Theorie, sowie Sprachpolitik und Sprachkultur.
Wie kategorisiert das Dokument nationale Sprachpolitiken in Europa?
Das Dokument kategorisiert nationale Sprachpolitiken anhand von Kriterien wie Einsprachigkeit, Schutz/Toleranz sprachlicher Minderheiten, sprachliche Autonomie, sprachlicher Föderalismus und institutionalisierte Mehrsprachigkeit.
Was sind die Schwerpunkte der Analyse der EU-Sprachpolitik?
Die Analyse der EU-Sprachpolitik konzentriert sich auf die interne Sprachpolitik (Sprachregelungen, vertragliche Grundlagen, Amts-, Relais- und Arbeitssprachen, Kritikpunkte) und die externe Sprachpolitik (Grundlagen, Förderung von Sprachenlernen, Minderheitensprachenprogramme, Kritik).
Welche Schlüsselwörter sind für das Dokument relevant?
Schlüsselwörter sind: Sprachpolitik, Europa, Europäische Union, Mehrsprachigkeit, Sprachforschung, Theorieschulen, Methodologie, nationale Sprachpolitiken, internationale Sprachpolitik, Minderheitensprachen, Sprachplanung, Sprachförderung.
Für wen ist dieses Dokument gedacht?
Dieses Dokument richtet sich an Personen, die sich akademisch mit Sprachpolitik, insbesondere in Europa, befassen. Es eignet sich für Studierende, Forschende und alle Interessierten, die einen umfassenden Überblick über dieses Thema erhalten möchten.
- Citar trabajo
- Christoph Koch (Autor), 2006, Sprach(en)politik - Definition, Forschungsstand und Analyse (supra-)nationaler Sprachpolitiken im europäischen Raum, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/75810