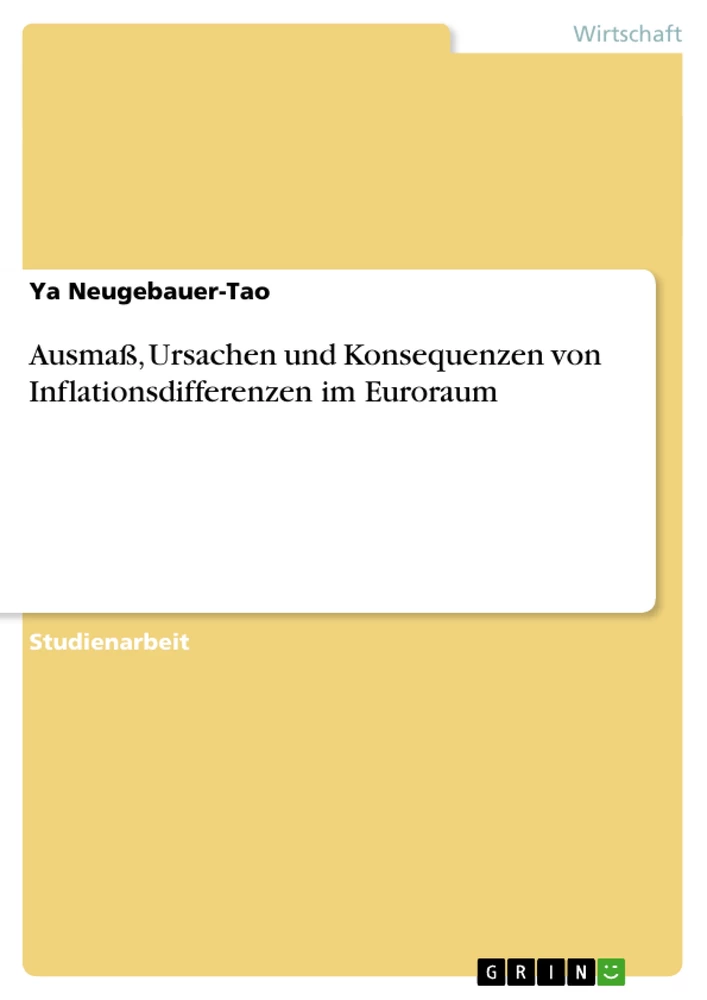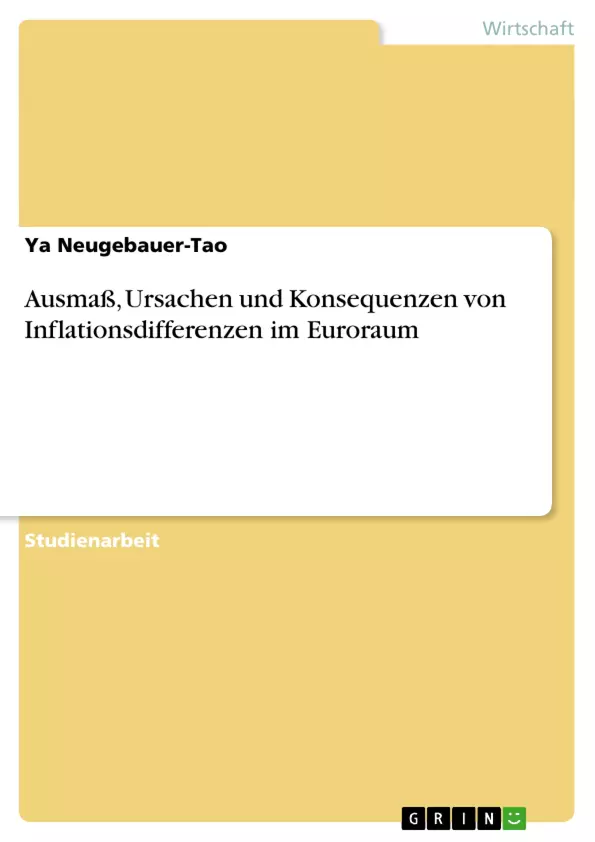Primäres Ziel der EZB ist die Gewährleistung von Preisstabilität für den Euroraum. Der EZB-Rat definiert Preisstabilität als mittelfristig beizubehaltende jährliche Steigerung des Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI ) von weniger, aber nahe (nach Konkretisierung im Mai 2003) 2%. Dieses Ziel wird mit Hilfe einer Strategie erreicht, die sich auf zwei Säulen stützt. Die erste Säule ist die Geldmenge, welche sich in der Bekanntgabe eines Referenzwerts für das Wachstum eines weit gefassten Geldmengenaggregats niederschlägt. Die zweite Säule ist die umfassende Beurteilung der künftigen Preisentwicklung und der Risiken für die Preisstabilität im Euroraum. Diese Beurteilung stützt sich auf eine breite Palette von Finanzmarkt- und Konjunkturindikatoren.
Die Einführung einer Einheitswährung gewährleistet zwar, dass die Entwicklung des Preisniveaus im Euro-Währungsgebiet letztendlich durch die einheitliche Geldpolitik des Eurosystems bestimmt wird, dies bedeutet aber nicht, dass die Teuerungsraten in den einzelnen Ländern immer mit der gemeinsamen (Ziel-)Inflationsrate innerhalb des Euroraums identisch sind. In einer Währungsunion gehören unterschiedliche Inflationsraten zum normalen Erscheinungsbild. Sie sind einerseits Ausdruck eines realwirtschaftlichen Anpassungsprozesses in der Gemeinschaft, deshalb auch wünschenswert. Andererseits zeigen dauerhafte Inflationsunterschiede zwischen den Euro-Ländern aber auch einen Mangel an Flexibilität und Anpassungsfähigkeit der Institutionen und Marktstrukturen in den einzelnen Volkswirtschaften. Tatsächlich sind bei der Veränderungsrate des HVPI Unterschiede zwischen den Ländern des Euro-Währungsgebietes von Beginn an bis zur Gegenwart festzustellen, die in der wissenschaftlichen Diskussion über deren Ursachen und Konsequenzen einen prominenten Platz einnehmen.
Die vorliegende Arbeit gibt einen Überblick über das Ausmaß sowie die Entwicklung der Inflationsdifferentiale vor und nach der Vollendung der Währungsunion. Ferner unternimmt die Autorin eine Bestandsaufnahme der Kontroversen um die Erklärungsansätze über die Ursachen der Inflationsdifferenzen im Euroraum und stellt die möglichen Konsequenzen der anhaltenden Inflationsunterschiede für die Gestaltung der nationalen Wirtschaftspolitik und der einheitlichen Geldpolitik dar.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Inflationsentwicklungen im Euro-Währungsgebiet: Bestandsaufnahme
- 2.1 Messung der Inflationsdivergenzen
- 2.2 Anstieg und Abweichungen der HVPI-Teuerungsraten
- 3. Erklärungsansätze von Inflationsunterschieden im Euro-Raum
- 3.1 Preiskonvergenz-Hypothese und Balassa-Samuelson-Effekt
- 3.2 Strukturelle Unterschiede
- 4. Konsequenzen für die Wirtschaftspolitik
- 4.1 Anpassung der nationalen Arbeitsmarkt- und Wettbewerbspolitik
- 4.2 Fiskalpolitische Implikationen
- 4.3 Auswirkungen auf die einheitliche Geldpolitik
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht das Ausmaß, die Ursachen und die Konsequenzen von Inflationsdifferenzen im Euroraum. Sie beleuchtet die Entwicklung der Inflationsdivergenzen vor und nach der Einführung des Euro und analysiert die wichtigsten Erklärungsansätze aus der Literatur. Darüber hinaus befasst sie sich mit den möglichen Auswirkungen dieser Inflationsunterschiede auf die Gestaltung der nationalen Wirtschaftspolitik und die einheitliche Geldpolitik im Euroraum.
- Messung und Entwicklung von Inflationsdivergenzen im Euroraum
- Analyse der wichtigsten Erklärungsansätze für Inflationsdifferenzen
- Konsequenzen von Inflationsdivergenzen für die nationale Wirtschaftspolitik
- Auswirkungen auf die einheitliche Geldpolitik
- Zusammenhänge zwischen Preisstabilität und Inflationsdivergenzen
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 2 stellt zunächst die Entwicklung der Inflationsdifferenzen im Euro-Währungsgebiet vor und vergleicht sie mit der Situation in den Vereinigten Staaten. Dabei werden verschiedene Messgrößen und die Entwicklung der Standardabweichung der HVPI-Teuerungsraten betrachtet.
Kapitel 3 befasst sich mit den wichtigsten Erklärungsansätzen für die Inflationsdifferenzen im Euro-Raum. Im Mittelpunkt stehen die Preiskonvergenz-Hypothese und der Balassa-Samuelson-Effekt sowie die Rolle struktureller Unterschiede zwischen den Ländern.
Kapitel 4 analysiert die möglichen Konsequenzen der Inflationsdifferenzen für die Wirtschaftspolitik. Es untersucht die Anpassung der nationalen Arbeitsmarkt- und Wettbewerbspolitik, die fiskalpolitischen Implikationen und die Auswirkungen auf die einheitliche Geldpolitik.
Schlüsselwörter
Inflationsdifferenzen, Euro-Währungsgebiet, HVPI-Teuerungsraten, Preiskonvergenz-Hypothese, Balassa-Samuelson-Effekt, strukturelle Unterschiede, nationale Wirtschaftspolitik, einheitliche Geldpolitik, Preisstabilität.
Häufig gestellte Fragen
Wie definiert die EZB Preisstabilität?
Preisstabilität ist definiert als ein mittelfristiger Anstieg des Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) von weniger als, aber nahe bei 2 % pro Jahr.
Warum gibt es trotz einer Einheitswährung unterschiedliche Inflationsraten?
Unterschiede entstehen durch realwirtschaftliche Anpassungsprozesse, aber auch durch mangelnde Flexibilität der Institutionen und Marktstrukturen in den einzelnen Ländern.
Was besagt der Balassa-Samuelson-Effekt?
Dieser Effekt erklärt Inflationsunterschiede durch unterschiedliche Produktivitätsfortschritte zwischen dem handelbaren und dem nicht-handelbaren Sektor einer Volkswirtschaft.
Welche Konsequenzen haben dauerhafte Inflationsdifferenzen?
Sie können die Wirksamkeit der einheitlichen Geldpolitik beeinträchtigen und machen Anpassungen in der nationalen Arbeitsmarkt-, Wettbewerbs- und Fiskalpolitik erforderlich.
Was sind die „zwei Säulen“ der EZB-Strategie?
Die erste Säule ist die Analyse der Geldmenge; die zweite Säule ist die umfassende Beurteilung der künftigen Preisentwicklung anhand von Finanzmarkt- und Konjunkturindikatoren.
- Citar trabajo
- Dipl.-Volkswirtin Ya Neugebauer-Tao (Autor), 2005, Ausmaß, Ursachen und Konsequenzen von Inflationsdifferenzen im Euroraum, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/75876