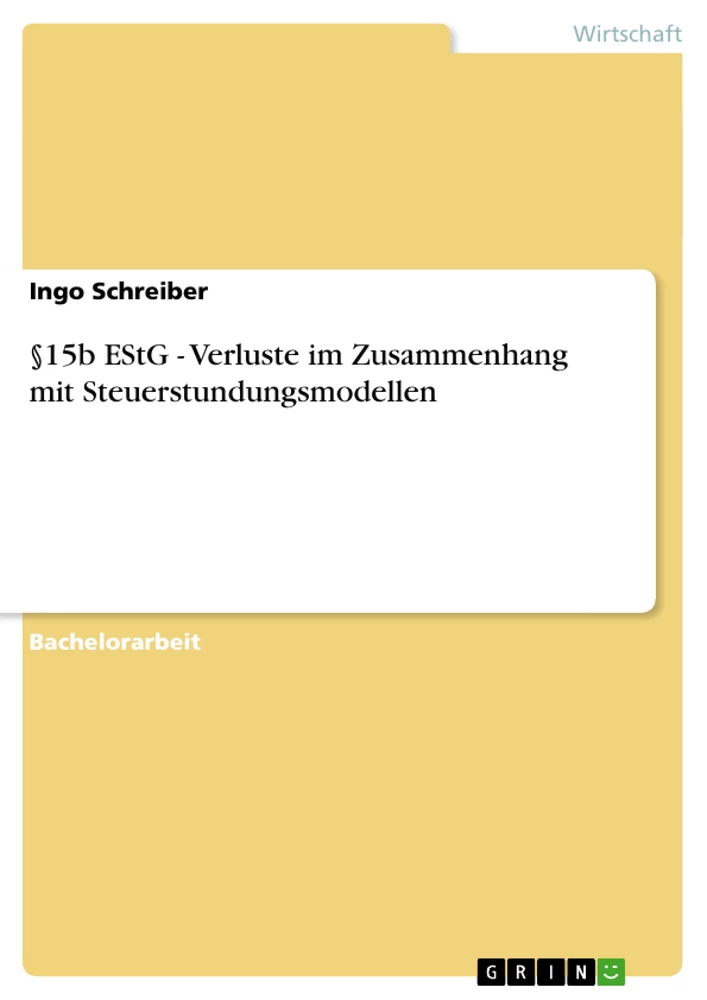1. Einleitung
Die Möglichkeit der hohen Verlustzuweisung durch Steuersparmodelle wurde
in den vergangenen Jahren häufig diskutiert, da immer mehr Steuerpflichtige
versuchen, ihre Steuerbelastung durch Zeichnung von Steuerstundungsmodellen
zu reduzieren. Aus Sicht des Staates führen diese volkswirtschaftlich
fragwürdigen Steuersparmodelle zu erheblichen Steuerausfällen und zu einer
Fehlallokation des Kapitals. In einem marktwirtschaftlichen System sollen sich
Investitionsentscheidungen an wirtschaftlichen Gewinnerwartungen und nicht
an steuerlichen Verlusten orientieren. Häufig werden diese Investitionen
allerdings nur wegen des damit verbundenen steuerlichen Vorteils getätigt.
[...]
Vor dem Hintergrund der kontroversen Diskussion ist Ziel der vorliegenden
Arbeit, die historische Entwicklung und Bedeutung des §15b EStG sowie seine
Probleme zu erläutern.
Hierzu wird in Abschnitt Zwei zunächst ein Überblick über die
Einschränkungen der Verlustzuweisungsmodelle gegeben und die wichtigsten
Gesetze dazu kurz dargestellt.
Das daran anknüpfende Kapitel Drei stellt die Grundidee des §15b EStG sowie
seine Tatbestandsmerkmale und deren Bedeutung heraus. Anhand von
Anwendungsbeispielen wird verdeutlicht, welche Bedeutung diese Regelung in
der Praxis hat und wer von der Verlustverrechnungsbeschränkung betroffen ist.
Abschnitt Vier thematisiert die Bedeutung des §15b EStG für den Standort
Deutschland. Der Staat erwartet durch die Verlustverrechnungsbeschränkung
Steuermehreinahmen von bis zu 2,135 Milliarden Euro. Diese Zahl wird aber
in der Literatur stark angezweifelt. Ziel ist es daher, mögliche Gefahren der
Regelung zu erläutern und dabei zu überprüfen, ob zukünftig Investitionen in
betroffenen Branchen tatsächlich eingeschränkt werden.
Im abschließenden Kapitel werden die Ergebnisse der Analyse des §15b EStG
auch unter Berücksichtigung öffentlicher Reaktionen auf die Verlustverrechnungsbeschränkung
zusammengefasst. Die grundsätzliche Entscheidung
für ein Gesetz zur Beschränkung der Verlustverrechnung stößt selbst
bei Vertretern von Fondsgesellschaften nicht auf Ablehnung. In der derzeitigen
Anwendung des §15b EStG wird das Gesetz jedoch als verbesserungswürdig
befunden – ja, seine Verfassungsmäßigkeit mitunter sogar angezweifelt.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Historischer Überblick
- 2.1 §15a EStG
- 2.2 Der neue §15b EStG
- 2.3 §2b EStG
- 3. Notwendigkeit, die Verlustausgleichsmöglichkeit einzuschränken
- 3.1 Die Grundidee des §15b EStG
- 3.2 §15b EStG im Einzelnen
- 3.2.1 §15b Abs. 1 Satz 1 EStG
- 3.2.2 §15b Abs. 1 Satz 2
- 3.2.3 §15b Absatz 2 EStG
- 3.2.4 §15b Absatz 3 EStG
- 3.2.5 Verfahrensrechtliche Regelungen (§15b Abs. 4 EStG)
- 3.2.6 Rückwirkende Anwendung des §15b EStG
- 3.2.7 Weitere Kritikpunkte an dem §15b EStG
- 3.3 Bedeutung des §15b EStG für die Praxis
- 3.3.1 Verhältnis zu anderen Vorschriften
- 3.3.2 Wer ist von §15b EStG betroffen
- 3.3.3 Maßgebliches Kapital
- 3.3.4 Wer ist nicht von § 15b EStG betroffen?
- 3.3.5 Beispiele ausgewählter Steuerstundungsmodelle
- 4. Bedeutung für den Standort Deutschland
- 4.1 Bedeutung von Fonds für Deutschland
- 4.2 Bedeutung für Fondsinvestitionen
- 4.4 Beitrag zu veränderten Standortbedingungen
- 4.5 Finanzielle Auswirkungen
- 5. Ergebnisse der Betrachtung
- 5.1 Zusammenfassende Bewertung
- 5.2 Beitrag zur Eindämmung von Steuerausfällen
- 5.3 Notwendigkeit von Steuerstundungsmodellen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Bachelorarbeit untersucht die Auswirkungen des §15b EStG auf Verlustausgleiche im Zusammenhang mit Steuerstundungsmodellen. Ziel ist es, die Notwendigkeit der Einschränkung der Verlustausgleichsmöglichkeiten zu beleuchten und die praktischen Auswirkungen des §15b EStG zu analysieren.
- Historische Entwicklung von Regelungen zur Verlustverrechnung
- Detaillierte Analyse des §15b EStG und seiner einzelnen Paragraphen
- Auswirkungen auf verschiedene Steuerstundungsmodelle
- Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Deutschland
- Bewertung der Notwendigkeit von Steuerstundungsmodellen
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Diese Einleitung führt in die Thematik der Verlustverrechnung im Zusammenhang mit Steuerstundungsmodellen ein und skizziert den Aufbau der Arbeit. Sie benennt die Relevanz des Themas und die Forschungsfrage, die im Laufe der Arbeit beantwortet werden soll. Es wird ein Überblick über die Struktur und den Inhalt der Arbeit gegeben.
2. Historischer Überblick: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung der gesetzlichen Regelungen zur Verlustverrechnung, insbesondere im Kontext der §§ 15a und 2b EStG. Es analysiert die früheren Regelungen und ihre Lücken, die zu der Einführung des §15b EStG führten. Die Entwicklung wird chronologisch dargestellt, um den Kontext und die Notwendigkeit der neuen Regelung verständlich zu machen.
3. Notwendigkeit, die Verlustausgleichsmöglichkeit einzuschränken: Dieses Kapitel analysiert die Gründe für die Einführung des §15b EStG. Es erläutert die Grundidee der neuen Regelung und beschreibt detailliert die einzelnen Absätze des Paragraphen. Die verschiedenen Aspekte des §15b EStG werden umfassend diskutiert, einschließlich der verfahrensrechtlichen Regelungen und der rückwirkenden Anwendung. Kritische Punkte und deren Bedeutung werden ebenfalls beleuchtet.
4. Bedeutung für den Standort Deutschland: Dieses Kapitel bewertet die Auswirkungen des §15b EStG auf den Wirtschaftsstandort Deutschland, insbesondere im Hinblick auf Fondsinvestitionen. Es untersucht den Beitrag der Regelung zu veränderten Standortbedingungen und analysiert die finanziellen Auswirkungen der Verlustverrechnungsbeschränkung auf die Wirtschaft. Es werden die möglichen positiven und negativen Konsequenzen für die Attraktivität Deutschlands als Investitionsstandort diskutiert.
5. Ergebnisse der Betrachtung: Dieses Kapitel fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen und bietet eine umfassende Bewertung des §15b EStG. Es wird der Beitrag zur Eindämmung von Steuerausfällen analysiert und die Notwendigkeit von Steuerstundungsmodellen im Kontext der neuen Regelung bewertet. Die Ergebnisse werden kritisch reflektiert und in einen größeren wirtschaftlichen und politischen Kontext eingeordnet.
Schlüsselwörter
§15b EStG, Steuerstundungsmodelle, Verlustverrechnung, Verlustausgleich, Fondsinvestitionen, Steuerrecht, Wirtschaftsstandort Deutschland, Steuerausfälle.
Häufig gestellte Fragen zur Bachelorarbeit: Auswirkungen des §15b EStG auf Verlustausgleiche im Zusammenhang mit Steuerstundungsmodellen
Was ist der Gegenstand dieser Bachelorarbeit?
Die Arbeit untersucht die Auswirkungen des §15b EStG auf Verlustausgleiche bei Steuerstundungsmodellen. Sie analysiert die Notwendigkeit der Einschränkung der Verlustausgleichsmöglichkeiten und die praktischen Folgen des §15b EStG.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische Entwicklung der Regelungen zur Verlustverrechnung (§§ 15a, 2b und 15b EStG), eine detaillierte Analyse des §15b EStG (inkl. aller Absätze), die Auswirkungen auf verschiedene Steuerstundungsmodelle, die Bedeutung für den Wirtschaftsstandort Deutschland und eine Bewertung der Notwendigkeit von Steuerstundungsmodellen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Einleitung, Historischer Überblick, Notwendigkeit der Einschränkung der Verlustausgleichsmöglichkeit, Bedeutung für den Standort Deutschland und Ergebnisse der Betrachtung. Jedes Kapitel enthält eine Zusammenfassung der behandelten Inhalte.
Welche Fragen werden in der Arbeit beantwortet?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Notwendigkeit der Einschränkung von Verlustausgleichen durch den §15b EStG zu beleuchten und die praktischen Auswirkungen auf Steuerstundungsmodelle zu analysieren. Sie untersucht die Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort Deutschland und bewertet die Notwendigkeit von Steuerstundungsmodellen im Allgemeinen.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind §15b EStG, Steuerstundungsmodelle, Verlustverrechnung, Verlustausgleich, Fondsinvestitionen, Steuerrecht, Wirtschaftsstandort Deutschland und Steuerausfälle.
Welche historischen Regelungen werden betrachtet?
Die Arbeit untersucht die historischen Regelungen der §§ 15a und 2b EStG im Vergleich zum neuen §15b EStG, um die Entwicklung und die Notwendigkeit der neuen Regelung zu verdeutlichen.
Wie wird der §15b EStG im Detail analysiert?
Die Arbeit analysiert den §15b EStG Absatz für Absatz, inklusive der verfahrensrechtlichen Regelungen und der rückwirkenden Anwendung. Kritische Punkte der Regelung werden ebenfalls diskutiert.
Welche Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort Deutschland werden betrachtet?
Die Arbeit analysiert die Auswirkungen des §15b EStG auf den Wirtschaftsstandort Deutschland, insbesondere auf Fondsinvestitionen, und bewertet die finanziellen Konsequenzen der Verlustverrechnungsbeschränkung.
Wie werden die Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst?
Das letzte Kapitel fasst die Ergebnisse zusammen, bewertet den §15b EStG umfassend, analysiert seinen Beitrag zur Eindämmung von Steuerausfällen und bewertet die Notwendigkeit von Steuerstundungsmodellen im Kontext der neuen Regelung.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Studierende, Wissenschaftler, Steuerberater und alle, die sich mit Steuerrecht, insbesondere mit Verlustverrechnung und Steuerstundungsmodellen, beschäftigen.
- Citar trabajo
- Ingo Schreiber (Autor), 2007, §15b EStG - Verluste im Zusammenhang mit Steuerstundungsmodellen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/76286