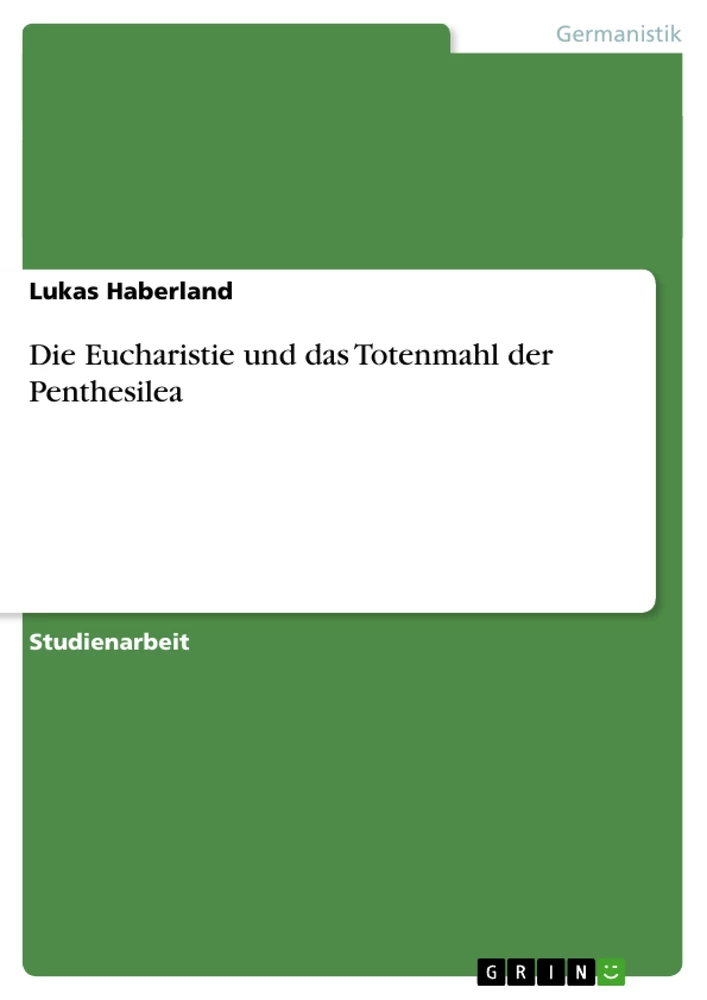Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, dem Zusammenhang zwischen dem christlichen Sakrament der Eucharistie und dem „Totenmahl“ in Kleists „Penthesilea“ nachzugehen.
Zu diesem Zwecke wird zunächst das Prinzip der Eucharistie näher erläutert und ihre Verwandtschaft zur Anthropophagie kurz dargestellt.
Im Anschluss prüfe ich, inwieweit sich in Kleists Beschreibung der Tötung Achills durch Penthesilea Anlehnungen an die Eucharistie finden; ferner wird zu untersuchen sein, wie diese beschaffen sind.
Entscheidend ist dabei für mich die Frage, ob es Sinn ergibt, bei der Kleistschen Adaption der Eucharistie-Symbolik von einer spöttischen Inversion des christlichen Sakraments zu sprechen. Um dies zu ermitteln, werden auch biographische Fakten Kleists miteinbezogen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Eucharistie
- Das Wesen der Eucharistie
- Die Eucharistie und ihre „bedenkliche Nähe zur Anthropophagie“
- Penthesilea
- Die Vergötterung Achills
- Die Anspielungen auf die Eucharistie
- Zwischen Inversion und Parodie
- „Irreligiös bis zur Feindseligkeit“?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Verbindung zwischen dem christlichen Sakrament der Eucharistie und dem „Totenmahl“ in Kleists „Penthesilea“. Zunächst wird die Eucharistie erläutert und ihre Beziehung zur Anthropophagie betrachtet. Anschließend wird analysiert, inwieweit Kleists Darstellung der Tötung Achills durch Penthesilea Anlehnungen an die Eucharistie aufweist und welche Art diese Anlehnungen haben. Die zentrale Frage ist, ob Kleists Adaption der Eucharistie-Symbolik als spöttische Inversion des christlichen Sakraments interpretiert werden kann. Biographische Fakten Kleists werden ebenfalls berücksichtigt.
- Die Eucharistie als christliches Sakrament und ihre verschiedenen Interpretationen.
- Die Darstellung des „Totenmahls“ in Kleists „Penthesilea“.
- Analogien und Unterschiede zwischen dem „Totenmahl“ und der Eucharistie.
- Die Frage nach einer möglichen Inversion oder Parodie der Eucharistie-Symbolik bei Kleist.
- Der Einfluss biographischer Fakten Kleists auf seine Darstellung.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit untersucht den Zusammenhang zwischen der christlichen Eucharistie und dem „Totenmahl“ in Kleists „Penthesilea“. Sie erläutert zunächst das Wesen der Eucharistie und deren Nähe zur Anthropophagie, bevor sie die Anlehnungen an die Eucharistie in Kleists Beschreibung der Tötung Achills analysiert und die Frage nach einer möglichen spöttischen Inversion des christlichen Sakraments untersucht. Biographische Aspekte Kleists werden ebenfalls einbezogen, um ein umfassendes Verständnis zu ermöglichen. Die Arbeit verfolgt somit einen interdisziplinären Ansatz, der theologische und literaturwissenschaftliche Perspektiven verbindet, um die komplexen Bezüge zwischen religiöser Symbolik und literarischer Gestaltung zu erhellen.
Die Eucharistie: Dieses Kapitel bietet eine detaillierte Erläuterung des christlichen Sakraments der Eucharistie. Es beleuchtet verschiedene Interpretationen des Abendmahls, beginnend mit den synoptischen Einsetzungsberichten und dem Johannes-Evangelium. Die Debatte um die historische Authentizität der Berichte wird angesprochen, ebenso wie die unterschiedlichen Auslegungen der Einsetzungsworte. Das Kapitel analysiert verschiedene Aspekte der Eucharistie, darunter den Opfergedanken, die Sühne, die Bundeserneuerung, die eschatologische Bedeutung und die Frage der Präsenz Christi, wobei die unterschiedlichen Positionen des Katholizismus und des Protestantismus berücksichtigt werden. Die verschiedenen theologischen und exegetischen Perspektiven werden umfassend dargestellt, um ein fundiertes Verständnis des Sakraments zu ermöglichen und den späteren Vergleich mit dem „Totenmahl“ in Kleists Drama vorzubereiten. Der Bezug zum Passahmahl und die Bedeutung des Lammopfers werden ebenfalls erörtert.
Schlüsselwörter
Eucharistie, Abendmahl, Penthesilea, Heinrich von Kleist, Anthropophagie, Kannibalismus, Opfer, Sühne, Inversion, Parodie, christliche Symbolik, literarische Gestaltung, religiöse Symbolik.
Häufig gestellte Fragen zu: Analyse der Eucharistie-Symbolik in Kleists Penthesilea
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit analysiert die Verbindung zwischen dem christlichen Sakrament der Eucharistie und dem „Totenmahl“ in Heinrich von Kleists Drama „Penthesilea“. Sie untersucht, inwieweit Kleists Darstellung der Tötung Achills durch Penthesilea Anlehnungen an die Eucharistie aufweist und ob diese als spöttische Inversion oder Parodie des christlichen Sakraments interpretiert werden kann. Biographische Aspekte Kleists werden ebenfalls berücksichtigt.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit umfasst eine detaillierte Erläuterung der Eucharistie, einschließlich verschiedener Interpretationen und theologischer Perspektiven. Sie analysiert Kleists Darstellung des „Totenmahls“ in „Penthesilea“, vergleicht dieses mit der Eucharistie, und untersucht Analogien und Unterschiede. Ein zentrales Thema ist die Frage nach einer möglichen Inversion oder Parodie der Eucharistie-Symbolik in Kleists Werk. Der Einfluss biographischer Fakten Kleists auf seine Darstellung wird ebenfalls untersucht.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Forschungsfrage und den methodischen Ansatz erläutert. Es folgt ein Kapitel zur Eucharistie, das das Sakrament detailliert beschreibt und verschiedene Interpretationen beleuchtet. Ein weiteres Kapitel analysiert das „Totenmahl“ in „Penthesilea“ im Hinblick auf seine Bezüge zur Eucharistie. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse und Schlussfolgerungen.
Welche Rolle spielt die Anthropophagie?
Die Arbeit betrachtet die „bedenkliche Nähe zur Anthropophagie“ der Eucharistie und untersucht, inwieweit diese Thematik in Kleists Darstellung des „Totenmahls“ eine Rolle spielt. Der Kannibalismusaspekt wird im Kontext der Analyse der Eucharistie und ihrer möglichen Inversion in Kleists Werk untersucht.
Welche Schlussfolgerungen werden gezogen?
Die Arbeit zielt darauf ab, zu klären, ob Kleists Adaption der Eucharistie-Symbolik als spöttische Inversion des christlichen Sakraments interpretiert werden kann. Die Schlussfolgerungen basieren auf einer detaillierten Analyse der theologischen und literaturwissenschaftlichen Aspekte des Themas. Die Arbeit verbindet theologische und literaturwissenschaftliche Perspektiven, um die komplexen Bezüge zwischen religiöser Symbolik und literarischer Gestaltung zu erhellen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Eucharistie, Abendmahl, Penthesilea, Heinrich von Kleist, Anthropophagie, Kannibalismus, Opfer, Sühne, Inversion, Parodie, christliche Symbolik, literarische Gestaltung, religiöse Symbolik.
- Quote paper
- Lukas Haberland (Author), 2007, Die Eucharistie und das Totenmahl der Penthesilea, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/76374