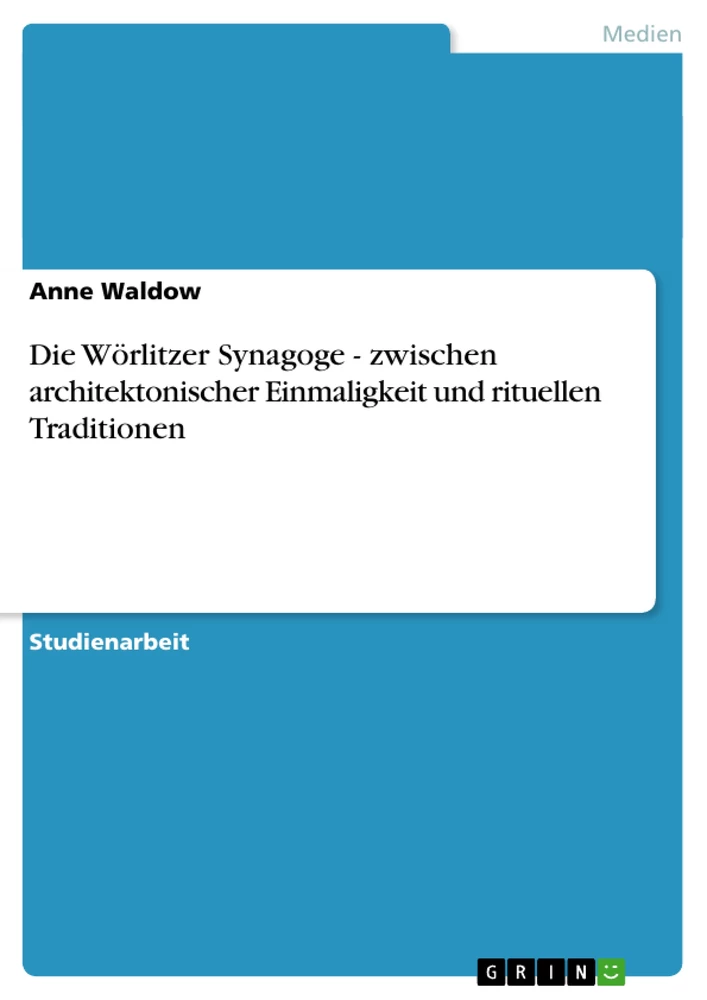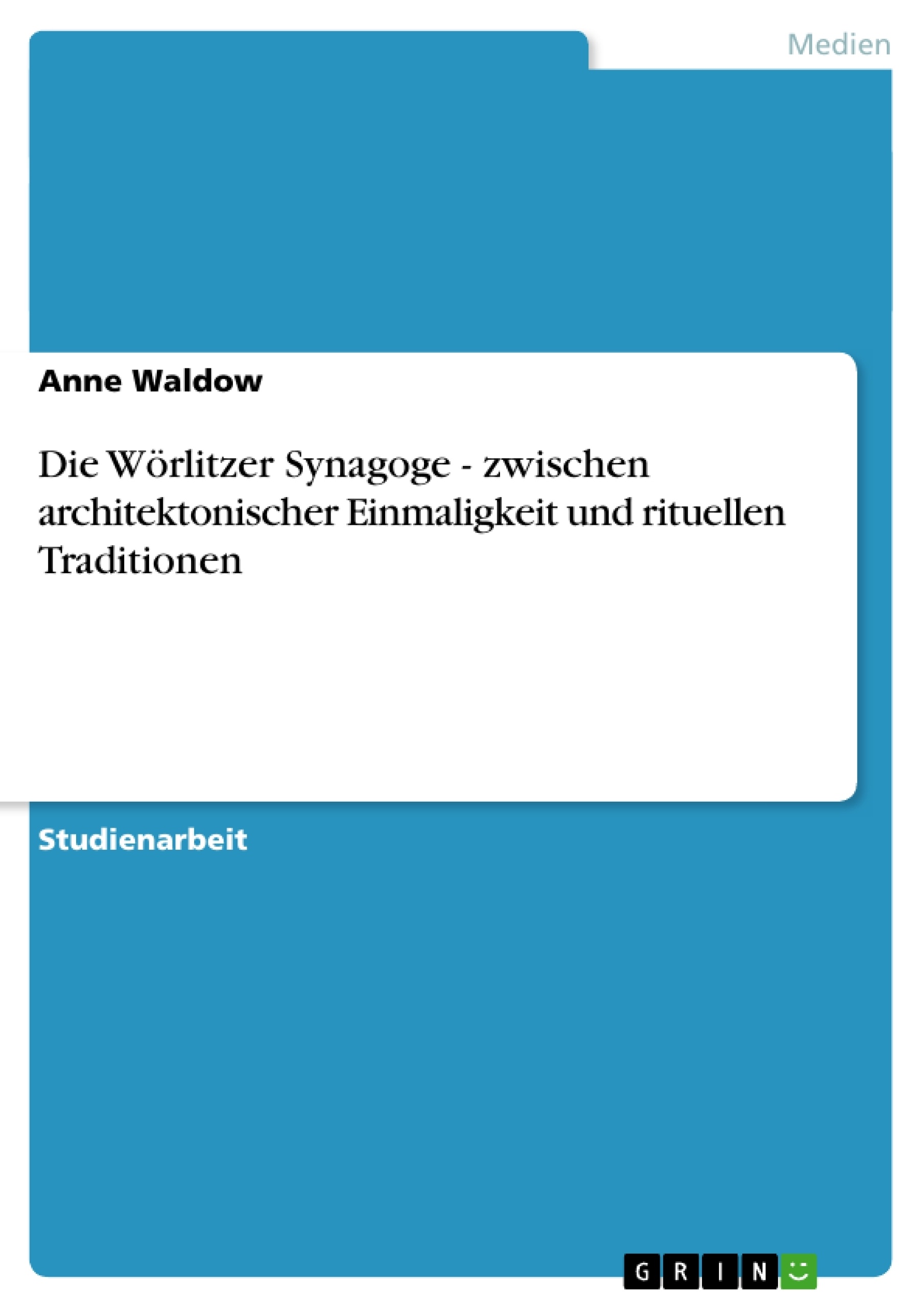Einem Erbauer eines jüdischen Sakralbaus sind architektonisch viele Freiheiten gegeben, da es nur wenige Vorschriften für den Bau einer Synagoge gibt. Das erklärt, warum sich typische Baustile in diesem Bereich nicht über Jahrhunderte hinweg gehalten haben: die Architektur von Synagogen ist abhängig von ihrem zeitgenössischen Umfeld und damit stets im Wandel begriffen.
Eine solche architektonische Wende ist im ausklingenden 18. Jahrhundert zu verzeichnen. Die allgemeine Einführung eines klassizistischen Baustils in Deutschland hatte auch Auswirkungen auf den Synagogenbau im Speziellen. Hier wurde radikal mit jüdischen Traditionen gebrochen, die sich zuvor über mehrere Jahrhunderte im 17. und 18. Jahrhundert gehalten hatten.
Wie ist dies zu erklären?
Und, wurde mit den vermehrt baulichen Veränderungen dieser Zeit ein bestimmter Zweck verfolgt?
Ein herausragendes und einmaliges Beispiel architektonischer Neulösungen stellt die Wörlitzer Synagoge im heutigen Sachsen-Anhalt dar. Der Bruch mit einem klassischen rechteckigen Grundriss und der räumlichen Verbindung von Gebetsraum mit Ritualbad (Mikwe) machen das Gebäude zu einem interessanten Forschungsobjekt. Es gilt, zu untersuchen, ob diesen Veränderungen tiefgreifendere Beweggründe unterliegen, als einzig die Ausnutzung gestalterischer Freiheiten des Architekten. Daraus ergibt sich auch die Frage, inwieweit liturgische Anforderungen der Innengestaltung dem jüdischen Gottesdienst dann noch entsprechen können.
Das im Wintersemester 2006/2007 an der Universität Greifswald angebotene Seminar »Jüdischer Ritus und Synagogenarchitektur«, in dessen Rahmen die vorliegende Arbeit entstanden ist, gibt Anlass, diese Thematik näher zu betrachten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Historischer Hintergrund und Entstehungsgeschichte der Wörlitzer Synagoge im 18. Jh.
- Architektur und Ritus der Wörlitzer Synagoge
- Architektonische Besonderheiten
- Rundbau
- Mikwe
- Rituelle Regelmäßigkeiten
- Architektonische Besonderheiten
- Vom >>Judentempel« zum »Vesta-Tempel« – Die Synagoge im Wandel der Zeit
- Zeit des Dritten Reiches
- Restaurierung und Nutzung des Baus nach 1945
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Wörlitzer Synagoge, ein bemerkenswertes Beispiel für architektonische Neulösungen im Synagogenbau des 18. Jahrhunderts. Sie analysiert den Bruch mit traditionellen Grundrissen und die Integration eines Ritualbades (Mikwe) in den Gebetsraum. Ziel ist es, die Beweggründe hinter diesen Veränderungen zu beleuchten und zu untersuchen, inwieweit liturgische Anforderungen der Innengestaltung dem jüdischen Gottesdienst entsprechen konnten.
- Der Einfluss des Klassizismus auf den Synagogenbau im 18. Jahrhundert.
- Die architektonische Besonderheit der Wörlitzer Synagoge.
- Die Beziehung zwischen Architektur und Ritus in der Wörlitzer Synagoge.
- Der Wandel der Synagoge im Laufe der Zeit.
- Die Bedeutung der Wörlitzer Synagoge für die jüdische Geschichte in Anhalt.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der architektonischen Freiheit beim Synagogenbau ein und stellt die Wörlitzer Synagoge als Forschungsobjekt vor. Sie beleuchtet die Frage nach den Beweggründen für die architektonischen Veränderungen und deren Auswirkungen auf den jüdischen Gottesdienst.
- Historischer Hintergrund und Entstehungsgeschichte der Wörlitzer Synagoge im 18. Jh.: Dieses Kapitel beleuchtet die Geschichte der Juden in Anhalt im 18. Jahrhundert, mit besonderem Fokus auf das Regierungsgebiet Anhalt-Dessau. Es zeigt die Toleranzpolitik des Fürsten Leopold III. Franz von Anhalt-Dessau und die daraus resultierende Blüte der jüdischen Gemeinschaft.
- Architektur und Ritus der Wörlitzer Synagoge: Dieses Kapitel beschreibt die architektonischen Besonderheiten der Wörlitzer Synagoge, insbesondere den Rundbau und das Ritualbad (Mikwe). Es untersucht, wie sich diese architektonischen Besonderheiten auf den jüdischen Ritus auswirken.
- Vom >>Judentempel« zum »Vesta-Tempel« – Die Synagoge im Wandel der Zeit: Dieses Kapitel betrachtet die Veränderung der Synagoge im Laufe der Zeit, insbesondere während der Zeit des Dritten Reiches und nach 1945. Es analysiert die Auswirkungen der politischen und gesellschaftlichen Veränderungen auf die Nutzung und Funktion des Gebäudes.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Wörlitzer Synagoge, einem wichtigen Beispiel für den Wandel des Synagogenbaus im 18. Jahrhundert. Sie analysiert die Architektur, den Ritus, die historische Entwicklung und die Bedeutung des Gebäudes im Kontext der jüdischen Geschichte in Anhalt. Schlüsselbegriffe sind: Synagogenarchitektur, Klassizismus, Ritus, Mikwe, Anhalt-Dessau, jüdische Geschichte.
- Citation du texte
- Anne Waldow (Auteur), 2007, Die Wörlitzer Synagoge - zwischen architektonischer Einmaligkeit und rituellen Traditionen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/76750