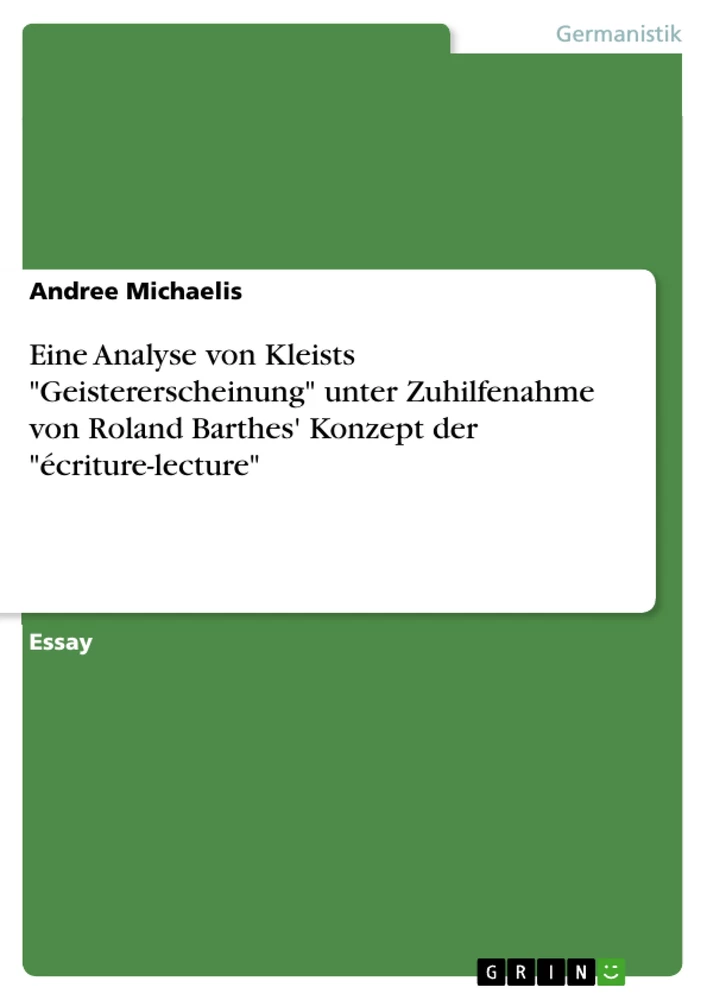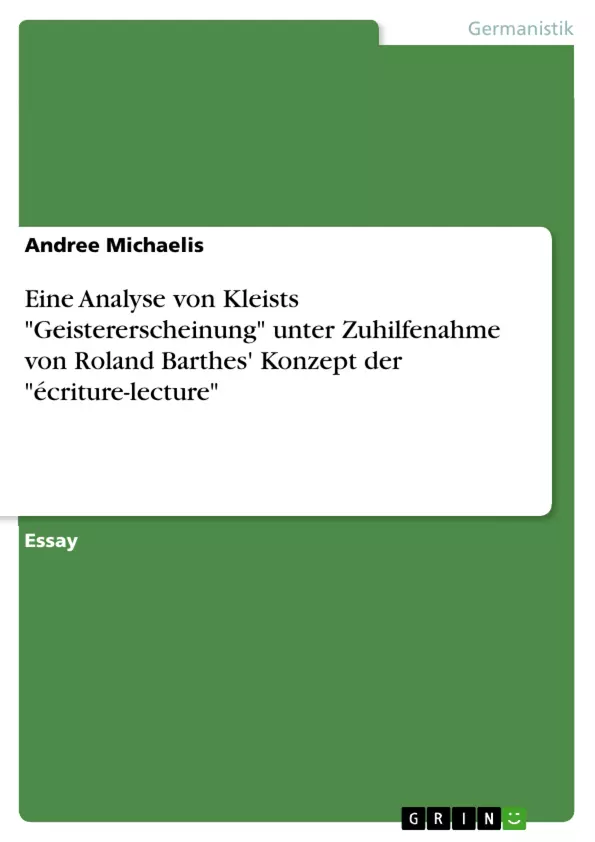"B(arthes)/K(leist): Geisterscheinung" ist ein spielerisch nachvollziehender Essay eines Umgangs mit literarischen Texten, den der französische Literaturtheoretiker und -kritiker Roland Barthes "écriture-lecture" genannt hat. Das damit benannte Vorgehen, das die Beschreibung einer Art reflektierten Lesens darstellt und keine Methode konstituiert, wird anhand von Heinrich Kleists kurzer Anekdote "Geistererscheinung" erprobt und kritisch auf seine bleibende methodische Nutzbarkeit hin befragt. Stil und Sprache sind durch und durch poststrukturalistisch gefärbt, während der Wertmaßstab der Arbeit das Spiel ist, ihr Ziel hingegen eine Ideologiekritik literaturtheoretischen Arbeitens schlechthin.
Inhaltsverzeichnis
- I. Vorbemerkung
- II. Textbegriff I: Intertextualität
- III. Heinrich von Kleist – Geistererscheinung: Kommentierung der Lexien 1 bis 4
- Die Codes: Ideologische Stimmen
- Kommentierung der Lexien 5 bis 16
- IV. Textbegriff II: Tausch und Ware
- Kommentierung der Lexien 17 bis 20
- V. Grenzen der Entscheidbarkeit: Zwischen lesbar u. schreibbar
- VI. Kommentierung der Lexien 21 bis 24
- Textbegriff III: Notwendige Einschränkungen der Textwahl
- Kommentierung der Lexien 25 bis 30
- VII. Keine Interpretation? – Das Spiel mit den Bedeutungen
- Kommentierung der Lexien 31 bis 48
- VIII. Die „Deformation der Methode“ und ihr Nutzen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit verfolgt das Ziel, Roland Barthes' Konzept der „écriture-lecture“ anhand einer Analyse von Kleists „Geistererscheinung“ kritisch zu untersuchen und dessen methodische Nutzbarkeit zu erproben. Sie beleuchtet dabei die im Barthes'schen Vorgehen impliziten ideologischen Prämissen und hinterfragt diese kritisch. Die Arbeit verbindet praktische Textanalyse mit methodischer Reflexion.
- Kritische Auseinandersetzung mit Barthes' „écriture-lecture“
- Analyse von Kleists „Geistererscheinung“ unter Anwendung des Barthes'schen Ansatzes
- Untersuchung der ideologischen Prämissen in Barthes' Methode
- Bedeutung des Intertextualitätsbegriffs für die Textinterpretation
- Reflexion über die Grenzen und Möglichkeiten der Textanalyse
Zusammenfassung der Kapitel
I. Vorbemerkung: Diese Einleitung beschreibt die Zielsetzung der Arbeit: die kritische Auseinandersetzung mit und Anwendung von Roland Barthes' „écriture-lecture“ auf Kleists „Geistererscheinung“. Es wird betont, dass die Arbeit nicht nur Barthes' Methode anwendet, sondern diese auch kritisch hinterfragt, insbesondere hinsichtlich der impliziten ideologischen Prämissen. Der Ansatz ist praktisch und theoretisch zugleich, wobei die Praxis des Schreibens selbst als Ausgangspunkt dient. Die Arbeit wählt eine spielerische Struktur zwischen Praxis und Theorie.
II. Textbegriff I: Intertextualität: Dieses Kapitel erläutert Barthes' Textbegriff, der den erzählenden Text als ein Geflecht verschiedener Stimmen und Codes versteht, das mit Gesellschaft und Geschichte verwoben ist. Es greift den Intertextualitätsbegriff von Julia Kristeva auf, die jeden Text als ein Mosaik von Zitaten und Transformationen anderer Texte betrachtet. Dieser Textbegriff bildet die Grundlage für Barthes' methodisches Vorgehen, das den Text als Ergebnis und Quelle kultureller Kombinatorik sieht. Die Analyse der „Geistererscheinung“ wird in diesem Kontext angekündigt.
III. Heinrich von Kleist – Geistererscheinung: Kommentierung der Lexien 1 bis 16: Dieses Kapitel beginnt mit der Analyse des Titels von Kleists „Geistererscheinung“, der als deiktisch und aussagekräftig beschrieben wird. Der Titel enthält bereits viele Codes des gesamten Textes und wird als Rätsel, das im Laufe des Textes gelöst werden soll, interpretiert. Die Analyse der Lexien 1-16 setzt sich mit dem hermeneutischen Code und den kulturellen Codes auseinander, welche die ideologischen Perspektiven des Textes offenlegen.
IV. Textbegriff II: Tausch und Ware: Dieses Kapitel setzt sich mit Barthes' Konzept des Textes als Ware auseinander. Die Analyse der Lexien 17-20 wird hier vermutlich den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Aspekt des Textes untersuchen, basierend auf Barthes' theoretischem Rahmen.
V. Grenzen der Entscheidbarkeit: Zwischen lesbar u. schreibbar: Dieses Kapitel dürfte sich mit den Grenzen und Möglichkeiten der Textinterpretation befassen, die sich aus dem gewählten methodischen Ansatz ergeben. Wahrscheinlich wird hier die Ambivalenz und die Unbestimmtheit von Bedeutung im Text thematisiert.
VI. Kommentierung der Lexien 21 bis 30: Die Analyse der Lexien 21-30 wird hier wahrscheinlich weitere Aspekte der „Geistererscheinung“ beleuchten und sich mit den zuvor eingeführten theoretischen Konzepten auseinandersetzen, möglicherweise mit dem Fokus auf die Einschränkungen der Textwahl und ihren Einfluss auf die Interpretation.
VII. Keine Interpretation? – Das Spiel mit den Bedeutungen: Dieses Kapitel wird sich mit dem Verhältnis zwischen Interpretation und dem Spiel mit Bedeutungen beschäftigen. Die Analyse der Lexien 31-48 untersucht wahrscheinlich die vielfältigen Interpretationsebenen des Textes und deren relative Unbestimmtheit. Das "Spiel" in der Überschrift deutet auf die methodische Offenheit und die Vermeidung endgültiger Interpretationen hin.
VIII. Die „Deformation der Methode“ und ihr Nutzen: Das Kapitel reflektiert kritisch über den Nutzen der „Deformation der Methode“, also über die bewusste Abkehr von einem strengen methodischen Vorgehen zugunsten einer offeneren, spielerischeren Herangehensweise an den Text. Wahrscheinlich wird hier die produktive Funktion der methodischen Abweichung hervorgehoben.
Schlüsselwörter
écriture-lecture, Roland Barthes, Heinrich von Kleist, Geistererscheinung, Intertextualität, Hermeneutischer Code, Ideologie, Textanalyse, Methode, Interpretation, Poststrukturalismus.
Häufig gestellte Fragen zu „Geistererscheinung“ – Eine Analyse nach Roland Barthes
Was ist das zentrale Thema der Arbeit?
Die Arbeit analysiert Heinrich von Kleists „Geistererscheinung“ unter Anwendung und kritischer Auseinandersetzung mit Roland Barthes' Konzept der „écriture-lecture“. Sie untersucht die methodische Nutzbarkeit des Ansatzes und hinterfragt dessen implizite ideologische Prämissen.
Welche Methoden werden verwendet?
Die Arbeit verbindet praktische Textanalyse mit methodischer Reflexion. Sie wendet Barthes' „écriture-lecture“ auf Kleists „Geistererscheinung“ an und analysiert den Text lexemweise (in Abschnitte unterteilt). Dabei wird der Fokus auf Intertextualität, den hermeneutischen Code und die ideologischen Prämissen in Barthes' Methode gelegt.
Welche Aspekte von Barthes' „écriture-lecture“ werden untersucht?
Die Arbeit untersucht Barthes' Textbegriff als Geflecht verschiedener Stimmen und Codes, die Verknüpfung von Text mit Gesellschaft und Geschichte, und den Intertextualitätsbegriff. Sie hinterfragt kritisch die ideologischen Prämissen in Barthes' Methode und die Grenzen der Entscheidbarkeit in der Textinterpretation.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in acht Kapitel gegliedert. Sie beginnt mit einer Vorbemerkung, die die Zielsetzung erläutert. Die folgenden Kapitel analysieren Kleists „Geistererscheinung“ lexemweise, wobei jeweils theoretische Überlegungen zu Barthes' Ansatz einbezogen werden. Die Arbeit schließt mit einer Reflexion über den Nutzen einer „Deformation der Methode“.
Was sind die wichtigsten Ergebnisse der Analyse?
Die Arbeit zeigt die Anwendung und kritische Auseinandersetzung mit Barthes' Ansatz auf. Sie beleuchtet die ideologischen Perspektiven im Text und hinterfragt die Grenzen und Möglichkeiten der Textinterpretation. Die „Deformation der Methode“ wird als produktive Herangehensweise an den Text hervorgehoben.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für die Arbeit?
Schlüsselbegriffe sind: écriture-lecture, Roland Barthes, Heinrich von Kleist, Geistererscheinung, Intertextualität, Hermeneutischer Code, Ideologie, Textanalyse, Methode, Interpretation, Poststrukturalismus.
Welche Kapitel gibt es und worum geht es jeweils?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu einer Vorbemerkung, Intertextualität, der Analyse von Kleists „Geistererscheinung“ in mehreren Abschnitten (Lexemen), dem Textbegriff als Tausch und Ware, den Grenzen der Entscheidbarkeit, weiteren Lexemanalysen, dem Spiel mit Bedeutungen und der Reflexion der „Deformation der Methode“.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit richtet sich an Leser*innen, die sich für Textanalyse, Literaturwissenschaft, und die Anwendung poststrukturalistischer Theorien interessieren. Sie ist insbesondere für Studierende der Germanistik und Literaturwissenschaft relevant.
- Quote paper
- Magister Artium Andree Michaelis (Author), 2003, Eine Analyse von Kleists "Geistererscheinung" unter Zuhilfenahme von Roland Barthes' Konzept der "écriture-lecture", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/77615