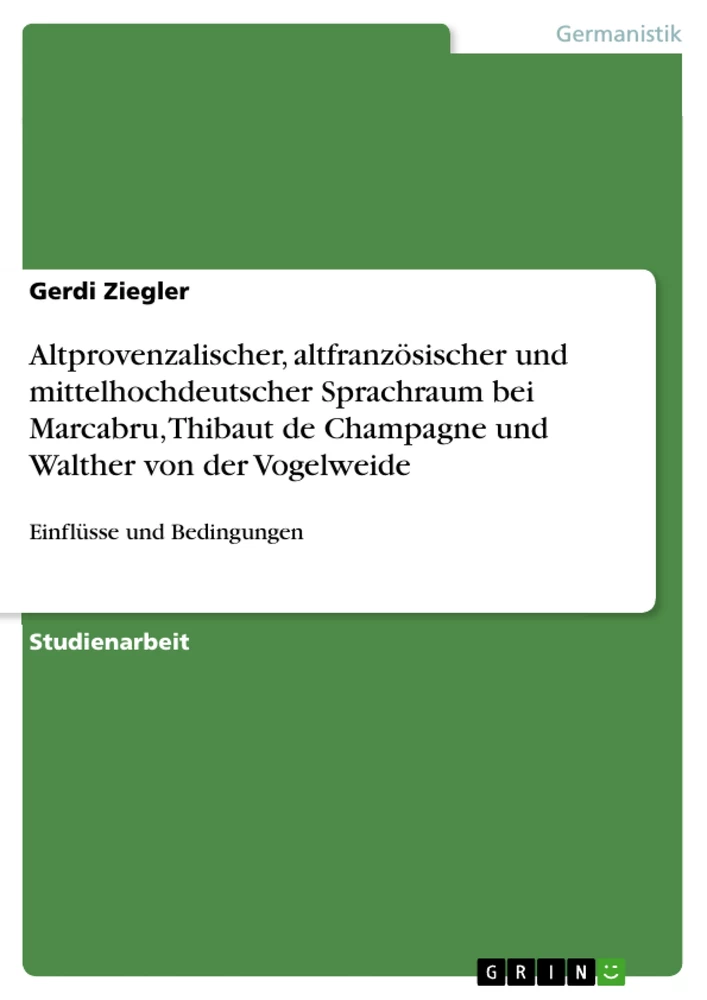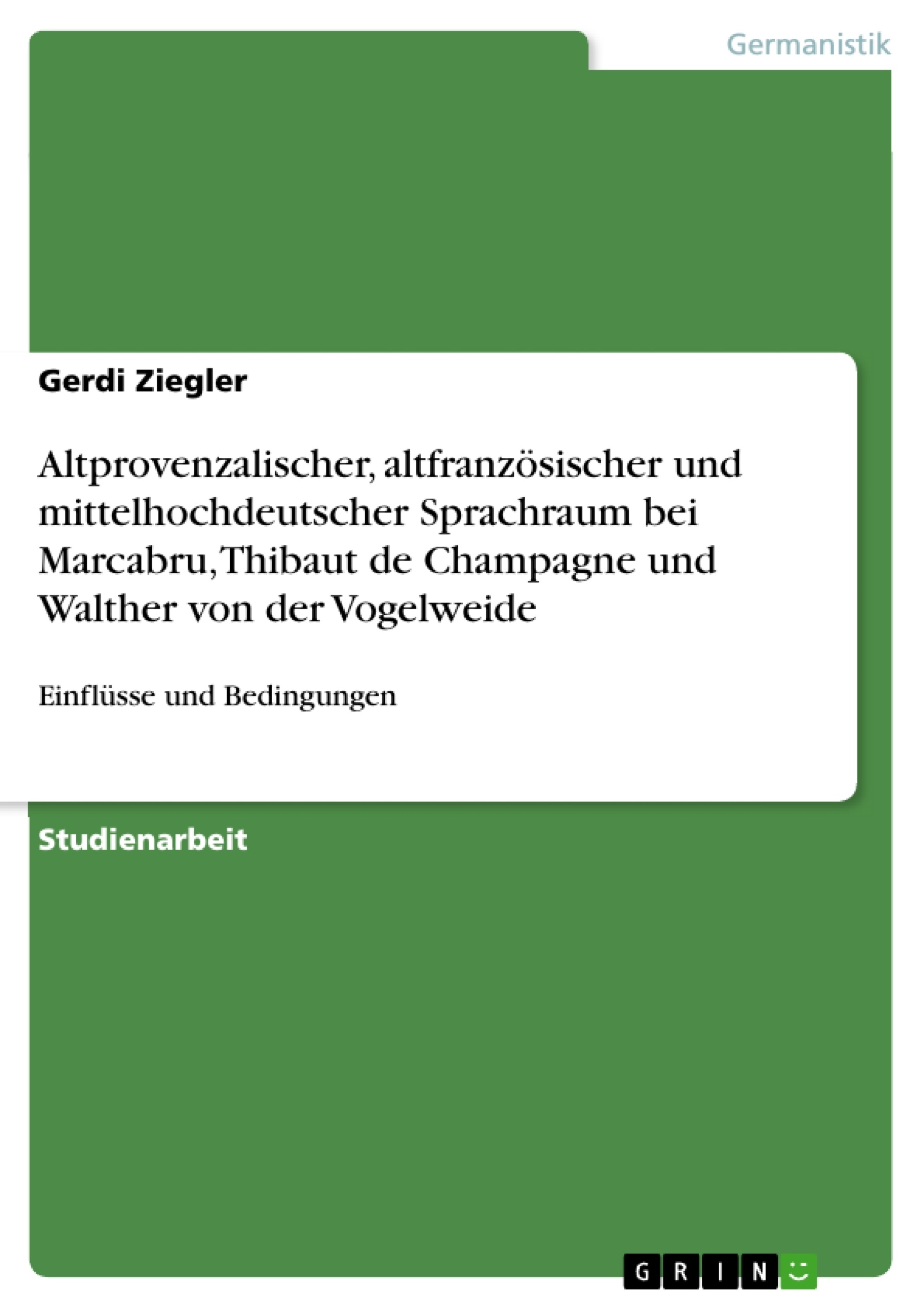Die weitreichende Einflussnahme des romanischen Sprachraums auf die Entwicklung der mittelhochdeutschen Versproduktion innerhalb verschiedener, teils erst mitüberlieferter und solchermaßen eingeführter Gattungen, soll im Zentrum dieser Arbeit stehen, da sich diese doch an weit mehr erkennen läßt als den primär feststellbaren, signifikanten Merkmalen von Gattungsthematik, struktureller Gesamtform, Motivik und sprachlichem Inventar.
Gerade dem romanischen Vorbild vermeintlich entfernte oder gänzlich verschiedene sprachliche Realisierungen des Deutschen folgen in poetischem Prinzip und trobadoureskem Leitgedanken den romanischen Torbadors des Südens und Trouvères des Nordens. Die von ihnen verwendeten und künstlerisch ausgearbeiteten Techniken werden in hohem Maße aus inhärenten Grundvoraussetzungen der Einzelsprache generiert, die ihrerseits im germanischen Idiom notwendigerweise nicht auf identisch Vergleichbares bzw. in ähnlicher Weise zu gestaltende Elemente treffen. Vielmehr zeigt sich, daß Grundsätzliches der Ausgestaltungs- und Darstellungsprinzipien über sprachliche Grenzen hinaus transportiert wird und dem Leitgedanken der Vorbilder entsprechend nachgestaltet wird, indem im Rahmen der anders gearteten Möglichkeiten des deutschen Idioms höfische Minnelyrik geschaffen wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Themenstellung der Arbeit
- METAPOETISCHE FUNKTION VON METRISCHER FORM UND REIM
- Metrische Form
- Reim
- VOKALE AKTION
- Musterhaftigkeit
- Spannung zwischen Wort und Stimme
- POETISCHE TECHNIKEN DER TROUBADOURS UND MINNESÄNGER
- FORM UND VORGABEN DER POETISCHEN “DOKTRINEN”
- Beispiele überlieferter Doktrinen
- KONVENTION UND SIGNIFIKANZ METRISCHER GESTALTUNG
- DIE GATTUNG DER PASTOURELLE
- Allgemeine Prämissen der Pastourellen Dichtung
- Formale Fixierungen bei Sprachraumwechsel
- BEISPIELE EINZELSPRACHLICHER PASTOURELLENDICHTUNG
- MARCABRU - L'autrier iost'una sebissa
- THIBAUT DE CHAMPAGNE - L'autrier par la matinee
- WALTHER VON DER VOGELWEIDE - Herzeliebes frouwelîn
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss romanischer Sprachräume auf die mittelhochdeutsche Versproduktion, insbesondere in Bezug auf die Gattungen der Troubadours und Minnesänger. Sie analysiert die metrischen und rhythmischen Strukturen sowie die Reimtechniken, die in diesen literarischen Traditionen verwendet werden, und zeigt auf, wie die verschiedenen Sprachräume einander beeinflusst haben.
- Die Bedeutung metrischer Form und Reim für die poetische Funktion
- Die Rolle der "vokalen Aktion" in der mittelalterlichen Dichtung
- Die Übertragung poetischer Techniken zwischen verschiedenen Sprachräumen
- Der Vergleich einzelsprachlicher Beispiele der Pastourellen Dichtung
- Die Bedeutung von Konventionen und Vorgaben für die Gestaltung poetischer Werke
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Der Text stellt die Forschungsfrage und den Forschungsrahmen vor. Er beleuchtet den Einfluss romanischer Sprachräume auf die mittelhochdeutsche Literatur, insbesondere auf die Versform, und erklärt die Relevanz der gewählten Themenstellung.
- Themenstellung der Arbeit: Dieses Kapitel beschreibt die Forschungsmethodik, die für den Vergleich der einzelnen Sprachräume angewendet wird. Die Analyse der Metrik, des Reims, des Rhythmus und der Melodie soll Aufschluss über die Beziehungen zwischen den verschiedenen Sprachformen geben.
- METAPOETISCHE FUNKTION VON METRISCHER FORM UND REIM: Die Kapitel erörtern die Bedeutung von Metrik, Rhythmus und Reim für die poetische Funktion in der Literatur. Es werden die Argumente von Werner Anhänger einer “linguistischen Poetik” zur Relevanz dieser Elemente für den mündlichen Vortrag und die Memorierung vorgestellt.
- VOKALE AKTION: Die Kapitel diskutieren den Begriff der "vokalen Aktion" und ihre Bedeutung für die Dichtung in Versform. Es werden zwei Aspekte behandelt: die Musterhaftigkeit von Sprachlauten und die Spannung zwischen Wort und Stimme.
- POETISCHE TECHNIKEN DER TROUBADOURS UND MINNESÄNGER: Dieses Kapitel analysiert die poetischen Techniken, die von den Troubadours und Minnesängern verwendet wurden. Es zeigt die Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den verschiedenen Sprachräumen auf.
- FORM UND VORGABEN DER POETISCHEN “DOKTRINEN”: Die Kapitel untersuchen die formalen Vorgaben und Konventionen der poetischen "Doktrinen" im Mittelalter. Es werden Beispiele aus verschiedenen Sprachräumen vorgestellt.
- KONVENTION UND SIGNIFIKANZ METRISCHER GESTALTUNG: Dieses Kapitel erläutert die Bedeutung von Konventionen und Vorgaben für die metrische Gestaltung von poetischen Werken.
- DIE GATTUNG DER PASTOURELLE: Die Kapitel untersuchen die Gattung der Pastourellen Dichtung. Es werden die allgemeinen Prämissen dieser Gattung sowie die formalen Anpassungen bei Sprachraumwechsel betrachtet.
- BEISPIELE EINZELSPRACHLICHER PASTOURELLENDICHTUNG: Das Kapitel beleuchtet einzelne Beispiele der Pastourellen Dichtung aus verschiedenen Sprachräumen. Es werden Werke von Marcabru, Thibaut de Champagne und Walther von der Vogelweide analysiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Bereiche der Metrik, Reimtechnik, Rhythmus und Melodie in der mittelhochdeutschen und romanischen Literatur. Besondere Aufmerksamkeit wird der "vokalen Aktion" und ihrer Bedeutung für die poetische Funktion gewidmet. Die Untersuchung befasst sich mit den poetischen Techniken der Troubadours und Minnesänger, den gattungsspezifischen Besonderheiten der Pastourellen Dichtung sowie den konventionellen Vorgaben der poetischen "Doktrinen". Die Arbeit basiert auf einem Vergleich einzelsprachlicher Beispiele, um die wechselseitigen Einflüsse und Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen Sprachräumen aufzuzeigen.
Häufig gestellte Fragen
Welchen Einfluss hatte der romanische Sprachraum auf den Minnesang?
Die romanischen Troubadours (Süden) und Trouvères (Norden) dienten als Vorbilder für Gattungsthematik, Motivik und poetische Techniken der mittelhochdeutschen Lyrik.
Was versteht man unter "vokaler Aktion"?
Dieser Begriff beschreibt die Bedeutung von Sprachlauten, Rhythmus und der Spannung zwischen Wort und Stimme für den mündlichen Vortrag mittelalterlicher Dichtung.
Was ist die Gattung der Pastourelle?
Die Pastourelle ist eine lyrische Gattung, die Begegnungen zwischen einem Ritter und einer Hirtin thematisiert. Die Arbeit vergleicht Beispiele von Marcabru, Thibaut de Champagne und Walther von der Vogelweide.
Wie wurde die Metrik beim Sprachraumwechsel angepasst?
Die Arbeit zeigt, dass Grundsätze der Gestaltung über Sprachgrenzen hinweg transportiert wurden, wobei die Techniken an die spezifischen Möglichkeiten des germanischen Idioms angepasst wurden.
Was sind die poetischen "Doktrinen" des Mittelalters?
Es handelt sich um überlieferte formale Vorgaben und Konventionen, die die Gestaltung von Versform, Reim und Struktur in den verschiedenen Sprachräumen regelten.
- Quote paper
- Gerdi Ziegler (Author), 1998, Altprovenzalischer, altfranzösischer und mittelhochdeutscher Sprachraum bei Marcabru, Thibaut de Champagne und Walther von der Vogelweide, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/7799