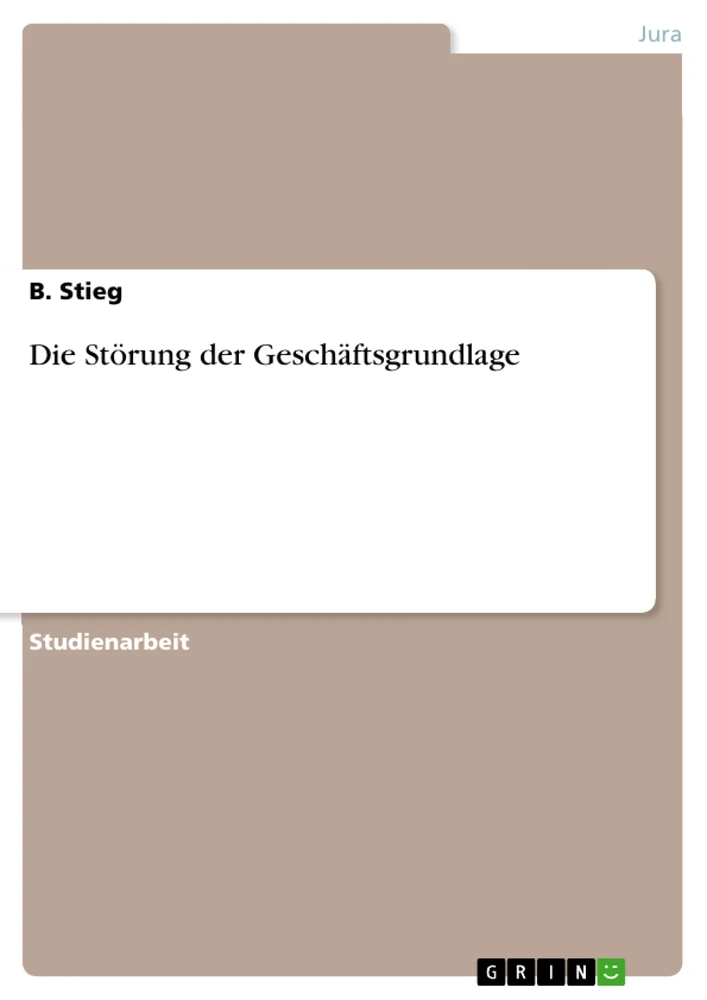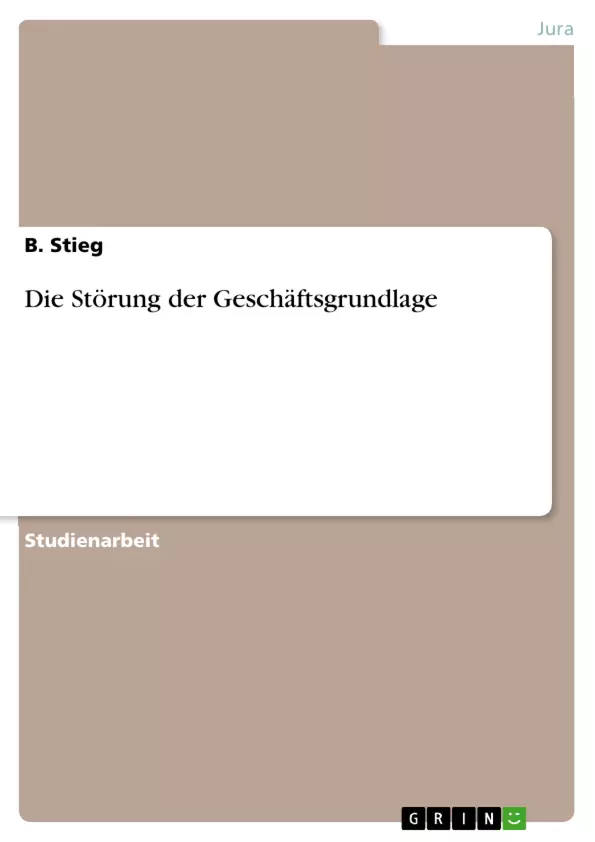Jedes Rechtsgeschäft ist auf eine bestimmte Gegebenheit von tatsächlichen
oder rechtlichen Verhältnissen bezogen.1 Die Parteien haben
entweder konkrete Vorstellungen von den Umständen des Vertragsumfelds,
die wichtig für die weitere Vertragsabwicklung sind, oder sie sind
selbstredend davon ausgegangen, dass die vorherrschenden Verhältnisse
gleich bleiben werden, ohne sich darüber weitere Gedanken zu
machen. Ändern sich nun diese maßgeblichen Verhältnisse, oder entsprachen
sie von Anfang an gar nicht der Wirklichkeit, kann dem Vertrag
seine Grundlage entzogen werden, was etwa dazu führen kann,
dass der mit dem Vertrag verfolgte Zweck gar nicht oder nur noch mit
unverhältnismäßig hohem Aufwand erreicht werden kann. Dabei stellt
sich die Frage, wann es sinnvoll ist am Grundsatz der Vertragstreue
festzuhalten und wann bzw. unter welchen Voraussetzungen ein Abgehen
vom Vertrag möglich sein soll. Hier setzt die Lehre von der Störung
der Geschäftsgrundlage an, die im Rahmen des Gesetzes zur Modernisierung
des Schuldrechts zum 01.01.2002 in § 313 BGB2 erstmals
rechtlich verankert wurde.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einführung...
- B. Das Institut der Geschäftsgrundlage....
- 1. Historische Entwicklung .....
- 1. Clausula rebus sic stantibus.....
- 2. Entwicklung der Rechtssprechung des RG und BGH..
- II. Das neue gesetzliche Konzept..........\n
- III. Der Begriff der Geschäftsgrundlage.
- 1. Subjektive Geschäftsgrundlage....
- 2. Objektive Geschäftsgrundlage
- 3. Große und kleine Geschäftsgrundlage......
- 1. Historische Entwicklung .....
- C. Anwendbarkeit
- I. Anwendungsbereich........
- II. Verhältnis zu anderen Regelungen............
- 1. Vertragsinhalt und -auslegung.
- 2. Irrtumsanfechtung........
- 3. Unmöglichkeit..........\n
- 4. Gewährleistungsrecht.....
- 5. Zweckverfehlungskondiktion.
- 6. Kündigung aus wichtigem Grund.......
- D. Voraussetzungen.
- I. Wegfall der Geschäftsgrundlage, § 313 I BGB..\
- 1. Grundlage des Vertrags
- 2. Schwerwiegende Veränderung
- 3. Keine Risikozuweisung……………………
- 4. Unzumutbarkeit.
- II. Fehlen der Geschäftsgrundlage, § 313 II..
- I. Wegfall der Geschäftsgrundlage, § 313 I BGB..\
- E. Fallgruppen
- I. Äquivalenzstörungen...
- II. Leistungserschwerungen
- III. Zweckstörungen.
- IV. Gemeinsamer Irrtum.......
- 1. Kalkulationsirrtum…..\n
- 2. Rechtsirrtum ......
- 3. Fehlvorstellungen über künftige Entwicklungen
- V. Sonstige Anwendungsfälle
- F. Rechtsfolgen
- 1. Anspruch auf Anpassung des Vertrags.
- II. Rücktrittsrecht oder Kündigungsrecht ......
- G. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert das Rechtsinstitut der Störung der Geschäftsgrundlage im deutschen Zivilrecht. Sie verfolgt das Ziel, die historischen Entwicklungen, die rechtlichen Grundlagen und die Anwendung dieses Instituts im modernen Rechtssystem zu beleuchten. Die Arbeit befasst sich insbesondere mit den Voraussetzungen und Rechtsfolgen einer Störung der Geschäftsgrundlage.
- Die historische Entwicklung des Instituts der Geschäftsgrundlage, insbesondere die Rolle der „clausula rebus sic stantibus“
- Die rechtlichen Grundlagen und Voraussetzungen für die Anwendung des Instituts der Geschäftsgrundlage
- Die verschiedenen Fallgruppen und Anwendungsbereiche des Instituts der Geschäftsgrundlage
- Die Rechtsfolgen einer Störung der Geschäftsgrundlage, insbesondere die Möglichkeiten der Anpassung, des Rücktritts und der Kündigung
- Die Bedeutung des Instituts der Geschäftsgrundlage für die Gewährleistung von Vertragsgerechtigkeit und wirtschaftlicher Stabilität
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die das Institut der Geschäftsgrundlage einführt und seine Relevanz für das deutsche Rechtssystem beleuchtet. Anschließend wird die historische Entwicklung des Instituts untersucht, beginnend mit der „clausula rebus sic stantibus“ und der Entwicklung der Rechtsprechung des Reichsgerichts und des Bundesgerichtshofs. Kapitel II behandelt das neue gesetzliche Konzept der Geschäftsgrundlage, während Kapitel III den Begriff der Geschäftsgrundlage genauer betrachtet, wobei zwischen subjektiver und objektiver Geschäftsgrundlage sowie zwischen großen und kleinen Geschäftsgrundlagen unterschieden wird.
Kapitel C befasst sich mit der Anwendbarkeit des Instituts der Geschäftsgrundlage und untersucht seinen Anwendungsbereich sowie sein Verhältnis zu anderen Regelungen des Zivilrechts, wie z.B. Vertragsinhalt und -auslegung, Irrtumsanfechtung, Unmöglichkeit, Gewährleistungsrecht, Zweckverfehlungskondiktion und Kündigung aus wichtigem Grund. Kapitel D widmet sich den Voraussetzungen für die Anwendung des Instituts der Geschäftsgrundlage, insbesondere dem Wegfall oder Fehlen der Geschäftsgrundlage sowie den Anforderungen an die Schwere der Veränderung, die Risikozuweisung und die Unzumutbarkeit.
Kapitel E beschäftigt sich mit verschiedenen Fallgruppen und Anwendungsbeispielen des Instituts der Geschäftsgrundlage, darunter Äquivalenzstörungen, Leistungserschwerungen, Zweckstörungen und Gemeinsamer Irrtum, wobei der Kalkulationsirrtum, der Rechtsirrtum und Fehlvorstellungen über künftige Entwicklungen im Detail betrachtet werden. Darüber hinaus werden auch weitere Anwendungsfälle des Instituts der Geschäftsgrundlage beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit zentralen Begriffen und Themen des deutschen Zivilrechts, insbesondere mit den folgenden Schlüsselbegriffen: Störung der Geschäftsgrundlage, clausula rebus sic stantibus, Vertragsanpassung, Rücktritt, Kündigung, Äquivalenz, Leistungserschwerung, Zweckstörung, Gemeinsamer Irrtum, Rechtsirrtum, Kalkulationsirrtum, Fehlvorstellungen über künftige Entwicklungen, Risikozuweisung, Unzumutbarkeit, Vertragsgerechtigkeit, wirtschaftliche Stabilität.
- Citar trabajo
- B. Stieg (Autor), 2005, Die Störung der Geschäftsgrundlage, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/78132