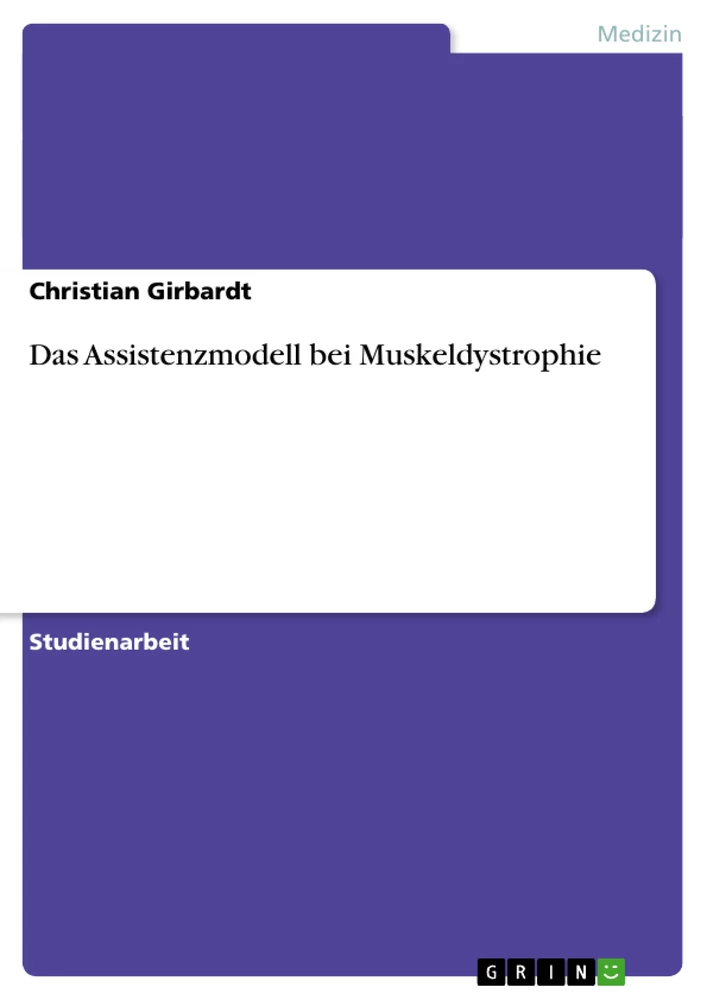Beim Assistenzmodell geht es in Abgrenzung zu früheren Formen der Betreuung darum, dass der Behinderte zu Hause wohnen bleibt und dabei selbstbestimmt über den Einsatz seiner persönlichen Assistenten entscheiden kann. Idealerweise fungiert er dabei als Arbeitgeber für die Assistenten. Die vorliegende Arbeit basiert auf dem Besuch bei einer Frau mit Muskeldystrophie, die dieses Konzept umgesetzt hat.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Hauptteil
- 2.1 Das Assistenzmodell
- 2.1.1 Was ist das Assistenzmodell?
- 2.1.2 Hintergrund
- 2.1.2.1 Geschichtliches
- 2.1.2.2 Gesetzeslage
- 2.1.3 Bedeutung des Assistenzmodells für die Betroffenen
- 2.1.4 Das Assistenzmodell speziell bei Frauen
- 2.2 Muskeldystrophie
- 2.2.1 Klinisches Bild
- 2.2.2 Epidemiologie
- 2.2.3 Früherkennung
- 2.2.4 Therapie, Rehabilitation und Gesundheitsbildung
- 2.2.5 Soziale Integration und Umweltprobleme
- 2.3 Erfahrungen mit dem Assistenzmodell bei Muskeldystrophie am Beispiel von Frau Schmidt
- 2.3.1 Die Muskeldystrophie und ihre lebensweltliche Dimension
- 2.3.2 Konkrete Umsetzung des Assistenzmodells
- 2.3.3 Das Assistenzmodell als Teil des Lebenssinns
- 3 Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit dem Assistenzmodell und dessen Bedeutung für Menschen mit Muskeldystrophie. Sie analysiert das Konzept des Assistenzmodells, beleuchtet seine geschichtliche Entwicklung und die rechtlichen Rahmenbedingungen. Darüber hinaus untersucht die Arbeit die Bedeutung des Assistenzmodells für die Lebensqualität und Selbstbestimmung von Menschen mit Muskeldystrophie und beleuchtet die Erfahrungen von Frau Schmidt als Beispielfall.
- Das Assistenzmodell als Konzept der selbstbestimmten Lebensführung
- Die Bedeutung des Assistenzmodells für Menschen mit Muskeldystrophie
- Die rechtlichen Grundlagen des Assistenzmodells
- Die praktische Umsetzung des Assistenzmodells im Lebensalltag von Frau Schmidt
- Die Auswirkungen des Assistenzmodells auf die Lebensqualität und Selbstbestimmung von Menschen mit Muskeldystrophie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Fall von Frau Schmidt, einer 40-jährigen Frau mit Muskeldystrophie, vor, und führt in das Thema des Assistenzmodells als Alternative zum Leben in einem Heim ein. Das zweite Kapitel widmet sich dem Assistenzmodell, definierend seine Merkmale und seine Rolle im Kontext der Independent-Living-Bewegung. Der Abschnitt beleuchtet die historische Entwicklung des Assistenzmodells, die rechtlichen Grundlagen und seine Bedeutung für die Selbstbestimmung der Betroffenen. Das dritte Kapitel konzentriert sich auf die Muskeldystrophie, wobei das klinische Bild, die Epidemiologie, die Früherkennung, Therapie und Rehabilitation sowie die sozialen und umweltbedingten Herausforderungen beleuchtet werden. Das letzte Kapitel beleuchtet die Erfahrungen von Frau Schmidt mit dem Assistenzmodell, wobei die Auswirkungen der Krankheit auf ihren Alltag, die praktische Umsetzung des Assistenzmodells und dessen Beitrag zu ihrem Lebenssinn fokussiert werden.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beleuchtet das Assistenzmodell als ein zentrales Konzept für die Selbstbestimmung von Menschen mit Muskeldystrophie. Dabei werden wichtige Themen wie Independent Living, Selbstbestimmung, Teilhabe am Leben in der Gesellschaft, rechtliche Grundlagen, praktische Umsetzung und Lebensqualität behandelt. Die Arbeit basiert auf dem Beispiel von Frau Schmidt, einer Frau mit Muskeldystrophie, die von dem Assistenzmodell profitiert.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Assistenzmodell für Menschen mit Behinderung?
Das Assistenzmodell ermöglicht es Menschen mit Behinderung, in der eigenen Wohnung zu leben und selbstbestimmt über den Einsatz und die Auswahl ihrer persönlichen Assistenten zu entscheiden.
Was bedeutet die "Arbeitgeberfunktion" im Assistenzmodell?
Der Betroffene fungiert idealerweise als Arbeitgeber, stellt die Assistenten selbst ein, leitet sie an und organisiert die Dienstpläne eigenständig.
Welche Rolle spielt das Assistenzmodell bei Muskeldystrophie?
Bei dieser fortschreitenden Muskelerkrankung hilft das Modell, trotz körperlicher Einschränkungen die soziale Integration und die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu sichern.
Was ist die Independent-Living-Bewegung?
Es ist eine Bürgerrechtsbewegung von Menschen mit Behinderung, die für Selbstbestimmung, gegen Bevormundung und gegen die Unterbringung in Heimen kämpft.
Gibt es spezielle Aspekte für Frauen im Assistenzmodell?
Die Arbeit beleuchtet spezifische Herausforderungen und Perspektiven für Frauen, wie etwa die Vereinbarkeit von Assistenz und weiblicher Lebenswelt.
Wie wirkt sich das Modell auf den Lebenssinn aus?
Am Beispiel von Frau Schmidt wird deutlich, dass die durch Assistenz gewonnene Autonomie ein zentraler Bestandteil des Lebenssinns und der Lebensqualität ist.
- Citar trabajo
- Christian Girbardt (Autor), 2006, Das Assistenzmodell bei Muskeldystrophie, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/80190