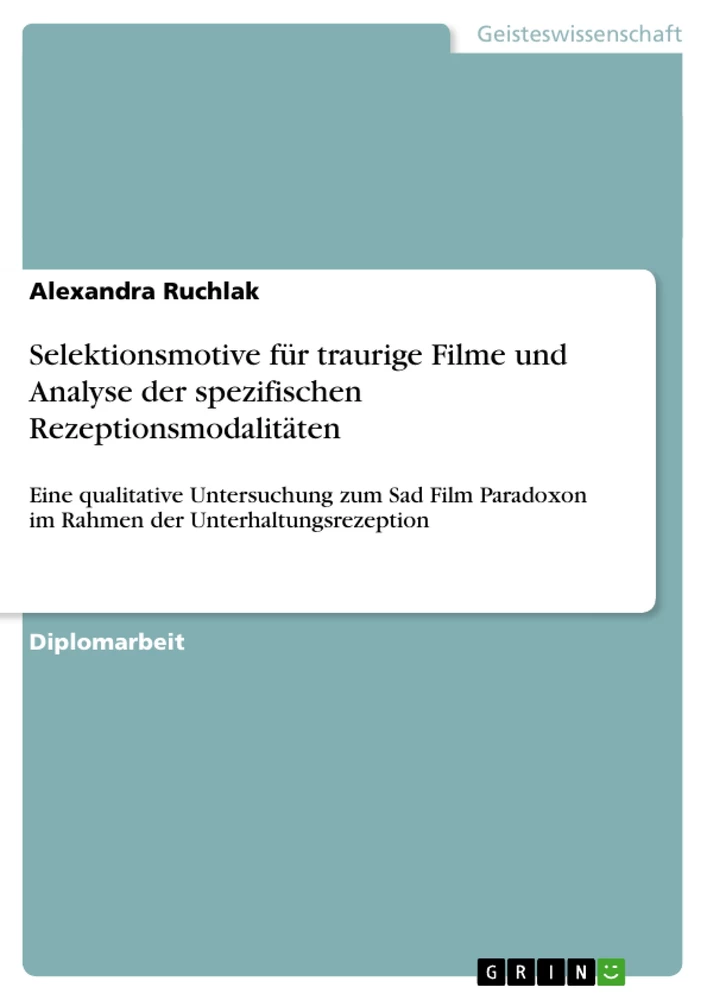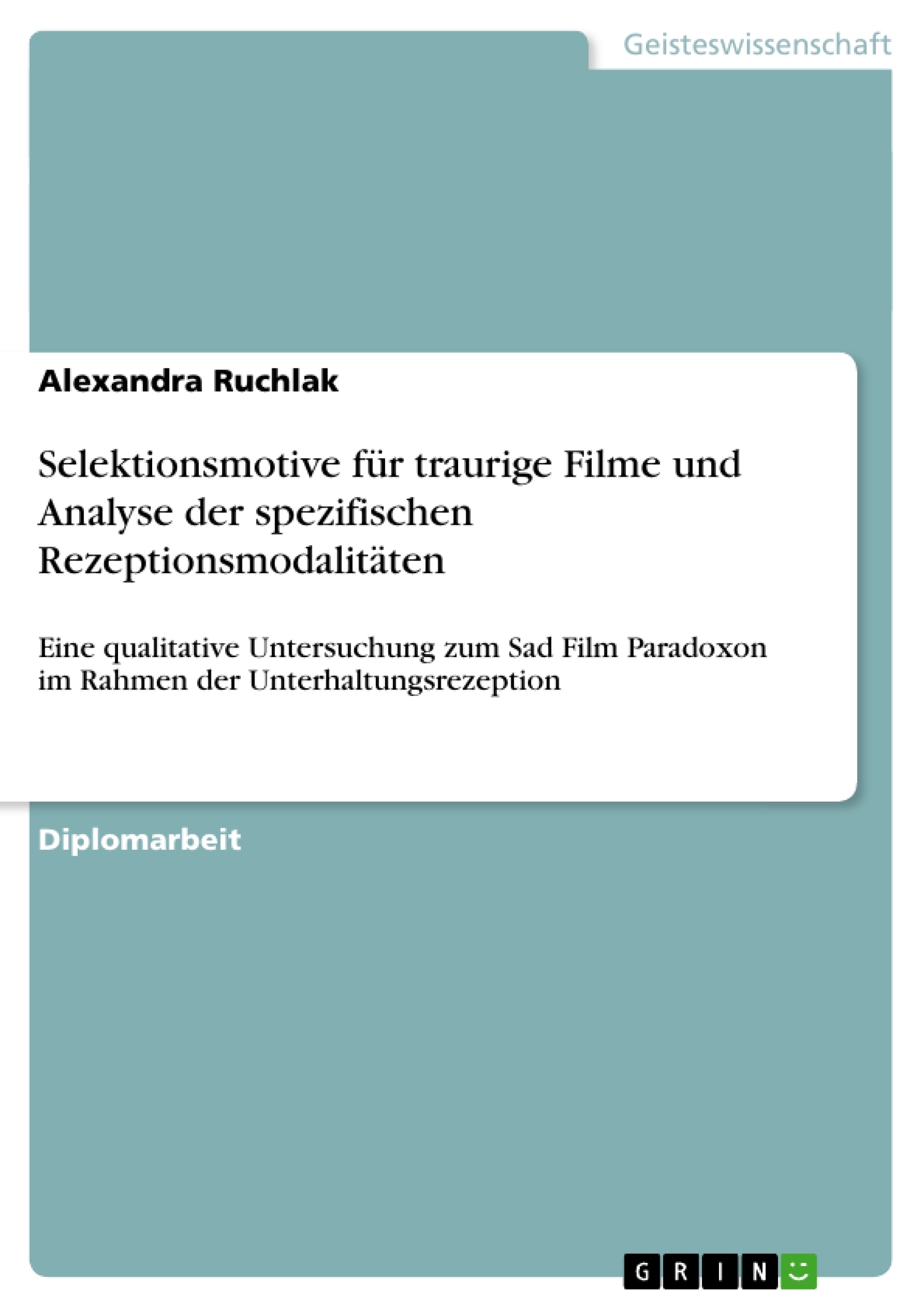Film- und FernsehzuschauerInnen erleben bei der Rezeption von Filmen mit traurigen und tragischen Inhalten intensive Gefühle, die normalerweise als unangenehm beurteilt werden, wie Trauer, Verzweiflung, Angst oder Hoffnungslosigkeit. Der kommerzielle Erfolg der ‚Tearjerker’ (amerikanischer Begriff für ‚Schnulzen’) oder Dramen und Tragödien in Fernsehen und Kino zeigt, dass die Rezipienten diese Art des Mediums als Entertainment wahrnehmen und folglich Filme, die traurige Gefühle auslösen, gezielt aufzusuchen scheinen. Dieses „Paradoxon“ wird seit Anfang der 90er Jahre versucht in Studien im Rahmen medienpsychologischer Forschung zu ergründen und als Sad Film Paradoxon bezeichnet. Inwieweit Rezipienten ihr subjektives Erleben während der Rezeption beschreiben und wie sie sich selbst die Frage nach den Gratifikationen beantworten, die sie aus diesem Medienangebot erhalten bzw. warum sie gezielt nach diesem Medium greifen (Empathie, Identifikation mit den Charakteren, Selbsterfahrung, Lernen etc.), ist auf diesem qualitativen Weg bisher noch nicht untersucht worden.
Diese Arbeit soll deshalb einen explorativen Beitrag leisten und widmet sich mithilfe einer qualitativen Einzelfallstudie unter anderen der Frage, warum sich Personen mit dieser Art von Filmen mit traurigen Inhalten „entertainen“. Zum anderen geht es aber auch um die Frage, wie die Rezipienten diese Art des Mediums wahrnehmen und welchen Nutzen sie aus der Rezeptionssituation ziehen. Von zentraler Bedeutung ist hierbei das persönliche Erleben bzgl. der Selektion und Rezeption trauriger Filme. Des weiteren sollen sich dadurch zusätzlich auch Hinweise ergeben, was der Einzelne überhaupt unter einem „traurigen“ Film versteht. Da hier davon ausgegangen wird, das Themen wie Tod / Sterben, bzw. Krankheit zentrale Elemente trauriger Filme darstellen, wird ebenso der Umgang mit diesen spezifischen Themen eruiert.
Für die Motivation, traurige Filme zu schauen konnten insgesamt 33 Motive auf drei Rezeptions-Ebenen - auf einer sozialen, einer kognitiven und einer emotionalen - identifiziert werden.
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- 1 THEORETISCHER BEZUGSRAHMEN
- 1.1 Theorien zur Mediennutzung und Unterhaltungsrezeption
- 1.1.1 Der aktive Mediennutzer
- 1.1.1.1 Der Uses-and-Gratifications-Ansatz
- 1.1.1.2 Kritik und Erweiterungen
- 1.1.2 Der Unterhaltungsbegriff innerhalb der Rezeptionsforschung
- 1.2 Das integrative Konstrukt der Rezeptionsmodalitäten
- 1.3 Erklärungsansätze und Befunde zum Sad Film Paradoxon
- 1.3.1 Das Genre,Sad Film'
- 1.3.2 Differentielle Medienwirkung und Rezipientenmerkmale
- 1.3.2.1 Gender
- 1.3.2.2 Persönlichkeitseigenschaften
- 1.3.2.3 Alexithymia und Filmpräferenz
- 1.3.3 Erklärungsansätze in Bezug auf affektive und kognitive Aktivität
- 1.3.3.1 Identifikation
- 1.3.3.2 Empathie
- 1.3.3.3 Stellenwert der Protagonisten
- 1.3.3.4 Stimmungsregulation
- 1.3.3.5 Evolutionspsychologische Perspektive
- 1.3.3.6 Kognitive Kontrollprozesse medieninduzierter Emotionen
- 1.3.3.7 Prozesse des sozialen Vergleichs
- 1.3.3.8 Einstellungen zum Mitgefühl
- 1.3.3.9 Meta-Emotionen
- 1.3.3.10 Perspektive des, Terror Managements'
- 1.3.4 Zusammenfassung: Der Stand zum Sad Film Paradoxon
- 2 METHODE
- 2.1 Fragestellung und Begründung für die Wahl einer qualitativen Untersuchungsmethodik
- 2.2 Die besonderen Merkmale qualitativer Forschung
- 2.2.1 Prinzipien und Regeln im Rahmen qualititativer Untersuchungen
- 2.2.2 Gütekriterien innerhalb qualitativer Forschung
- 2.2.3 Qualitative Datenerhebung mit halb-strukturiertem Leitfaden
- 2.3 Ablauf der Untersuchung
- 2.3.1 Begründung für die Art des Untersuchungsablaufes
- 2.3.2 Stichprobe
- 2.3.3 Untersuchungsfilm
- 2.4 Datenauswertung im Rahmen qualitativer Forschung
- 2.4.1 Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring
- 2.4.2 Vorgehen bei der Datenauswertung
- 2.4.3 Explikation des Kategoriensystems
- 2.5 Zusammenfassung: Methode
- 3 ERGEBNISSE
- 3.1 Begründung für die Art der Ergebnisdarstellung
- 3.2 Einzelfallbeschreibungen
- 3.3 Darstellung der ausgewerteten Daten
- 3.4 Motivklassen und geschlechtsspezifische Unterschiede
- 4 DISKUSSION
- 4.1 Modalitäten: Entertainment durch traurige Filme?
- 4.2 Motive: Gratifikationen durch traurige Filme?
- 4.3 Fazit
- 4.3.1 Resumée
- 4.3.2 Grenzen der Arbeit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht das Phänomen der Rezeption von "Sad Films" und die spezifischen Motive, die Zuschauer zur Auswahl und zum Genuss dieser Filme antreiben. Dabei konzentriert sie sich auf das sogenannte "Sad Film Paradoxon", welches die scheinbar widersprüchliche Freude am Konsum von Filmen beschreibt, die traurige Emotionen hervorrufen. Die Arbeit beleuchtet die Rezeptionsmodalitäten, die bei der Rezeption von "Sad Films" zum Tragen kommen und ergründet die zugrunde liegenden Motivationen.
- Rezeptionsmodalitäten trauriger Filme
- Das Sad Film Paradoxon
- Motivationen für die Rezeption von "Sad Films"
- Der Uses-and-Gratifications-Ansatz
- Qualitative Forschung und Datenauswertung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Rezeption trauriger Filme ein und beleuchtet das "Sad Film Paradoxon". Kapitel 1 beleuchtet den theoretischen Rahmen der Arbeit und stellt verschiedene Theorien zur Mediennutzung und Unterhaltungsrezeption vor, insbesondere den Uses-and-Gratifications-Ansatz. Das Kapitel widmet sich auch dem Konzept der Rezeptionsmodalitäten und beleuchtet verschiedene Erklärungsansätze für das "Sad Film Paradoxon". Kapitel 2 beschreibt die Methodik der Untersuchung, welche auf qualitative Forschungsmethoden setzt. Es wird detailliert auf die Durchführung und Auswertung der Daten eingegangen. Kapitel 3 präsentiert die Ergebnisse der Untersuchung, welche in Form von Einzelfallbeschreibungen und einer Auswertung der Daten dargestellt werden. Abschließend diskutiert Kapitel 4 die gewonnenen Erkenntnisse und beleuchtet die Bedeutung der Rezeptionsmodalitäten und Motive im Kontext des "Sad Film Paradoxons".
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert sich auf die zentralen Themen des "Sad Film Paradoxons", der Rezeptionsmodalitäten, der Motivationen für die Rezeption trauriger Filme, der qualitativen Forschung und der Anwendung des Uses-and-Gratifications-Ansatzes. Weitere wichtige Schlüsselwörter sind Entertainment, Mediennutzung, Unterhaltungsrezeption, Affektivität, Kognitive Prozesse und Gender.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das „Sad Film Paradoxon“?
Es beschreibt das Phänomen, dass Rezipienten gezielt Filme schauen, die traurige Gefühle wie Trauer oder Angst auslösen, und dies dennoch als unterhaltsam empfinden.
Welche Motive treiben Zuschauer zu traurigen Filmen?
Die Studie identifizierte 33 Motive auf sozialer, kognitiver und emotionaler Ebene, darunter Empathie, Selbsterfahrung und Stimmungsregulation.
Welche Rolle spielt der Uses-and-Gratifications-Ansatz?
Dieser Ansatz geht davon aus, dass Mediennutzer aktiv Inhalte auswählen, um spezifische Bedürfnisse zu befriedigen und Gratifikationen zu erhalten.
Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Rezeption von „Schnulzen“?
Die Arbeit untersucht, inwieweit Gender und Persönlichkeitseigenschaften die Vorliebe für das Genre „Sad Film“ beeinflussen.
Was verstehen Rezipienten unter einem „traurigen“ Film?
Zentrale Elemente sind oft Themen wie Tod, Sterben, Krankheit oder unerfüllte Liebe, die eine starke emotionale Reaktion hervorrufen.
- Citar trabajo
- Alexandra Ruchlak (Autor), 2007, Selektionsmotive für traurige Filme und Analyse der spezifischen Rezeptionsmodalitäten, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/80387