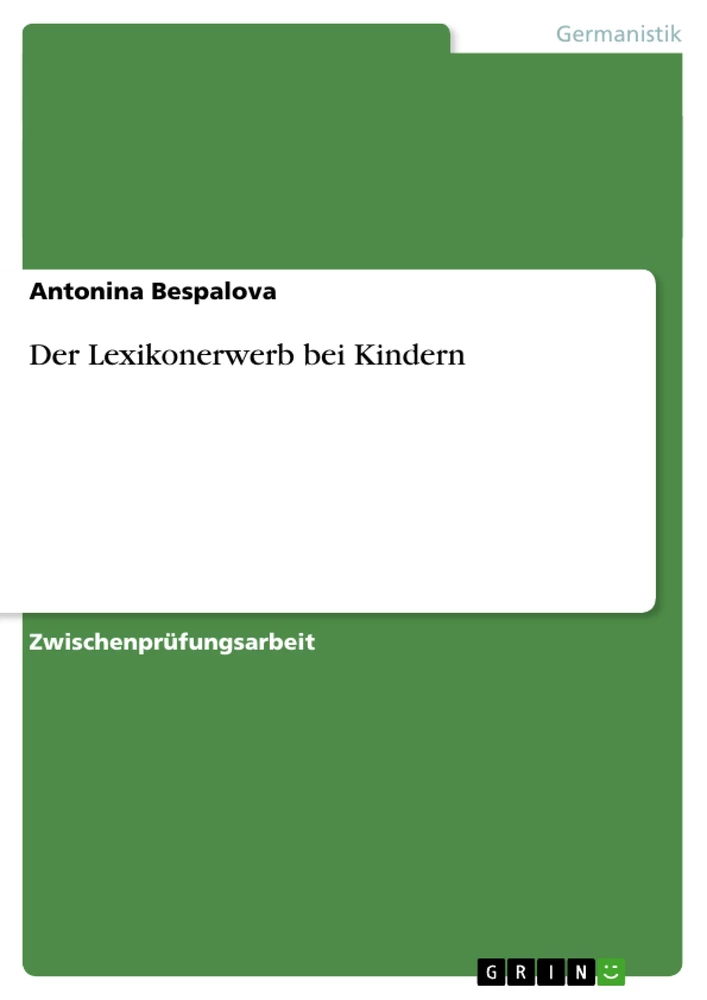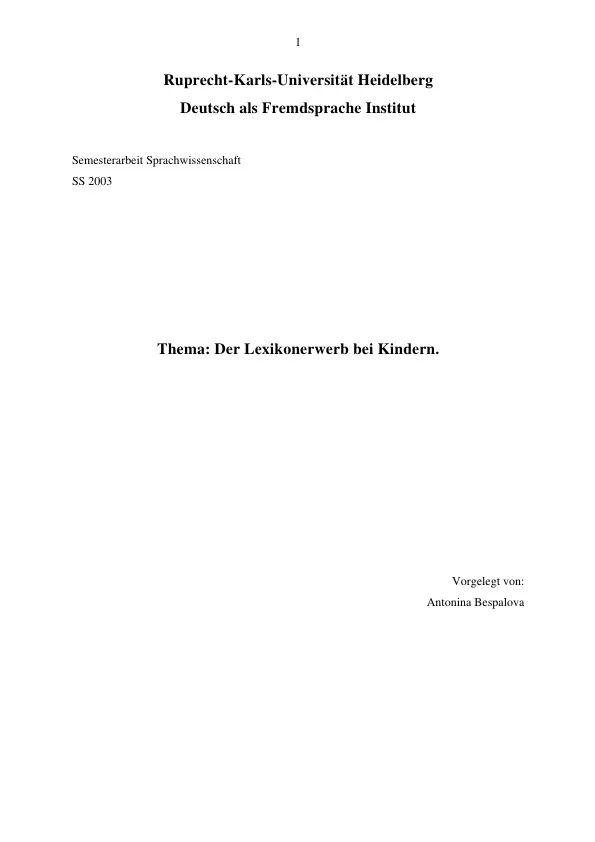Einführung
Sprache ist ein wichtiges Mittel der Kommunikation. Kinder stehen von Anfang an vor der Aufgabe die sprachlichen Zeichen zu erwerben und sie richtig zu benutzen. Nach dem Organon-Modell von Karl Bühler steht ein sprachliches Zeichen in der direkten Verbindung zwischen Sender und Empfänger und in der indirekten Verbindung zwi-schen Gegenstand und Sachverhalt (Symbol). Die Beziehung zwischen Zeichen und Symbol ist nicht eine zeicheninterne, sondern eine, die in jeder Situation neu vom Sen-der hergestellt wird.
Kinder benutzen zuerst nichtsprachliche Referenzen, d.h. Symbole, die auf etwas Bezug nehmen und erst danach sind sie dazu imstande sprachliche Referenzen richtig zu be-nutzen. Kinder sollen Verständnis über die fortdauernde Existenz eines Objektes, unab-hängig von der eigenen Wahrnehmung, erwerben. Dieses Verständnis ist die erste Stufe auf dem Weg zur Entwicklung der Symbolfunktion.
In dieser Semesterarbeit wird die Aufgabe gestellt den Prozess zu zeigen, wie monolin-guale und bilinguale Kinder Lexikon erwerben. Anschließend wird die Entwicklung des Lexikons bei diesen Kindern verglichen.
Im ersten Kapitel wird beleuchtet, wie das Kind von nichtsprachlichen und vorsprachli-chen Mitteln der Referenz zu den ersten Wörtern kommt.
Ein besonders interessanter Punkt im Lexikonerwerb ist ein sprunghafter Anstieg des Wortschatzwachstums. Forscher bezeichnen diese Phase mit einem englischen Fach-ausdruck dem vocabulary spurt. Es wird die Frage gestellt, ob der vocabulary spurt bei allen Kindern obligatorisch ist. Im dritten Kapitel werden die Beispiele der ersten Wör-ter bei englischsprachigen und deutschsprachigen Kindern angeführt. Es wird auch an-gesprochen wie und in welchem Kontext diese ersten Wörter verwendet werden. Man-chen Wörtern misst das Kind eine andere Bedeutung zu als ihnen tatsächlich zusteht. Das führt zur Entstehung von Überextensionen, Überrestriktionen, Überlappungen und mismatch.
Im vierten Kapitel wird auf den Lexikonerwerb bei bilingualen Kindern eingegangen. Hier werden auch die zwei Theorien zum simultanen Erwerb zweier Erstsprachen er-wähnt. Diese sind Sprachentrennung und Spracheneinfluss. Zum Schluss werden die le-xikalischen Interferenzen erläutert, die besonders häufig bei bilingualen Kindern auftre-ten.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Von nichtsprachlichen und vorsprachlichen Mitteln der Referenz zu den ersten Wörtern
- Wortschatzwachstum und vocabulary spurt
- Erste Wörter und ihre Bedeutungen
- Überextension und Überrestriktion
- Der Lexikonerwerb bei bilingualen Kindern
- Spracheneinfluss
- Sprachentrennung
- Interferenzen
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Semesterarbeit beleuchtet den Prozess des Lexikonerwerbs bei Kindern, wobei der Fokus sowohl auf monolingualen als auch auf bilingualen Kindern liegt. Ziel ist es, zu untersuchen, wie Kinder vom Gebrauch nichtsprachlicher und vorsprachlicher Referenzen zu ihren ersten Wörtern gelangen, und wie sich das Wortschatzwachstum bei beiden Sprachgruppen entwickelt.
- Der Übergang von nichtsprachlichen und vorsprachlichen Referenzen zu den ersten Wörtern
- Das Phänomen des "vocabulary spurt" und seine Bedeutung für das Wortschatzwachstum
- Die Bedeutung und Verwendung der ersten Wörter, einschließlich Überextensionen und Überrestriktionen
- Der Einfluss von Spracheneinfluss und Sprachentrennung auf den Lexikonerwerb bei bilingualen Kindern
- Die Rolle von lexikalischen Interferenzen im bilingualen Lexikonerwerb
Zusammenfassung der Kapitel
Im ersten Kapitel wird die Rolle nichtsprachlicher und vorsprachlicher Mittel im Prozess der Lexikonentwicklung bei Kindern erörtert. Das Kapitel behandelt die Entwicklung verschiedener Referenzmittel, wie Blickverhalten, Gesten und Vokalisationen, die den Übergang zum Gebrauch sprachlicher Referenzen markieren. Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Wortschatzwachstum bei Kindern, insbesondere mit dem "vocabulary spurt", einer Phase, in der der Wortschatz sprunghaft ansteigt. Es werden Fragen nach der obligatorischen Natur des "vocabulary spurt" und der Rolle von Faktoren wie Geschlecht und Sprachumgebung aufgeworfen. Das dritte Kapitel stellt Beispiele für die ersten Wörter bei englisch- und deutschsprachigen Kindern vor und analysiert die Bedeutung und Verwendung dieser Wörter im Kontext. Es werden zudem Phänomene wie Überextension, Überrestriktion und Überlappung bei der Verwendung von Wörtern behandelt. Das vierte Kapitel beschäftigt sich mit dem Lexikonerwerb bei bilingualen Kindern und erläutert die beiden Theorien des Spracheneinflusses und der Sprachentrennung, die den simultanen Erwerb zweier Erstsprachen beschreiben. Schließlich werden lexikalische Interferenzen, die besonders bei bilingualen Kindern auftreten, behandelt.
Schlüsselwörter
Lexikonerwerb, Kinder, nichtsprachliche Referenzen, vorsprachliche Referenzen, Wortschatzwachstum, vocabulary spurt, erste Wörter, Überextension, Überrestriktion, bilinguale Kinder, Spracheneinfluss, Sprachentrennung, Interferenzen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein „Vocabulary Spurt“?
Der Vocabulary Spurt bezeichnet eine Phase im kindlichen Spracherwerb, in der der Wortschatz plötzlich und sehr schnell ansteigt.
Was versteht man unter Überextension bei Kindern?
Überextension liegt vor, wenn ein Kind ein Wort auf zu viele Objekte anwendet, zum Beispiel wenn jedes vierbeinige Tier als „Hund“ bezeichnet wird.
Wie unterscheidet sich der Lexikonerwerb bei bilingualen Kindern?
Bilinguale Kinder erwerben zwei Lexika gleichzeitig; dabei treten oft Phänomene wie Spracheneinfluss, Sprachentrennung oder lexikalische Interferenzen auf.
Was ist das Organon-Modell von Karl Bühler?
Es beschreibt Sprache als Werkzeug, bei dem ein Zeichen gleichzeitig Symbol für Gegenstände, Symptom für den Sender und Signal für den Empfänger ist.
Welche Rolle spielen Gesten beim Spracherwerb?
Bevor Kinder Wörter benutzen, verwenden sie nichtsprachliche Referenzen wie Zeigegesten, um eine gemeinsame Aufmerksamkeit mit ihrer Umwelt herzustellen.
- Arbeit zitieren
- Antonina Bespalova (Autor:in), 2003, Der Lexikonerwerb bei Kindern , München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/80812