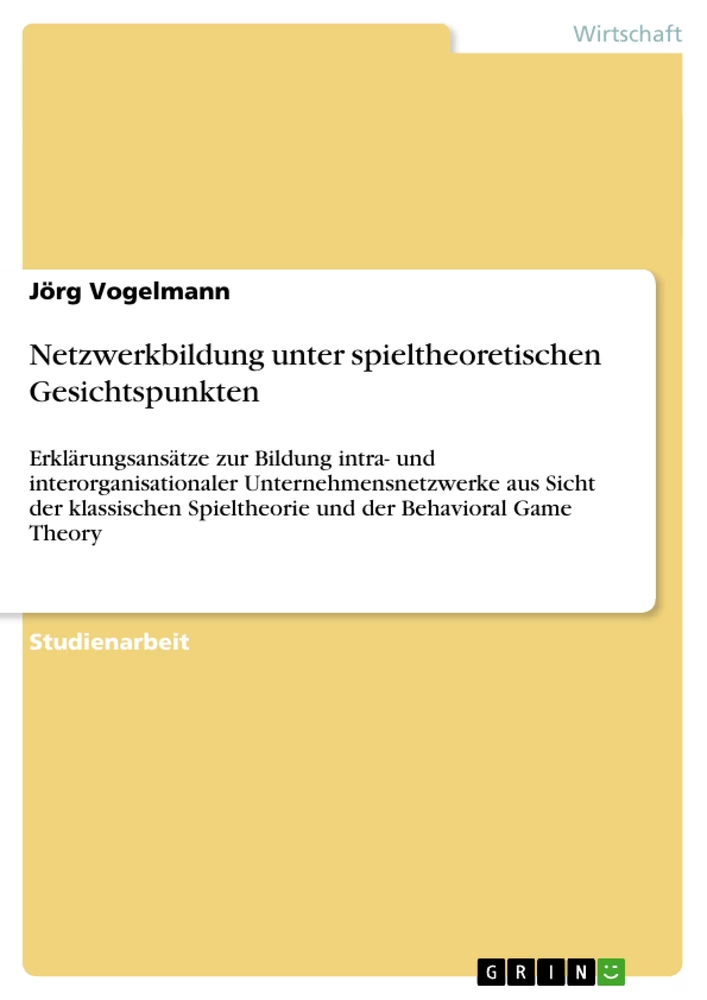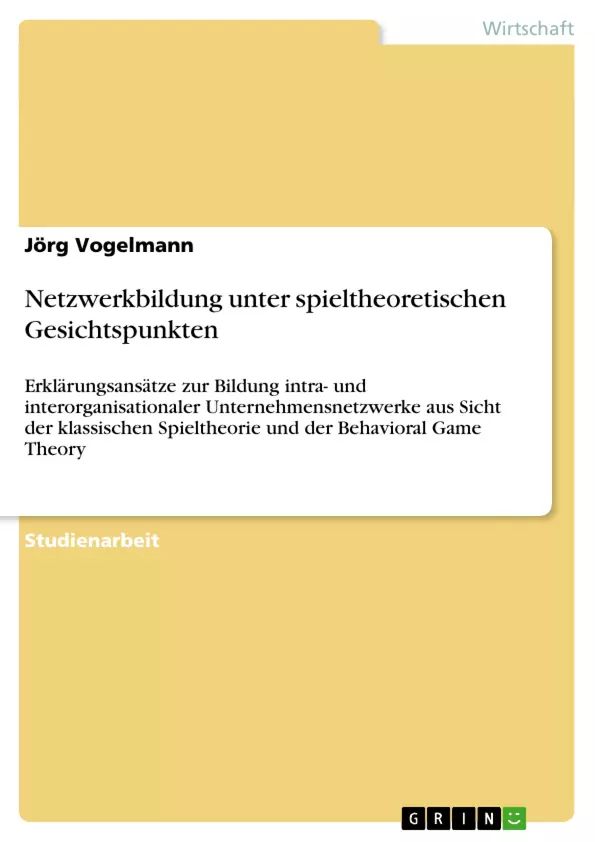Die wirtschaftliche Globalisierung vor allem innerhalb der Triade ließ seit dem Ende der bipolaren Weltordnung und dem Durchbruch der neuen IuK-Technologien den Grad des ökonomischen Wettbewerbs und Wandels in der Welt verstärkt zunehmen. Unternehmen sind in komplexeren Umfeldern gezwungen, auf die neuen Herausforderungen sowohl in ihren Strategieprozessen als auch in ihren Organisationsstrukturen dynamisch zu reagieren und klassische strategische Dilemmata etwa zwischen den Koordinationsformen Markt und Hierarchie oder den Wettbewerbsstrukturen Konkurrenz und Kooperation in hybrider Art zu vereinen. In diesem Sinne wurde in den letzten 25 Jahren in der empirischen Wirklichkeit des postfordistischen Wirtschaftssystems vor allem das Netzwerkprinzip sowohl unternehmensintern als auch in den interorganisationalen Beziehungen zunehmend dominant.
Dennoch bleiben viele Dynamiken ökonomischer Kooperation bzw. Netzwerkbildungen nach wie vor fragmentarisch erforscht bzw. theoretisch vage beschrieben. Die spieltheoretische Betrachtung der Netzwerkformierung kann hierbei den Zugang der Wirtschaftswissenschaften zu den angesprochenen Fragestellungen ontologisch und epistemologisch erweitern und ist deshalb Hauptgegenstand der vorliegenden Arbeit. Die Erklärung intra- und interorganisationaler Netzwerkbildungen aus spieltheoretischen Ansätzen heraus könnte somit neue, grundlegende Einsichten in die heute globalisierten „Wirtschaftsspiele“ innerhalb des Paradigmas von „make, buy or ally“ erbringen.
Die vorliegende Arbeit wird nach einem kurzen Überblick über Terminologie und Einordnung von Konzepten der betriebswirtschaftlichen Netzwerkforschung zunächst in die Grundzüge der Spieltheorie einführen und die „Ausgangssituation“ statisches Gefangenendilemma bzw. Nichtkooperation erläutern. Im Anschluss daran wird sie sich der Überwindung der dargestellten Problematiken zuwenden und zeigen, wie Kooperation und Netzwerkbildung letztlich doch spieltheoretisch deduziert werden können. Es folgt ein Verlassen des engen Rahmens der klassischen Spieltheorie durch einen Blick auf die Kontexte der Netzwerkformation aus Sicht der noch jungen Behavioral Game Theory, bevor im Fazit die Essentials einer spieltheoretischen Explikation der Netzwerkbildung nochmals aufgegriffen werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Netzwerke
- Netzwerkbildung unter spieltheoretischen Gesichtspunkten
- Überblick über die Spieltheorie
- Ein spieltheoretischer Ausgangspunkt: Das Gefangenendilemma
- Die Überwindung des Gefangenendilemmas: Kooperation
- Erweiterungen der Spieltheorie: Behavioral Game Theory
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit der Erklärungsweise der Bildung intra- und interorganisationaler Unternehmensnetzwerke aus Sicht der klassischen Spieltheorie und der Behavioral Game Theory. Sie zeigt auf, wie die spieltheoretische Betrachtungsweise das Verständnis von „Wirtschaftsspielen“ innerhalb des Paradigmas von „make, buy or ally“ erweitern kann.
- Kooperation und Nichtkooperation in dynamischen Spielen
- Die Bedeutung des „Schattens der Zukunft“ für Netzwerkbildung
- Die Rolle von Vertrauen und Reputationsaufbau
- Die Erweiterung der Spieltheorie durch die Behavioral Game Theory
- Die Herausforderungen der begrenzten Rationalität und der sozialen Einbindung
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt den Kontext der Globalisierung und des zunehmenden Wettbewerbs dar und erläutert die Bedeutung des Netzwerkprinzips in der postfordistischen Wirtschaft.
- Netzwerke: Dieses Kapitel definiert den Netzwerkbegriff und ordnet ihn in die betriebswirtschaftliche Forschung ein. Es werden verschiedene Kooperationsformen vorgestellt, die sich teilweise der Gruppe der Unternehmensnetzwerke zuordnen lassen.
- Netzwerkbildung unter spieltheoretischen Gesichtspunkten: Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Spieltheorie und erläutert das Gefangenendilemma als klassischen Ausgangspunkt der Netzwerkbildung. Es werden verschiedene Lösungsansätze vorgestellt, wie Kooperation und Netzwerkformation spieltheoretisch deduziert werden können, insbesondere durch wiederholte Spiele und den „Schatten der Zukunft“.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die spieltheoretische Analyse von Netzwerkbildungsprozessen, insbesondere auf die Überwindung des Gefangenendilemmas durch Kooperation. Zentrale Begriffe sind: Spieltheorie, Gefangenendilemma, Kooperation, Behavioral Game Theory, Vertrauen, Reputation, soziale Einbindung, „Schatten der Zukunft“, Tit-For-Tat, Triggerstrategien, Unternehmensnetzwerke, Kooperationsformen.
Häufig gestellte Fragen
Wie erklärt die Spieltheorie die Netzwerkbildung?
Sie analysiert strategische Interaktionen zwischen Akteuren und untersucht, unter welchen Bedingungen Kooperation (Netzwerk) gegenüber egoistischem Verhalten vorteilhafter ist.
Was ist das Gefangenendilemma?
Ein klassisches Modell der Spieltheorie, das zeigt, warum zwei rationale Akteure nicht kooperieren, selbst wenn dies in ihrem gemeinsamen Interesse läge, aus Angst vor dem Verrat des anderen.
Was bedeutet der „Schatten der Zukunft“?
In wiederholten Spielen führt die Aussicht auf zukünftige Interaktionen dazu, dass Akteure eher kooperieren, um ihre Reputation nicht zu gefährden und langfristige Vorteile zu sichern.
Was ist die Behavioral Game Theory?
Diese Erweiterung der Spieltheorie berücksichtigt psychologische Faktoren und zeigt, dass Menschen oft nicht rein rational handeln, sondern von Fairness, Vertrauen und sozialen Normen beeinflusst werden.
Was ist die „Tit-for-Tat“-Strategie?
Eine erfolgreiche Strategie in wiederholten Spielen: Man beginnt kooperativ und kopiert im nächsten Schritt einfach das Verhalten, das der Partner im vorherigen Zug gezeigt hat.
- Quote paper
- Jörg Vogelmann (Author), 2006, Netzwerkbildung unter spieltheoretischen Gesichtspunkten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/81662