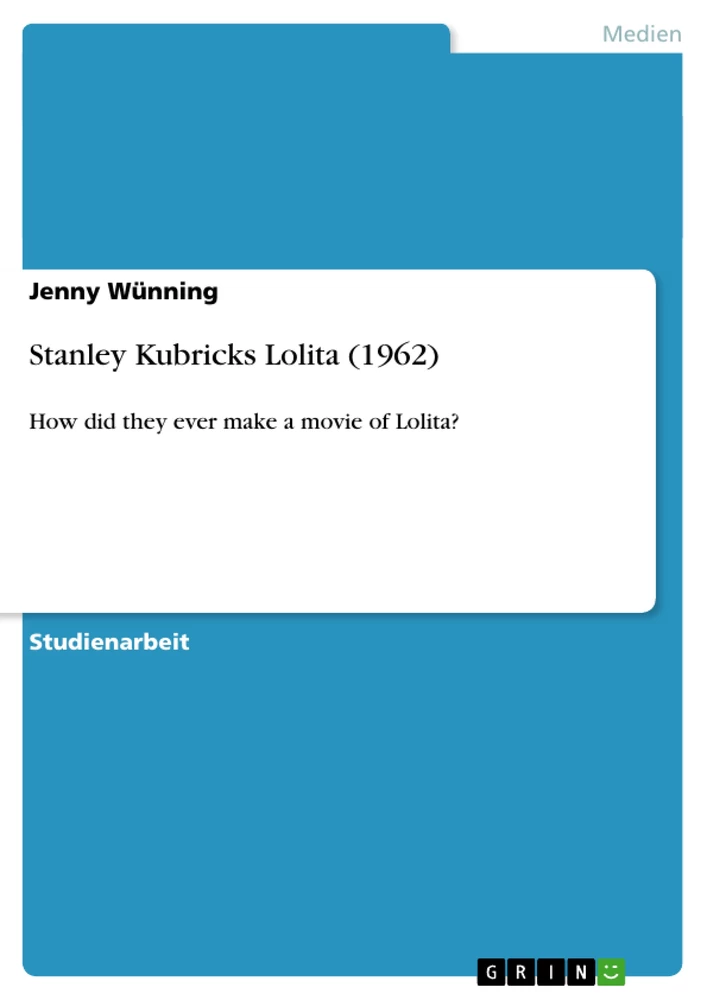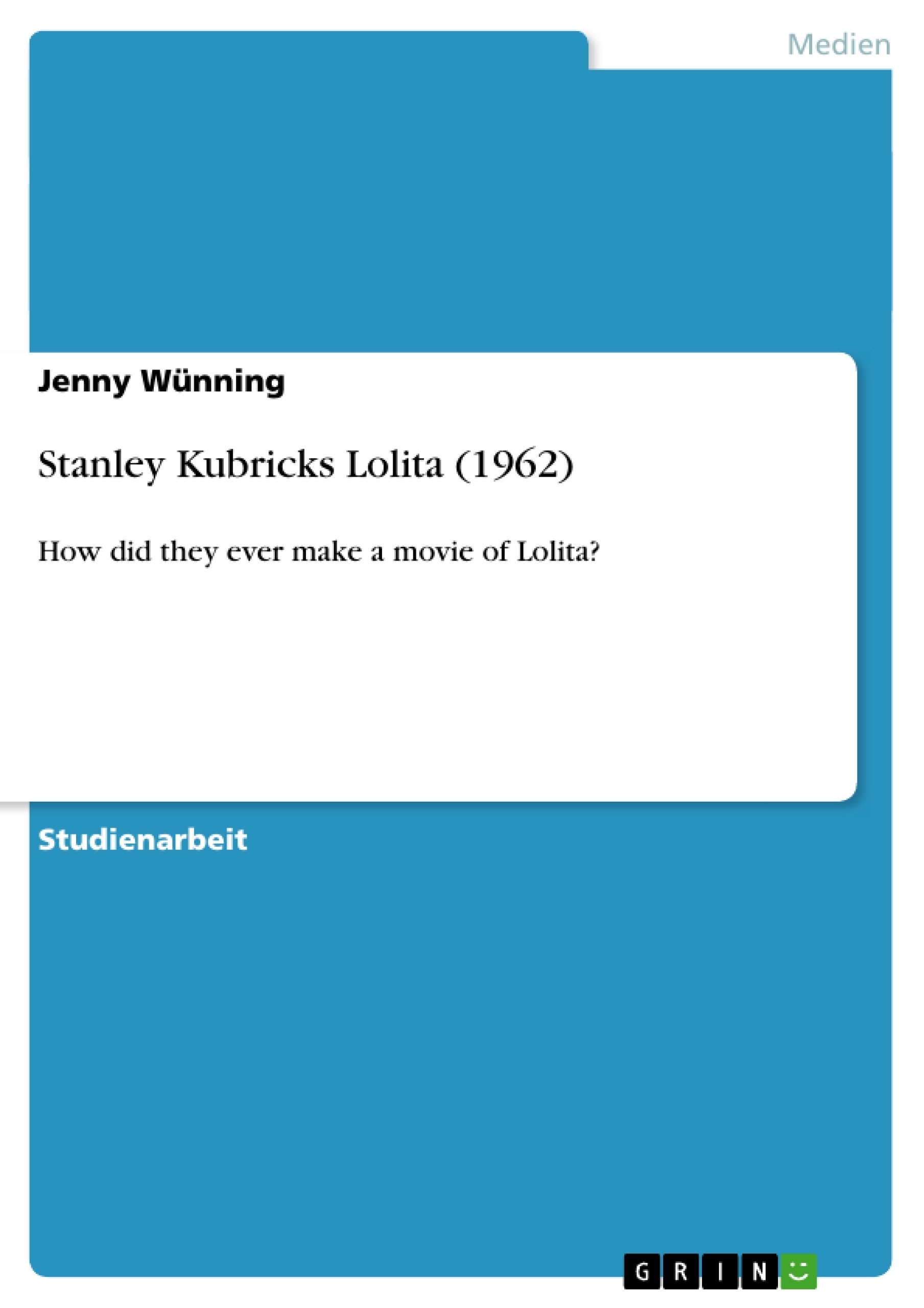„How did they ever make a movie of Lolita?“ Mit dieser Frage wurde 1962 auf den Filmplakaten geworben und ihr möchte ich in meiner Hausarbeit nachgehen. Als
Einleitung sollen ein zusammenfassender Abriss der Filmhandlung und ein Überblick zur Entstehung dienen. Um vor allem die kritischen Stimmen zum Film nachvollziehen zu können, verlangt es nach einem Vergleich mit der literarischen Vorlage. Kubrick hatte außerdem mit Schwierigkeiten der Zensur zu kämpfen. Eine Analyse der filmischen Charaktere in Bezug auf das Werk von Stanley Kubrick, soll die Problematik des Films tiefer herausarbeiten. Am Ende gehe ich kurz auf den Mythos der Nymphen, die als psychologisches Phänomen zentrales Thema des Films sind.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Filminhalt
- 3. Entstehung
- 4. Adaption: Vom Roman zum Film
- 4.1 Zensur
- 4.2 Die Problematik der Verfilmbarkeit: Analytischer Vergleich der literarischen Vorlage und der filmischen Umsetzung
- 5. Einordnung der Charaktere unter dem Aspekt des Kinos von Stanley Kubrick
- 5.1 Humbert Humbert (James Mason)
- 5.2 Clare Quilty (Peter Sellers)
- 5.3 Lolita Haze (Sue Lyon)
- 5.4 Charlotte Haze (Shelley Winters)
- 5.5 Zusammenfassung
- 6. Der Nymphenmythos
- 6.1 Definitionen nach Nabokov und Kubrick
- 6.2 Psychoanalyse
- 6.3 Sue Lyon - Schicksal einer Hollywood-Lolita
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht Stanley Kubricks Verfilmung von Nabokovs "Lolita" von 1962. Ziel ist es, die Herausforderungen bei der Adaption des kontroversen Romans, die Zensurprobleme und die Einordnung der Charaktere im Kontext von Kubricks Werk zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet den Umgang mit dem Thema Pädophilie und den Nymphenmythos im Film.
- Die Adaption von Nabokovs Roman in einen Film und die damit verbundenen Schwierigkeiten.
- Die Zensur und deren Einfluss auf die filmische Umsetzung.
- Die Charakterisierung der Hauptfiguren und ihre Darstellung im Film.
- Die Auseinandersetzung mit dem Thema Pädophilie und die Darstellung sexueller Aspekte.
- Die Rolle des Nymphenmythos in der Interpretation des Romans und des Films.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Anstoß zur Hausarbeit: Der Besuch des Films "Lolita" auf der Berlinale und der Vergleich mit einer späteren Verfilmung wecken das Interesse an einer tiefergehenden Auseinandersetzung mit Kubricks Werk, der Romanvorlage und den Problemen der Verfilmung. Die zentrale Frage lautet: "How did they ever make a movie of Lolita?".
2. Filminhalt: Dieser Abschnitt fasst die Handlung des Films zusammen: Vom Mord an Quilty bis zur Rückblende, die die Beziehung zwischen Humbert Humbert und Lolita, sowie deren tragische Folgen nachzeichnet. Die Handlungsschritte, von Humberts Ankunft in Ramsdale bis zu Lolitas Brief und Humberts Racheakt, werden chronologisch nacherzählt. Die Darstellung der Beziehung zwischen Humbert und Lolita, sowie die Nebenfiguren werden kurz skizziert.
3. Entstehung: Kapitel drei beschreibt die Entstehung des Films, beginnend mit der Veröffentlichung von Nabokovs Roman und den anfänglichen Schwierigkeiten bei der Verfilmung. Es wird der lange Weg zur Realisierung des Projekts geschildert, einschließlich der Ablehnung durch verschiedene Studios und die Auseinandersetzung mit der strengen Zensur der damaligen Zeit. Die Überarbeitung des Drehbuchs durch Kubrick und Nabokov wird erwähnt, sowie die Verzögerung der Veröffentlichung aufgrund von Zensurproblemen.
Schlüsselwörter
Stanley Kubrick, Lolita, Vladimir Nabokov, Verfilmung, Adaption, Zensur, Pädophilie, Nymphenmythos, James Mason, Sue Lyon, Peter Sellers, Filmgeschichte, Filmanalyse.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu der Hausarbeit: "Kubricks Lolita"
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit analysiert Stanley Kubricks Verfilmung von Vladimir Nabokovs Roman "Lolita" aus dem Jahr 1962. Im Mittelpunkt stehen die Herausforderungen der Adaption, die Zensurprobleme und die Einordnung der Charaktere im Kontext von Kubricks Werk. Die Arbeit beleuchtet den Umgang mit Pädophilie und dem Nymphenmythos im Film.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Hausarbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: die Adaption des Romans in einen Film und die damit verbundenen Schwierigkeiten, die Zensur und deren Einfluss auf die filmische Umsetzung, die Charakterisierung der Hauptfiguren und ihre Darstellung im Film, die Auseinandersetzung mit dem Thema Pädophilie und die Darstellung sexueller Aspekte sowie die Rolle des Nymphenmythos in der Interpretation des Romans und des Films.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit und worum geht es in ihnen?
Die Hausarbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Kapitel 1 (Einleitung) beschreibt den Anstoß zur Hausarbeit und die zentrale Forschungsfrage. Kapitel 2 (Filminhalt) fasst die Handlung des Films zusammen. Kapitel 3 (Entstehung) behandelt die Entstehung des Films, die Schwierigkeiten bei der Verfilmung und die Zensurprobleme. Kapitel 4 (Adaption) vergleicht den Roman und die Filmadaption und analysiert die Zensur. Kapitel 5 (Charaktere) ordnet die Charaktere im Kontext von Kubricks Werk ein. Kapitel 6 (Nymphenmythos) untersucht den Nymphenmythos im Roman und Film. Kapitel 7 (Fazit) zieht abschließende Schlussfolgerungen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Stanley Kubrick, Lolita, Vladimir Nabokov, Verfilmung, Adaption, Zensur, Pädophilie, Nymphenmythos, James Mason, Sue Lyon, Peter Sellers, Filmgeschichte, Filmanalyse.
Welche Zielsetzung verfolgt die Hausarbeit?
Die Hausarbeit analysiert die Herausforderungen bei der Adaption des kontroversen Romans, die Zensurprobleme und die Einordnung der Charaktere im Kontext von Kubricks Werk. Ein besonderes Augenmerk liegt auf dem Umgang mit dem Thema Pädophilie und dem Nymphenmythos im Film.
Wie ist der Aufbau der Hausarbeit strukturiert?
Die Hausarbeit beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Beschreibung der Zielsetzung und der Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste der Schlüsselwörter.
- Quote paper
- Jenny Wünning (Author), 2005, Stanley Kubricks Lolita (1962), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/82100