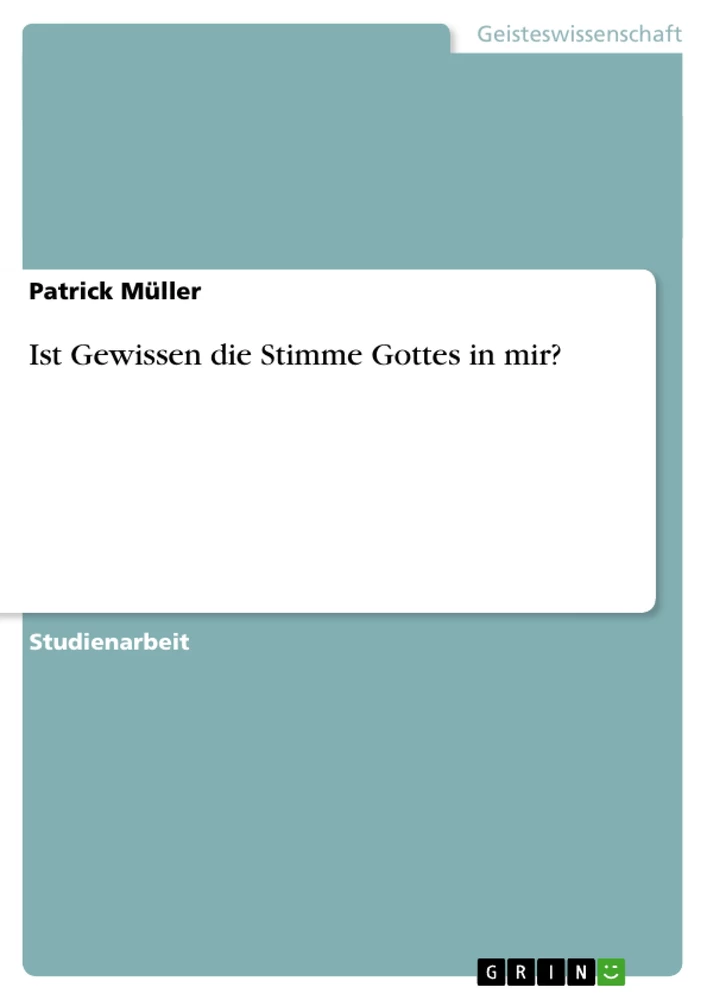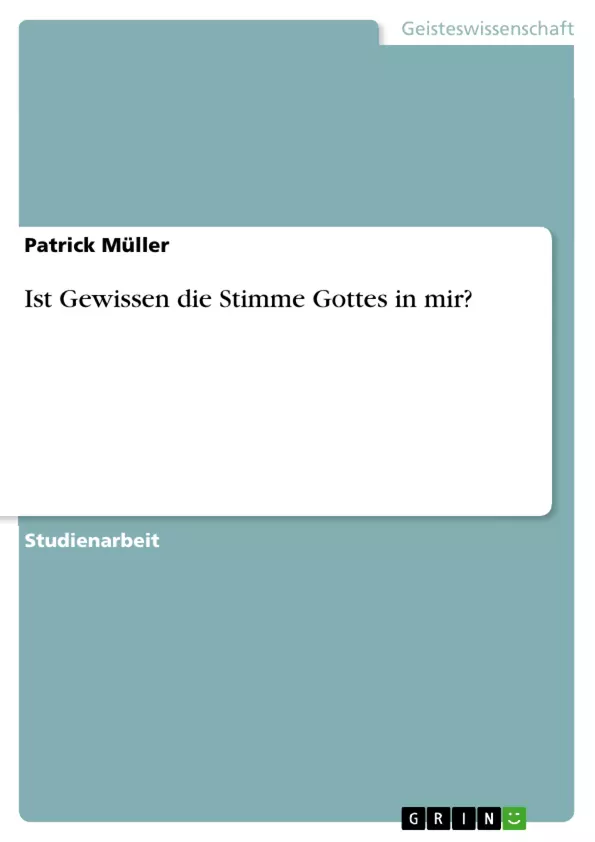Bei allen Entscheidungsprozessen, selbst bei den unbedeutsamsten, meldet sich eine Stimme in unserem Innern zu Wort, die uns dazu anhält, auf eine ganz bestimmte Weise zu handeln. Selbst bei intuitiven, unbewussten Reaktionen ruft sie uns gewissermaßen retrospektiv die Handlung in unser Bewusstsein zurück, um bewertende Maßstäbe an ihr anzulegen.
Diese Stimme unseres Selbst bezeichnet man gemeinhin als Gewissen. Was ist aber nun dieses Gewissen? Ist es wirklich nur ein persönlicher Moral-Guide, oder versteckt sich hinter seiner Wirklichkeit eine ganz andere Wirklichkeit? Alle reden von Gewissen und keiner scheint so genau zu wissen, was es ist. Zumindest gibt es äußerst vielfältige Anschauungen, die zum einen aus der nicht ganz einfachen Wortgeschichte, zum andern aber auch es den verschiedenen Perspektiven der Wissenschaften resultieren.
Theologische Ethik muss fragen, inwieweit sich das Gewissen als Instrument eines verantwortungsvollen Lebens und Handelns begreifen lässt, und zwar auf dem Hintergrund der jüdisch-christlichen Gotteserfahrung und Anthropologie. Aus diesen Aspekten und Anfragen ergibt sich ein methodischer Dreischritt für diese Arbeit. Am Anfang richtet sich deshalb eine sprach- und kulturhistorische Betrachtung auf die Semantik des Gewissensbegriffs und seine Verwendung in der Sprache. Nachdem verschiedenste Erklärungsmodelle zur Entstehung des Gewissens kurz dargestellt worden sind, wird der Frage nachgegangen, ob und wie angesichts der vielfältigen Abhängigkeiten und anthropologischen Determinanten ein freies Gewissensurteil und damit autonome moralische Entscheidungskompetenz überhaupt möglich sein kann. Den Abschluss bildet ein Kapitel, dass für die theologische Ethik zentral sein muss, gleichzeitig aber den schwierigsten Zugang zur Thematik eröffnet. Es stellt sich nämlich die Frage, wie man das Phänomen des Gewissens theologisch deuten kann, ohne dabei aber zu sehr die Bodenhaftung zu verlieren, und den Gegenstand zu sehr zu spiritualisieren.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Historische und linguistische Annäherung an den Gewissensbegriff
- 1. Etymologie und Wortgeschichte
- 2. Sprachgebrauch
- II. Gewissen als anthropologisches Grundphänomen
- 1. Phänomenologie und Funktionen des Gewissens
- 2. Erklärungsmodelle zur Entstehung des Gewissens
- 2.1 Biblisch: der Sündenfall
- 2.2 Christlich: Thomas von Aquin, Martin Luther, Johannes Paul II.
- 2.3 Philosophisch: Kant, Nietzsche
- 2.4 Soziologisch: Spencer, Durkheim
- 2.5 Psychologisch: Freud, Piaget, Kohlberg
- 3. Moralisches Handeln zwischen Determination und Autonomie
- III. Theologische Deutung des Gewissens
- 1. Der Gott mit dem Mikrofon – Probleme und Gefahren einer banalen Gewissensauffassung
- 2. Gewissen als Anspruch und Zuspruch Gottes
- 3. Die Wirklichkeit des Gewissens und die jüdisch-christliche Gottesidee
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Begriff des Gewissens aus theologisch-ethischer Perspektive. Sie beleuchtet die historische Entwicklung und den sprachlichen Gebrauch des Begriffs, analysiert das Gewissen als anthropologisches Phänomen und erörtert schließlich dessen theologische Deutung im Kontext der jüdisch-christlichen Tradition. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis des Gewissens zu entwickeln und seine Bedeutung für verantwortungsvolles Handeln zu ergründen.
- Historische und linguistische Entwicklung des Gewissensbegriffs
- Das Gewissen als anthropologisches Grundphänomen und seine Funktionen
- Verschiedene Erklärungsmodelle zur Entstehung des Gewissens
- Das Verhältnis von freiem Gewissensurteil und anthropologischen Determinanten
- Theologische Deutung des Gewissens und seine Bedeutung für ethisches Handeln
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik des Gewissens ein und stellt die zentrale Frage nach der Natur des Gewissens und seiner möglichen Verbindung zu einer höheren Wirklichkeit. Sie hebt die Vielschichtigkeit des Begriffs hervor, die aus seiner Wortgeschichte und den unterschiedlichen wissenschaftlichen Perspektiven resultiert. Die Arbeit verfolgt einen dreistufigen methodischen Ansatz: zunächst sprach- und kulturhistorische Betrachtung, dann Analyse verschiedener Erklärungsmodelle zur Entstehung des Gewissens und schließlich eine theologische Deutung des Phänomens.
I. Historische und linguistische Annäherung an den Gewissensbegriff: Dieses Kapitel untersucht die semantische Entwicklung des Begriffs „Gewissen“ von der Etymologie bis zum modernen Sprachgebrauch. Die Analyse umfasst die Wortbildung, die diachrone Betrachtung der Bedeutung in verschiedenen Sprachen (lateinisch, griechisch, deutsch) und die Entwicklung des Begriffs innerhalb der Rechtssprache und der Theologie. Es werden verschiedene Bedeutungsnuancen wie „Mitwissen“, „reflexives Wissen“, „sittliche Instanz“ und „Eigenes Ich“ herausgearbeitet. Die Analyse zeigt die komplexe und vielschichtige Geschichte des Begriffs und seine Entwicklung hin zu einer ethisch-religiösen Bedeutung.
II. Gewissen als anthropologisches Grundphänomen: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Gewissen als grundlegendes menschliches Phänomen. Es untersucht die Phänomenologie des Gewissens, seine Funktionen und verschiedene Erklärungsmodelle für seine Entstehung aus biblischer, christlicher, philosophischer, soziologischer und psychologischer Perspektive. Die Diskussion der verschiedenen Erklärungsansätze von Thomas von Aquin bis Freud verdeutlicht die Komplexität des Phänomens und die Schwierigkeit, es umfassend zu erklären. Ein zentraler Aspekt ist die Frage nach dem Verhältnis von freiem Gewissensurteil und anthropologischen Determinanten, die das moralische Handeln beeinflussen.
III. Theologische Deutung des Gewissens: Dieses Kapitel widmet sich der theologischen Interpretation des Gewissens. Es beginnt mit einer kritischen Auseinandersetzung mit einer vereinfachten, „banalen“ Gewissensauffassung. Im Mittelpunkt steht die Betrachtung des Gewissens als Anspruch und Zuspruch Gottes, und die Einbettung des Phänomens in die jüdisch-christliche Gottesidee. Der Fokus liegt auf der Frage, wie eine theologische Deutung des Gewissens gelingen kann, ohne dabei den Bezug zur Realität zu verlieren und das Phänomen zu stark zu spiritualisieren.
Schlüsselwörter
Gewissen, theologische Ethik, Anthropologie, Moral, Gott, Sündenfall, Gewissensfreiheit, Autonomie, Determination, Etymologie, Sprachgebrauch, Thomas von Aquin, Martin Luther, Kant, Nietzsche, Freud, Piaget, Kohlberg.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Thema "Gewissen"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Begriff des Gewissens aus theologisch-ethischer Perspektive. Sie beleuchtet die historische Entwicklung und den sprachlichen Gebrauch des Begriffs, analysiert das Gewissen als anthropologisches Phänomen und erörtert dessen theologische Deutung im Kontext der jüdisch-christlichen Tradition. Ziel ist ein umfassendes Verständnis des Gewissens und seiner Bedeutung für verantwortungsvolles Handeln.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, drei Hauptkapitel und ein Schlusswort. Kapitel I behandelt die historische und linguistische Annäherung an den Gewissensbegriff. Kapitel II widmet sich dem Gewissen als anthropologisches Grundphänomen, inklusive verschiedener Erklärungsmodelle. Kapitel III bietet eine theologische Deutung des Gewissens.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die historische und linguistische Entwicklung des Gewissensbegriffs, das Gewissen als anthropologisches Grundphänomen und seine Funktionen, verschiedene Erklärungsmodelle zur Entstehung des Gewissens, das Verhältnis von freiem Gewissensurteil und anthropologischen Determinanten sowie die theologische Deutung des Gewissens und seine Bedeutung für ethisches Handeln.
Welche wissenschaftlichen Perspektiven werden einbezogen?
Die Arbeit integriert biblische, christliche (Thomas von Aquin, Martin Luther, Johannes Paul II.), philosophische (Kant, Nietzsche), soziologische (Spencer, Durkheim) und psychologische (Freud, Piaget, Kohlberg) Perspektiven auf das Gewissen.
Wie wird das Gewissen in dieser Arbeit theologisch gedeutet?
Die theologische Deutung des Gewissens setzt sich kritisch mit einer banalen Gewissensauffassung auseinander und betrachtet das Gewissen als Anspruch und Zuspruch Gottes, eingebettet in die jüdisch-christliche Gottesidee. Es wird darauf geachtet, den Bezug zur Realität zu wahren und eine Über-Spiritualisierung zu vermeiden.
Welche Methoden werden in dieser Arbeit angewendet?
Die Arbeit verfolgt einen dreistufigen methodischen Ansatz: zunächst sprach- und kulturhistorische Betrachtung, dann Analyse verschiedener Erklärungsmodelle zur Entstehung des Gewissens und schließlich eine theologische Deutung des Phänomens.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Schlüsselbegriffe sind Gewissen, theologische Ethik, Anthropologie, Moral, Gott, Sündenfall, Gewissensfreiheit, Autonomie, Determination, Etymologie, Sprachgebrauch, Thomas von Aquin, Martin Luther, Kant, Nietzsche, Freud, Piaget und Kohlberg.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält Zusammenfassungen der Einleitung und der drei Hauptkapitel, welche die jeweiligen Inhalte und Schwerpunkte detailliert beschreiben.
- Quote paper
- Patrick Müller (Author), 2002, Ist Gewissen die Stimme Gottes in mir?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/8254